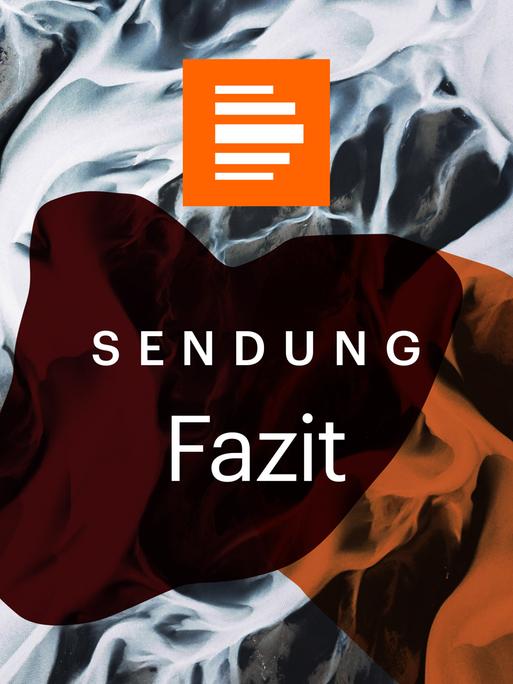Geburtsstunde des Expressionismus
Lange wurde gerätselt, wann genau sich die expressionistische Künstlergruppe "Brücke" formierte - bis man im Nachlass des Mitglieds Ernst Ludwig Kirchner einen Zettel mit dem Satz fand: "7. Juni 1905, Zusammenschluss zur Künstlergruppe", der alle Mutmaßungen beendete.
Den 100-jährigen Geburtstag dieser für die deutsche Kunst elementaren Gründung begeht nun die Neue Nationalgalerie in Berlin mit einer großen Jubiläumsschau, an der auch das Brücke Museum und das Kupferstichkabinett beteiligt sind. Gleichzeitig gibt es im Brücke Museum in Berlin-Dahlem einen umfassenden Überblick über die frühe Druckgrafik der damals gerade 20-jährigen Künstler.
Dass die Brücke-Maler zum Jubiläum in Mies van der Rohes Neuer Nationalgalerie in Berlin hängen, hat mehr als seine Richtigkeit - waren doch die Dresdener Gründungsmitglieder Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff ursprünglich Architekturstudenten und kaum älter als der Bauhaus-Meister selbst.
Schon von außen sind im gläsernen Foyer große Fotofahnen zu entdecken: Streng schaut der Kaiser auf die Partyszene der Brücke. Deren zentrales Credo lautete: Unmittelbar und unverfälscht die eigenen Gefühle wiederzugeben. Dazu auch Fotos und Exponate aus den damaligen Völkerkunde-Museen. Die Brücke-Maler, nicht nur die vier Gruppengründer, sondern auch die später Beigetretenen Otto Mueller, Max Pechstein und Emil Nolde, sahen das Deutsche Reich nicht als den Nabel der Welt, sondern entwickelten auch ein Auge für außereuropäische Kulturen.
Der Direktor des Kupferstichkabinetts, des größten Leihgebers dieser 500 Exponate versprechenden Ausstellung, Hein Theodor Schulze Altcappenberg, sieht die "Brücke" als eine heftige Variante des allgemeinen Aufbruchs in die europäische Moderne zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
" Sie ist ja nicht aus dem Nichts geboren worden. Die jungen Künstler haben sich damit auseinandergesetzt mit den Strömungen der Zeit, sie haben sich mit der Modernität auseinandergesetzt … aber es fokussiert in dem Thema Brücke und Berlin und zwar …von den Sammlungen her, dass die Kernsammlungen in Berlin, nämlich der Nationalgalerie, des Kupferstichkabinetts und des Brücke Museums mit den besten Sachen zusammengefasst sind, das sind wirklich weltweit zusammengenommen ist das schon der Kern, das ist das Panorama der Brücke. Berlin wird immer wieder besonders betont in den einzelnen Kapiteln, aber es ist insgesamt aufgeteilt nach elf Kapiteln, thematisch aufgeteilt nach Landschaften, nach Alltagsszenen, nach diesen, ich sag mal kunstgewerblichen, künstlerischen Entwurfsarbeiten, die da sind, nach Grafik, Poster, Plakatkunst der Brücke. Also das ganze Spektrum der Brücke wird abgedeckt. In elf Kapiteln wird das abgewickelt."
Das Gruppenbild der Künstlergemeinschaft entstand retrospektiv, vier Herren in Anzügen, denen das Revolutionäre nicht auf den ersten Blick anzusehen ist. Nur die Farbigkeit deutet darauf hin: Blau, Lila, Türkis und ein wenig Rosa. Die Farben haben die Brücke-Maler berühmt, später auch beliebt gemacht: Bilder, die jeden Betrachter aus dem grauen Alltag reißen.
Pechsteins "Sitzendes Mädchen" wird von leuchtend roten Bahnen umgeben, im Hintergrund wuchert sattes Grün. Das Modell ist auf selbstverständliche Weise nackt, dreht zwar den Körper weg, sieht dennoch dem Betrachter ins Gesicht, unprovokativ - eine Momentaufnahme, wie die so genannten "Viertelstunden-Akte", bei denen die Maler mit wenigen Strichen in kürzester Zeit den weiblichen Körper festhielten. Fränzi, die Zehnjährige taucht auf vielen dieser Zeichnungen auf - in Dresden das Lieblingsmodell der Maler: Kindfrau mit der unverkennbaren Haarschleife.
In der - die Nationalgalerie-Schau ergänzenden - 130 Exponate umfassenden Grafik-Ausstellung des Brücke Museums in Berlin-Dahlem lässt sich diese Sujet- und Stil-Entwicklung genau verfolgen: Wie sich aus Jugendstil, Symbolismus und Japonismus der unverkennbare Duktus entwickelte: klar konturiert, flächig, kantig. Und wie sich immer mehr der menschliche Körper, besonders der Frauenkörper motivisch durchsetzt - das zentrale und provokante Thema, wie die Leiterin des Brücke Museums, Magdalena Moeller, bestätigt:
" Das war auf jeden Fall provokativ, das war eine neue Freiheit mit dem menschlichen Körper umzugehen. Denn die akademische Kunst hat ja den Akt immer nur im Atelier dargestellt, während die Brücke-Künstler mit ihren Freundinnen aufs Land gezogen sind, an die Moritzburger Teiche oder sonst in die Umgebung von Dresden, und haben dort das Aktstudium in der freien Natur geübt.
Das Thema Akt ist eigentlich das Vordringliche der Brücke-Kunst. Das dominiert dann auch immer stärker, sowohl in der Dresdener Zeit wie denn auch natürlich in den Berliner Jahren. Stillleben tauchen ganz selten auf, aber Porträts gibt es häufige, vor allen Dingen auch gegenseitige Porträts, so genannte Freundschaftsbildnisse."
Sie haben einander gezeichnet, im wörtlichen, wie im übertragenen Sinne. Auf Holzschnitten, Lithografien und Skizzen tauchen die Köpfe der Freunde auf, die sonst leicht in der Gruppe verschwimmen, und die eigentlich erst in den Nach-Brücke Jahren - also nach 1913 - biographische Konturen gewinnen.
Herausragend: Ernst Ludwig Kirchner. 25.000 Zeichnungen hat er hinterlassen, Bleistiftstenogramme, teils farbig, von Freunden und Fremden, aus der Stadt und aus der Sommerfrische.
Die Pracht der nahen und fernen Paradiese ist auch Brücke-Thema: Von Otto Muellers Badeszenen bis zu Emil Noldes ethnologischen Studien. Später machen zwei mit dem Fernweh ernst: Nolde reist nach Deutsch-Neuguinea und Pechstein auf die Palau-Inseln.
Doch noch vorher - mit dem Umzug vom behäbigeren Dresden ins aggressive Berlin 1911 - gewinnt die Gruppe weiter an Prägnanz. Die großen Straßenbilder entstanden: Kirchners Potsdamer Platz, Belle Alliance-Platz, Friedrich Straße, Leipziger Straße: Frauensilhouetten in neonbeleuchteten Rosa-Lila-Blautönen mit fabelhaften Federhüten; neben Herren in dunklen Anzügen, die immer etwas Uniformiertes haben; Straßen wie Innenräume, Schattenseiten aller Natur - hier, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, eine gleißenden Härte.
" In dieser Gemengelage, in diesem brodelnden Kessel vor dem ersten Weltkrieg da sind diese Künstler groß geworden, zu ihrer ersten Reife gekommen. Sie genießen die Großstadt einerseits, sie werden abgestoßen von ihr andererseits. Sie machen alle ihre individuellen Erfahrungen. Es steht dann wirklich unmittelbar der Krieg bevor. Sie trennen sich 1913, offiziell wird sie aufgelöst. Sie haben natürlich weiterhin persönlichen Kontakt. Einzelne ziehen mit Euphorie in den Krieg, andere, wie Kirchner zum Beispiel sind nach wenigen Monaten psychisch Ruinen geworden. Sie machen sehr unterschiedliche persönliche Erfahrungen mit dieser Kriegssituation. Dann der Erfolg in den 20er Jahren. Absolut. Man darf den Begriff ja nicht sagen: Staatskunst. Da ist der Expressionismus durchgesetzt, er ist die Avantgarde der zwanziger Jahre neben Bauhaus und anderen Strömungen, er ist Gesetz. Aber dann kommt der Nazismus, der Nationalsozialismus dort hinein, die Aktion "Entartete Kunst" 1937, wo die Museen leer geräumt werden, die privaten Sammler, viele von denen vertrieben werden, ermordet werden, die Bilder verschwinden. Eine absolute Aussichtslosigkeit."
Die Brücke-Expressionisten sind nicht nur das kunsthistorische Phänomen, auf das sich die moderne deutsche Kunst national und international fokussieren lässt; auf das auch nachfolgende Malergenerationen - nicht nur die so genannten "Jungen Wilden" - sich ausdrücklich beziehen.
Die "Alten Wilden", diese Gruppe junger Männer nach 1905 - mit ihrem Anspruch an Kunst und Leben, ihren Dramen und Erfolgen - sind ein Stück exemplarischer deutscher Kulturgeschichte voller Brisanz, das es - sicher gleichgewichtig neben Goethe, Schiller oder Thomas Mann - in und auch nach dieser Ausstellung weiter zu entdecken gilt.
Service: Ausstellung Neue Nationalgalerie 8. Juni bis 28. August
Brücke Museum: 4. Juni bis 11. September
Ab 1. Oktober bis 15. Januar 2006: Zu Gast in der Berlinischen Galerie: 200 Meisterwerke der Ausstellung des Museo Thyssen- Bornemisza Madrid, des Museu Nacional d’art de Catalunya Barcelona und des Brücke Museums Berlin.
Dass die Brücke-Maler zum Jubiläum in Mies van der Rohes Neuer Nationalgalerie in Berlin hängen, hat mehr als seine Richtigkeit - waren doch die Dresdener Gründungsmitglieder Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff ursprünglich Architekturstudenten und kaum älter als der Bauhaus-Meister selbst.
Schon von außen sind im gläsernen Foyer große Fotofahnen zu entdecken: Streng schaut der Kaiser auf die Partyszene der Brücke. Deren zentrales Credo lautete: Unmittelbar und unverfälscht die eigenen Gefühle wiederzugeben. Dazu auch Fotos und Exponate aus den damaligen Völkerkunde-Museen. Die Brücke-Maler, nicht nur die vier Gruppengründer, sondern auch die später Beigetretenen Otto Mueller, Max Pechstein und Emil Nolde, sahen das Deutsche Reich nicht als den Nabel der Welt, sondern entwickelten auch ein Auge für außereuropäische Kulturen.
Der Direktor des Kupferstichkabinetts, des größten Leihgebers dieser 500 Exponate versprechenden Ausstellung, Hein Theodor Schulze Altcappenberg, sieht die "Brücke" als eine heftige Variante des allgemeinen Aufbruchs in die europäische Moderne zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
" Sie ist ja nicht aus dem Nichts geboren worden. Die jungen Künstler haben sich damit auseinandergesetzt mit den Strömungen der Zeit, sie haben sich mit der Modernität auseinandergesetzt … aber es fokussiert in dem Thema Brücke und Berlin und zwar …von den Sammlungen her, dass die Kernsammlungen in Berlin, nämlich der Nationalgalerie, des Kupferstichkabinetts und des Brücke Museums mit den besten Sachen zusammengefasst sind, das sind wirklich weltweit zusammengenommen ist das schon der Kern, das ist das Panorama der Brücke. Berlin wird immer wieder besonders betont in den einzelnen Kapiteln, aber es ist insgesamt aufgeteilt nach elf Kapiteln, thematisch aufgeteilt nach Landschaften, nach Alltagsszenen, nach diesen, ich sag mal kunstgewerblichen, künstlerischen Entwurfsarbeiten, die da sind, nach Grafik, Poster, Plakatkunst der Brücke. Also das ganze Spektrum der Brücke wird abgedeckt. In elf Kapiteln wird das abgewickelt."
Das Gruppenbild der Künstlergemeinschaft entstand retrospektiv, vier Herren in Anzügen, denen das Revolutionäre nicht auf den ersten Blick anzusehen ist. Nur die Farbigkeit deutet darauf hin: Blau, Lila, Türkis und ein wenig Rosa. Die Farben haben die Brücke-Maler berühmt, später auch beliebt gemacht: Bilder, die jeden Betrachter aus dem grauen Alltag reißen.
Pechsteins "Sitzendes Mädchen" wird von leuchtend roten Bahnen umgeben, im Hintergrund wuchert sattes Grün. Das Modell ist auf selbstverständliche Weise nackt, dreht zwar den Körper weg, sieht dennoch dem Betrachter ins Gesicht, unprovokativ - eine Momentaufnahme, wie die so genannten "Viertelstunden-Akte", bei denen die Maler mit wenigen Strichen in kürzester Zeit den weiblichen Körper festhielten. Fränzi, die Zehnjährige taucht auf vielen dieser Zeichnungen auf - in Dresden das Lieblingsmodell der Maler: Kindfrau mit der unverkennbaren Haarschleife.
In der - die Nationalgalerie-Schau ergänzenden - 130 Exponate umfassenden Grafik-Ausstellung des Brücke Museums in Berlin-Dahlem lässt sich diese Sujet- und Stil-Entwicklung genau verfolgen: Wie sich aus Jugendstil, Symbolismus und Japonismus der unverkennbare Duktus entwickelte: klar konturiert, flächig, kantig. Und wie sich immer mehr der menschliche Körper, besonders der Frauenkörper motivisch durchsetzt - das zentrale und provokante Thema, wie die Leiterin des Brücke Museums, Magdalena Moeller, bestätigt:
" Das war auf jeden Fall provokativ, das war eine neue Freiheit mit dem menschlichen Körper umzugehen. Denn die akademische Kunst hat ja den Akt immer nur im Atelier dargestellt, während die Brücke-Künstler mit ihren Freundinnen aufs Land gezogen sind, an die Moritzburger Teiche oder sonst in die Umgebung von Dresden, und haben dort das Aktstudium in der freien Natur geübt.
Das Thema Akt ist eigentlich das Vordringliche der Brücke-Kunst. Das dominiert dann auch immer stärker, sowohl in der Dresdener Zeit wie denn auch natürlich in den Berliner Jahren. Stillleben tauchen ganz selten auf, aber Porträts gibt es häufige, vor allen Dingen auch gegenseitige Porträts, so genannte Freundschaftsbildnisse."
Sie haben einander gezeichnet, im wörtlichen, wie im übertragenen Sinne. Auf Holzschnitten, Lithografien und Skizzen tauchen die Köpfe der Freunde auf, die sonst leicht in der Gruppe verschwimmen, und die eigentlich erst in den Nach-Brücke Jahren - also nach 1913 - biographische Konturen gewinnen.
Herausragend: Ernst Ludwig Kirchner. 25.000 Zeichnungen hat er hinterlassen, Bleistiftstenogramme, teils farbig, von Freunden und Fremden, aus der Stadt und aus der Sommerfrische.
Die Pracht der nahen und fernen Paradiese ist auch Brücke-Thema: Von Otto Muellers Badeszenen bis zu Emil Noldes ethnologischen Studien. Später machen zwei mit dem Fernweh ernst: Nolde reist nach Deutsch-Neuguinea und Pechstein auf die Palau-Inseln.
Doch noch vorher - mit dem Umzug vom behäbigeren Dresden ins aggressive Berlin 1911 - gewinnt die Gruppe weiter an Prägnanz. Die großen Straßenbilder entstanden: Kirchners Potsdamer Platz, Belle Alliance-Platz, Friedrich Straße, Leipziger Straße: Frauensilhouetten in neonbeleuchteten Rosa-Lila-Blautönen mit fabelhaften Federhüten; neben Herren in dunklen Anzügen, die immer etwas Uniformiertes haben; Straßen wie Innenräume, Schattenseiten aller Natur - hier, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, eine gleißenden Härte.
" In dieser Gemengelage, in diesem brodelnden Kessel vor dem ersten Weltkrieg da sind diese Künstler groß geworden, zu ihrer ersten Reife gekommen. Sie genießen die Großstadt einerseits, sie werden abgestoßen von ihr andererseits. Sie machen alle ihre individuellen Erfahrungen. Es steht dann wirklich unmittelbar der Krieg bevor. Sie trennen sich 1913, offiziell wird sie aufgelöst. Sie haben natürlich weiterhin persönlichen Kontakt. Einzelne ziehen mit Euphorie in den Krieg, andere, wie Kirchner zum Beispiel sind nach wenigen Monaten psychisch Ruinen geworden. Sie machen sehr unterschiedliche persönliche Erfahrungen mit dieser Kriegssituation. Dann der Erfolg in den 20er Jahren. Absolut. Man darf den Begriff ja nicht sagen: Staatskunst. Da ist der Expressionismus durchgesetzt, er ist die Avantgarde der zwanziger Jahre neben Bauhaus und anderen Strömungen, er ist Gesetz. Aber dann kommt der Nazismus, der Nationalsozialismus dort hinein, die Aktion "Entartete Kunst" 1937, wo die Museen leer geräumt werden, die privaten Sammler, viele von denen vertrieben werden, ermordet werden, die Bilder verschwinden. Eine absolute Aussichtslosigkeit."
Die Brücke-Expressionisten sind nicht nur das kunsthistorische Phänomen, auf das sich die moderne deutsche Kunst national und international fokussieren lässt; auf das auch nachfolgende Malergenerationen - nicht nur die so genannten "Jungen Wilden" - sich ausdrücklich beziehen.
Die "Alten Wilden", diese Gruppe junger Männer nach 1905 - mit ihrem Anspruch an Kunst und Leben, ihren Dramen und Erfolgen - sind ein Stück exemplarischer deutscher Kulturgeschichte voller Brisanz, das es - sicher gleichgewichtig neben Goethe, Schiller oder Thomas Mann - in und auch nach dieser Ausstellung weiter zu entdecken gilt.
Service: Ausstellung Neue Nationalgalerie 8. Juni bis 28. August
Brücke Museum: 4. Juni bis 11. September
Ab 1. Oktober bis 15. Januar 2006: Zu Gast in der Berlinischen Galerie: 200 Meisterwerke der Ausstellung des Museo Thyssen- Bornemisza Madrid, des Museu Nacional d’art de Catalunya Barcelona und des Brücke Museums Berlin.