Geburtswehen beim Verhandlungsgespräch
Zwischen "männlich"-forschem Auftreten und "weiblicher" Zurückhaltung: Die anonyme Autorin A. berichtet in ihrem Buch "Ganz oben" vom Spagat, den Frauen in Führungspositionen vollziehen müssen. Eine aufschlussreiche Lektüre, wenn auch manche der Episoden etwas unglaubwürdig wirken.
"Ich bin 1,75 m groß, nicht wirklich schlank und habe kurz geschnittenes, dunkles Haar. Ich finde mich durchaus nicht hässlich, entspreche aber mit meinem Aussehen nicht den klassischen oder stereotypen Kategorien weiblicher Schönheit."
So porträtiert sich die Autorin selbst. Sie hat es geschafft, in einem deutschen Wirtschaftsunternehmen aufzusteigen und landete als Quereinsteigerin vor gut zehn Jahren ganz oben in der Hierarchie. Ihr "Startkapital," wie sie es nennt: eine auffallende Statur. Das mutet – gleich zu Beginn des Buches – befremdlich an. A. beschreibt sich als:
"(…) eine ernstzunehmende, weil körperlich sehr präsente Person. (…) Dadurch, dass ich eher groß und nicht zu schmal bin, vermittle ich allein optisch, dass ich mich durchsetzen kann."
Glaubt man der anonymen Autorin, haben besonders attraktive Frauen höchstens die Chance, mit Kusshand als Praktikantinnen angenommen zu werden, um die Stimmung der Männer aufzuhellen; die Chance, Karriere zu machen, hätten sie jedoch nicht. Ein Blick auf die internationale Liste einflussreicher Frauen in Unternehmen zeigt allerdings das Gegenteil. Sind Deutschlands führende Managerinnen im globalen Vergleich also nahezu geschlechtsneutrale Wesen? Zumindest vermittelt A. diesen Eindruck:
"Männer sehen in mir weniger die Frau, sondern den gleichwertigen Partner. Im Prinzip muss man als Frau ein Mann sein, um Karriere zu machen, doch darf man sich keinesfalls so verhalten wie ein Mann."
Wie ein Alphatier aufzutreten, kommt für A. nicht infrage. Ihre Rolle ist eher die der Schlichterin, einige in ihrem Unternehmen nennen sie "Mutter der Kompanie", denn sie ist Abteilungsleiterin für 50 Mitarbeiter; manche bezeichnen sie gar als "Mutter der Nation". Sie kümmert sich, interessiert sich ernsthaft für jeden Einzelnen, sorgt für einen guten Zusammenhalt in der Gruppe. Und mit eher leisen Tönen, so A., verhandle sie einfühlsam, und immer erfolgreich, zum Wohl des Unternehmens. Als Frau mit der Faust auf den Tisch zu hauen, das komme unter Kollegen gar nicht gut an.
So porträtiert sich die Autorin selbst. Sie hat es geschafft, in einem deutschen Wirtschaftsunternehmen aufzusteigen und landete als Quereinsteigerin vor gut zehn Jahren ganz oben in der Hierarchie. Ihr "Startkapital," wie sie es nennt: eine auffallende Statur. Das mutet – gleich zu Beginn des Buches – befremdlich an. A. beschreibt sich als:
"(…) eine ernstzunehmende, weil körperlich sehr präsente Person. (…) Dadurch, dass ich eher groß und nicht zu schmal bin, vermittle ich allein optisch, dass ich mich durchsetzen kann."
Glaubt man der anonymen Autorin, haben besonders attraktive Frauen höchstens die Chance, mit Kusshand als Praktikantinnen angenommen zu werden, um die Stimmung der Männer aufzuhellen; die Chance, Karriere zu machen, hätten sie jedoch nicht. Ein Blick auf die internationale Liste einflussreicher Frauen in Unternehmen zeigt allerdings das Gegenteil. Sind Deutschlands führende Managerinnen im globalen Vergleich also nahezu geschlechtsneutrale Wesen? Zumindest vermittelt A. diesen Eindruck:
"Männer sehen in mir weniger die Frau, sondern den gleichwertigen Partner. Im Prinzip muss man als Frau ein Mann sein, um Karriere zu machen, doch darf man sich keinesfalls so verhalten wie ein Mann."
Wie ein Alphatier aufzutreten, kommt für A. nicht infrage. Ihre Rolle ist eher die der Schlichterin, einige in ihrem Unternehmen nennen sie "Mutter der Kompanie", denn sie ist Abteilungsleiterin für 50 Mitarbeiter; manche bezeichnen sie gar als "Mutter der Nation". Sie kümmert sich, interessiert sich ernsthaft für jeden Einzelnen, sorgt für einen guten Zusammenhalt in der Gruppe. Und mit eher leisen Tönen, so A., verhandle sie einfühlsam, und immer erfolgreich, zum Wohl des Unternehmens. Als Frau mit der Faust auf den Tisch zu hauen, das komme unter Kollegen gar nicht gut an.
Herrisches Auftreten als Zeichen sexueller Frustration
"Damen mit einem herrischen Auftreten will man nicht. Was beim Mann noch als Ausdruck von natürlicher Autorität und damit als karrieredienlich interpretiert wird, gilt bei einer Frau als Zeichen sexueller Frustration. (...) Ich gelte ganz einfach als die nette und kompetente Karrierefrau ohne Risikofaktoren."
Ein hierarchisches Denken und Handeln ist A. im Grunde fremd, das macht sie durchaus sympathisch. Doch stoßen ihr – rein menschlich gesehen – vorbildlicher Führungsstil, ihre insgesamt kollegiale Art, bei jenen auf Ablehnung, die sich durch eine Chefin irritiert fühlen: Der Chauffeur beispielsweise bezweifelt, dass ihr der Fahrdienst zusteht; die Sekretärin begegne ihr nicht so, wie sie einem männlichen Abteilungsleiter begegnen würde.
"Ich vermeide also die Auseinandersetzung, habe Scheu vor der Diskussion, ich fordere nicht, was mir eigentlich zusteht (...) Kein Mann an meiner Stelle würde sich hier in Zurückhaltung üben. (...) Mein Problem ist, dass ich ungeheure Schwierigkeiten habe, diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen."
Angesichts mancher Alltagsschilderungen wirkt die Karrierefrau geradezu lebensfremd. Fast rührend klingen ihre selbstkritischen Analysen. Das eigene Verhalten hinterfragt und reflektiert sie vom Anfang bis zum Ende des Buches mit einer beinah naiven Offenheit.
Sie kümmert sich um ihre eigenen Mitarbeiter eben so wie um die Putzfrauen. Denen begegnet sie, weil sie bis spät in den Abend in ihrem Büro sitzt; denn von einer 40-Stunden-Woche kann natürlich in ihrer Position keine Rede sein. Als Alleinlebende hat sie aber auch keine Familie, die zu Hause auf sie wartet:
"Das Phänomen, ein Singleleben zu führen, ist charakteristisch für weibliche Führungskräfte in Deutschland. (...) Ihr Erfolg, der sich für potenzielle Partner meistens an der Höhe des Gehaltes bemisst, schreckt ab. Sehr viele Männer tun sich schwer damit, weniger zu verdienen als ihre Partnerin. (…) Ich frage mich immer wieder, ob das, was ich beruflich erreicht habe, es wert war angesichts dieser vielen Tage der Einsamkeit."
Ein hierarchisches Denken und Handeln ist A. im Grunde fremd, das macht sie durchaus sympathisch. Doch stoßen ihr – rein menschlich gesehen – vorbildlicher Führungsstil, ihre insgesamt kollegiale Art, bei jenen auf Ablehnung, die sich durch eine Chefin irritiert fühlen: Der Chauffeur beispielsweise bezweifelt, dass ihr der Fahrdienst zusteht; die Sekretärin begegne ihr nicht so, wie sie einem männlichen Abteilungsleiter begegnen würde.
"Ich vermeide also die Auseinandersetzung, habe Scheu vor der Diskussion, ich fordere nicht, was mir eigentlich zusteht (...) Kein Mann an meiner Stelle würde sich hier in Zurückhaltung üben. (...) Mein Problem ist, dass ich ungeheure Schwierigkeiten habe, diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen."
Angesichts mancher Alltagsschilderungen wirkt die Karrierefrau geradezu lebensfremd. Fast rührend klingen ihre selbstkritischen Analysen. Das eigene Verhalten hinterfragt und reflektiert sie vom Anfang bis zum Ende des Buches mit einer beinah naiven Offenheit.
Sie kümmert sich um ihre eigenen Mitarbeiter eben so wie um die Putzfrauen. Denen begegnet sie, weil sie bis spät in den Abend in ihrem Büro sitzt; denn von einer 40-Stunden-Woche kann natürlich in ihrer Position keine Rede sein. Als Alleinlebende hat sie aber auch keine Familie, die zu Hause auf sie wartet:
"Das Phänomen, ein Singleleben zu führen, ist charakteristisch für weibliche Führungskräfte in Deutschland. (...) Ihr Erfolg, der sich für potenzielle Partner meistens an der Höhe des Gehaltes bemisst, schreckt ab. Sehr viele Männer tun sich schwer damit, weniger zu verdienen als ihre Partnerin. (…) Ich frage mich immer wieder, ob das, was ich beruflich erreicht habe, es wert war angesichts dieser vielen Tage der Einsamkeit."
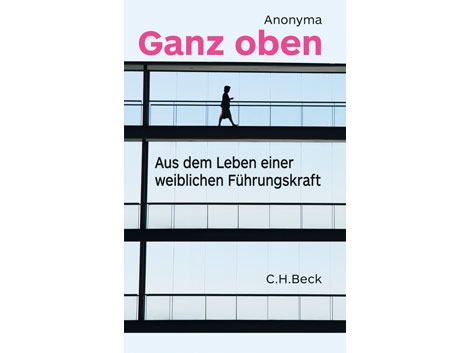
Cover: "Ganz oben. Aus dem Leben einer weiblichen Führungskraft"© C. H. Beck Verlag
Einsame Feierabende
Einsam fühlt sich A. nicht nur nach Feierabend – mit ihrem Freund in einer weit entfernten Stadt lebt sie eine Wochenendbeziehung -, Einsamkeit spürt sie auch auf Geschäftsreisen. Doch bleibt sie lieber mit einer Fast-Food-Portion im Hotel, als im Restaurant allein essen zu gehen:
"Allein im Restaurant zu speisen, verstärkt den Eindruck des Alleinseins noch, das will man nicht. (...) An diesen Abenden in fremden Hotels male ich mir die häusliche Idylle meiner Freunde in den weichsten Farben aus und empfinde mein Alleinsein in der Fremde um so trostloser. (...) Es käme mir seltsam anrüchig vor, als alleinreisende Frau das Gespräch mit einem alleinreisenden Mann zu suchen."
Auf Geschäftsreisen mit Kollegen fühlt sie sich ebenfalls isoliert. Denn Männer redeten – bevor sie das Rotlichtviertel aufsuchten – in der Regel nur über Politik, Fußball oder Autos. Themen, die A. kaum interessieren. So manche der Episoden aus dem Leben einer weiblichen Führungskraft wirkt nicht nur klischeehaft, sondern zudem unglaubwürdig: Wie kann es eine Frau in einem Unternehmen ganz nach oben geschafft haben ohne Interesse an Politik?
Mitten in einem für das Unternehmen ungeheuer wichtigen Verhandlungsgespräch spürt A. den Beginn einer Fehlgeburt. Von den Toilettenräumen kehrt sie eiligst zum offiziellen Gespräch zurück, um sich dann anhören zu müssen, dass ihr Verhandlungsgeschick schon einmal besser war. Unachtsamkeit sich selbst gegenüber. Typisch weiblich? Typisch Karrierefrau? Oder nur charakteristisch für die Autorin? Als sie schließlich doch noch ein Kind erwartet und Familienpläne hat, droht ihr der Verlust ihres Arbeitsplatzes. Vom Chef hört sie:
"Herzlichen Glückwunsch! Freuen Sie sich denn? Ihren jetzigen Job werden Sie nie wieder machen. – Das saß. Mir fehlten die Worte."
Nach allem, was die Autorin zuvor beschrieben hat, stellt sich die Leserin die Frage, ob sie ihren Job überhaupt wieder aufnehmen will. Am Ende des Buches heißt es jedoch:
"Ich wollte zeigen, dass eine Frau im Topmanagement mit Familie ihren Job weiterhin zur allgemeinen Zufriedenheit ausfüllen kann. Ich wollte die Tür für die Frauen in unserem Unternehmen wieder ein Stück weiter aufmachen, ein weiteres Mal vorausgehen auf dem Weg zur Gleichstellung in der Führungsetage."
"Allein im Restaurant zu speisen, verstärkt den Eindruck des Alleinseins noch, das will man nicht. (...) An diesen Abenden in fremden Hotels male ich mir die häusliche Idylle meiner Freunde in den weichsten Farben aus und empfinde mein Alleinsein in der Fremde um so trostloser. (...) Es käme mir seltsam anrüchig vor, als alleinreisende Frau das Gespräch mit einem alleinreisenden Mann zu suchen."
Auf Geschäftsreisen mit Kollegen fühlt sie sich ebenfalls isoliert. Denn Männer redeten – bevor sie das Rotlichtviertel aufsuchten – in der Regel nur über Politik, Fußball oder Autos. Themen, die A. kaum interessieren. So manche der Episoden aus dem Leben einer weiblichen Führungskraft wirkt nicht nur klischeehaft, sondern zudem unglaubwürdig: Wie kann es eine Frau in einem Unternehmen ganz nach oben geschafft haben ohne Interesse an Politik?
Mitten in einem für das Unternehmen ungeheuer wichtigen Verhandlungsgespräch spürt A. den Beginn einer Fehlgeburt. Von den Toilettenräumen kehrt sie eiligst zum offiziellen Gespräch zurück, um sich dann anhören zu müssen, dass ihr Verhandlungsgeschick schon einmal besser war. Unachtsamkeit sich selbst gegenüber. Typisch weiblich? Typisch Karrierefrau? Oder nur charakteristisch für die Autorin? Als sie schließlich doch noch ein Kind erwartet und Familienpläne hat, droht ihr der Verlust ihres Arbeitsplatzes. Vom Chef hört sie:
"Herzlichen Glückwunsch! Freuen Sie sich denn? Ihren jetzigen Job werden Sie nie wieder machen. – Das saß. Mir fehlten die Worte."
Nach allem, was die Autorin zuvor beschrieben hat, stellt sich die Leserin die Frage, ob sie ihren Job überhaupt wieder aufnehmen will. Am Ende des Buches heißt es jedoch:
"Ich wollte zeigen, dass eine Frau im Topmanagement mit Familie ihren Job weiterhin zur allgemeinen Zufriedenheit ausfüllen kann. Ich wollte die Tür für die Frauen in unserem Unternehmen wieder ein Stück weiter aufmachen, ein weiteres Mal vorausgehen auf dem Weg zur Gleichstellung in der Führungsetage."
Anonyma: Ganz oben. Aus dem Leben einer weiblichen Führungskraft
C. H. Beck Verlag, München 2013
160 Seiten, 14,95 Euro
C. H. Beck Verlag, München 2013
160 Seiten, 14,95 Euro
