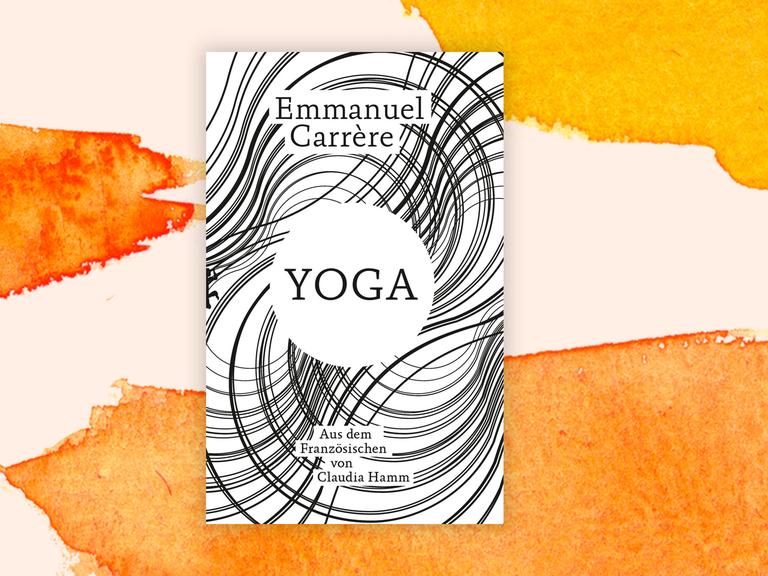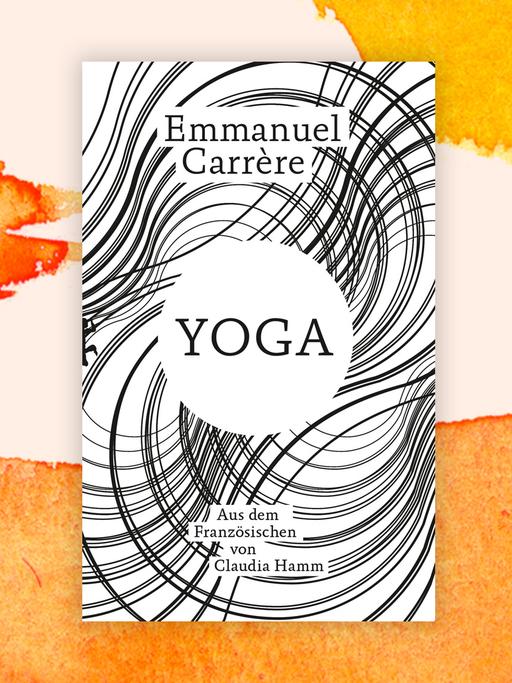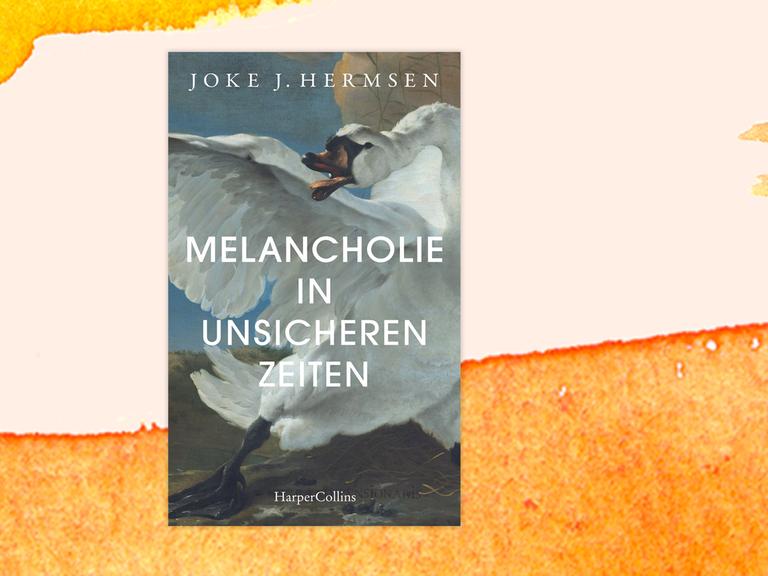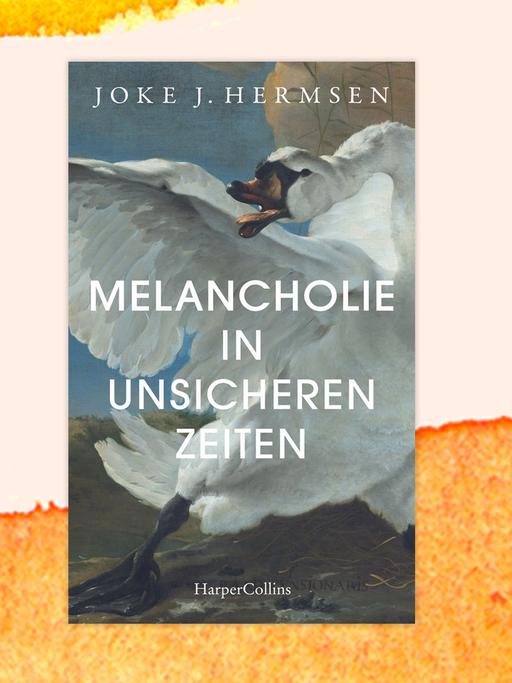Gerbrand Bakker: „Knecht, allein“
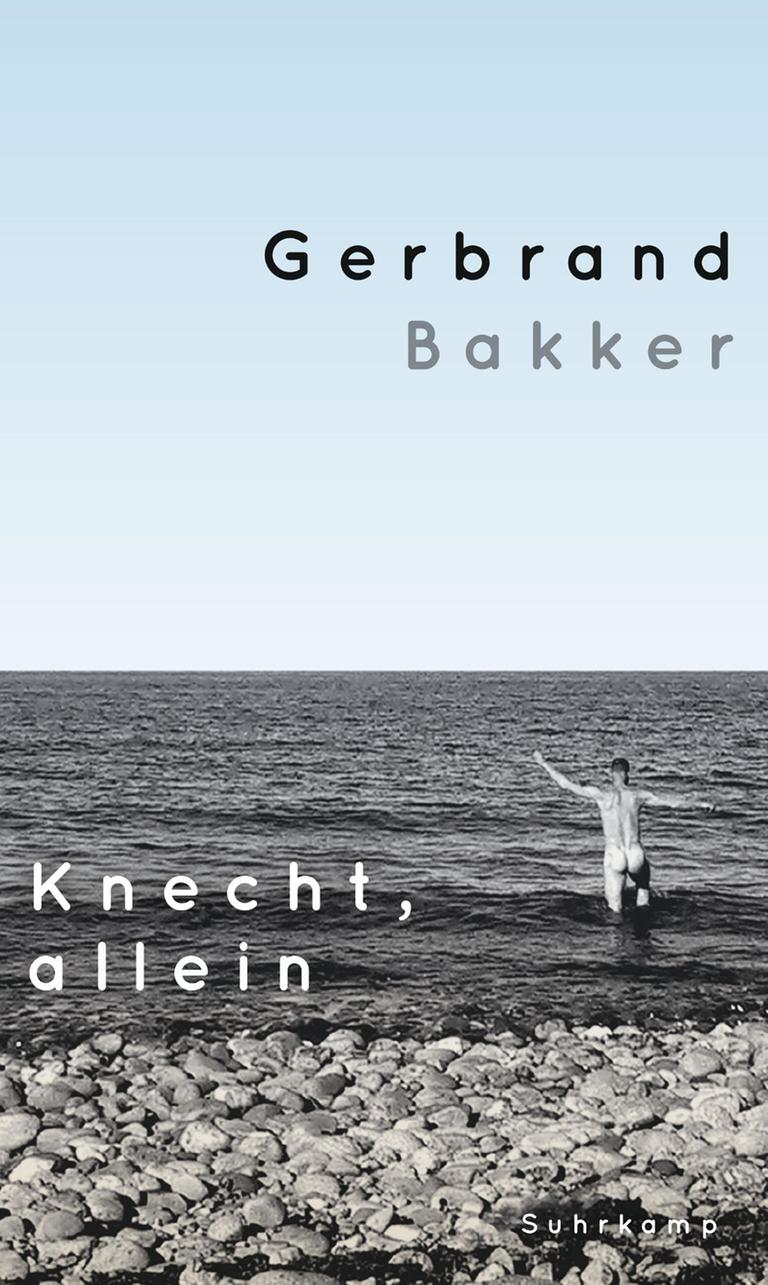
© Suhrkamp Verlag
Depression ist Niemandsland
05:50 Minuten
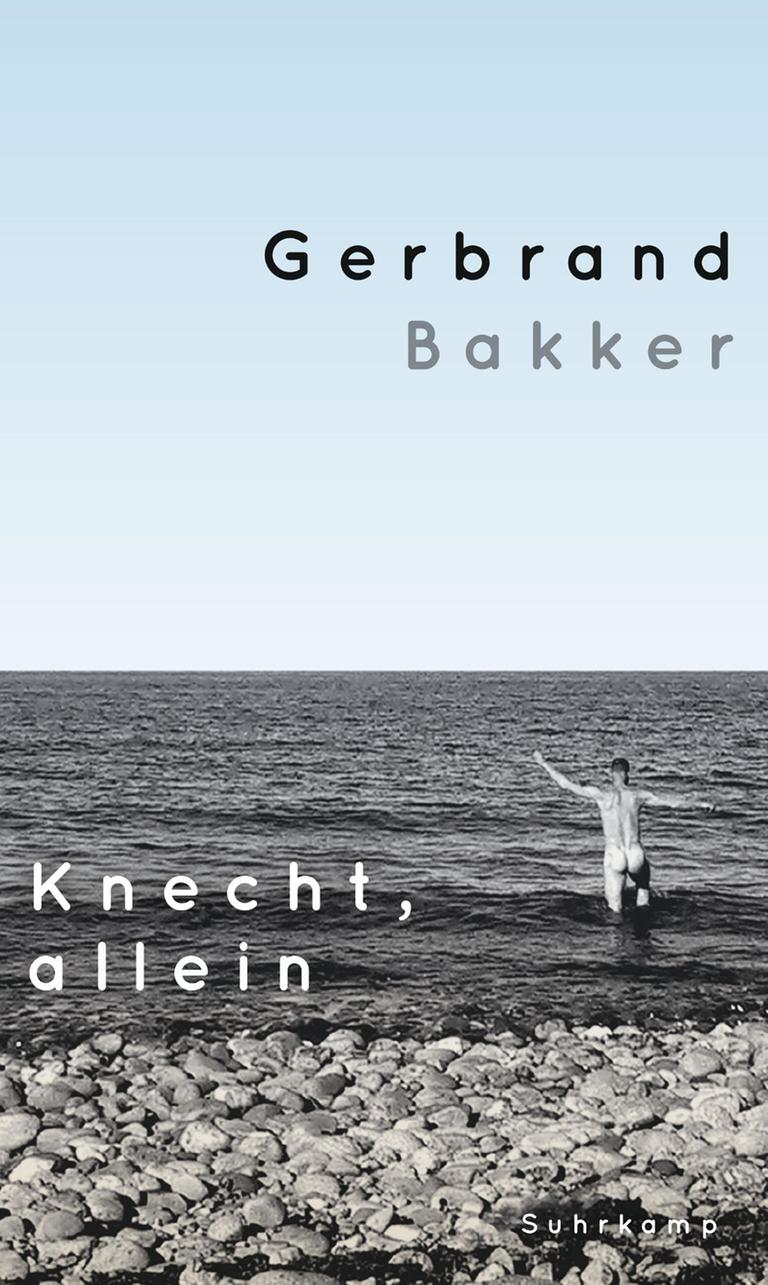
Gerbrand Bakker
aus dem Niederländischen von Andreas Ecke
Knecht, alleinSuhrkamp, Berlin 2022318 Seiten
24,00 Euro
Ein Tagebuch über die eigene Depression: Der niederländische Autor Gerbrand Bakker schreibt sich in nüchterner, treffender Sprache aus dem inneren Exil. Streckenweise vergisst er darüber sein Lesepublikum.
Schon in Bakkers früheren Büchern ging es um seine Depression, in „Jasper und sein Knecht“ beispielsweise. Jetzt ist der Hund Jasper tot, zurück bleibt Bakker. So erklärt sich der Titel des neuen Romans: „Knecht, allein“. Hier schreibt sich ein Autor aus seiner Depression heraus – und schreibt gegen die verzerrte Wahrnehmung der Krankheit an.
Karge, einnehmende Sprache
Der tagebuchartige Bericht ist weitestgehen chronologisch erzählt, entstanden in der tiefsten Depression, danach allerdings überarbeitet. Er schildert, wie Bakker Literaturveranstaltungen übersteht, Pausen in der Eifel oder eine Reise mit seinen Freunden einlegt sowie eine Darm-OP überlebt.
Das alles beschreibt Bakker ganz ohne Metaphern, in nüchterner, karger und doch einnehmender Sprache. Das Umfeld leugnet oder missversteht die Krankheit, bagatellisiert sie als „unerfreulich“; Showstars attestieren sich selbst aufmerksamkeitsheischend Depressionen – laut Bakker inhaltliche und sprachliche Verzerrungen.
Für ihn sei die Depression ein „Niemandsland“. Eine Entfremdung von sich selbst und allen anderen Menschen. Eine „Heimatlosigkeit“, vollkommene Einsamkeit, eine „Heimsuchung“.
Immer wieder Alltag
Gegenüber Klassikern oder Neuerscheinungen, die Depressionen literarisieren, wirkt das Buch ein wenig konturlos: Es bietet keine Comedy wie bei Kurt Krömers aktuellem Bestseller-Bekenntnis, keine Stringenz wie bei Matt Haigs unterhaltsamer Autobiografie „Ziemlich gute Gründe am Leben zu bleiben“ (2016) oder William Styrons stilbildendem Memoir „Sturz in die Nacht“ (1990).
Ein mit Studien und Ratschlägen angereichertes Sachbuch wie von Andrew Solomon („Saturns Schatten“, 2001) ist es ebenfalls nicht. An ein Publikum hat Bakker weniger gedacht, sich eher eine schreibende Selbstbehauptung gegen die Krankheit abgerungen.
Inhaltlich franst das Buch deshalb immer wieder in Alltäglichkeiten aus: Bakker schaut Hollywoodfilme, blättert in einem Hundebuch, werkelt im Garten, liefert viele Insider-Anekdoten aus dem niederländischen Literaturbetrieb. Er verliert sich in früheren Artikeln, Gedichten, Rezensionen, zitiert aber selbstironisch einen deutschen Rezensenten, der ihm in früheren Werken Laberei vorwarf.
Ermutigungen für Betroffene
Die Gründe für Bakkers Krankheit sind allenfalls angedeutet: Einsamkeit? Die Marginalisierung als Homosexueller? Akute Schübe werden im Buch durch neue oder abgesetzte Medikamente sowie durch stressige Mitmenschen ausgelöst. Eine traumatische Kindheit jedenfalls gibt es nicht zu vermelden.
Damit ähnelt das Buch so vielen Depressionsmemoirs: Es kokettiert mit dem „Seelenstriptease“, will oder kann die Komplett-Anamnese aber gar nicht liefern.
Trotz der Schwächen mag das Buch Betroffenen mit Ermutigungen helfen: Geduld haben, die Krankheit akzeptieren, auf den Kräftehaushalt und die Gesundheit achten und mit der Medikation vorsichtig sein. Die wichtige kognitive Verhaltenstherapie, Bakker selbst verschrieben, bleibt skizzenhaft – seltsam bei einem Spezialisten der Wörter; Achtsamkeitspraktiken scheinen aber in den Naturbeschreibungen auf.
Bakker selbst findet am Ende durch eine „love map“, einer Karte aller seiner Beziehungen, aus dem inneren Exil.