Das Material der tausend Dinge
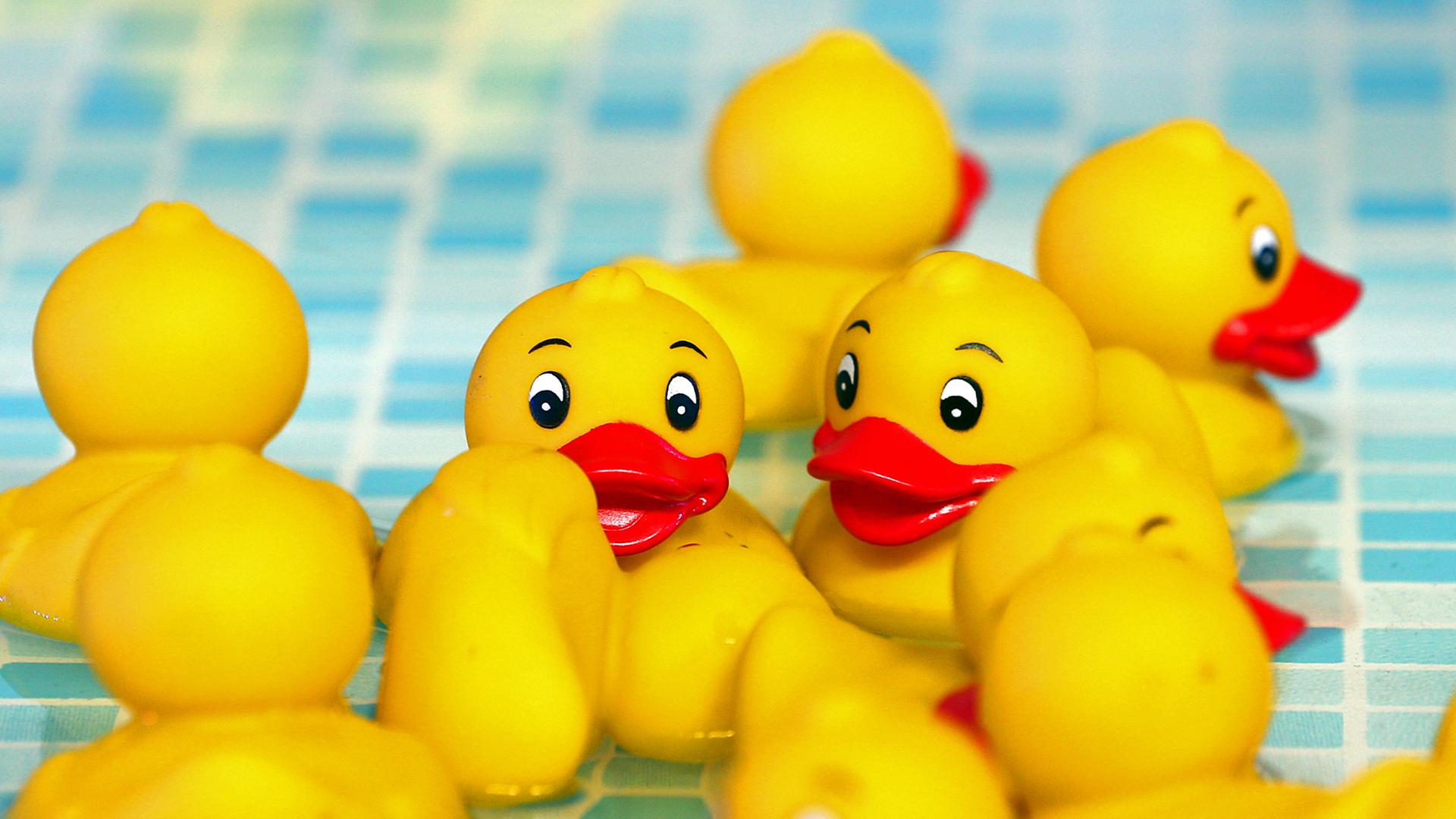
Früher galt Kunststoff als wertvoll: Wurde er doch aus natürlichen Rohstoffen wie dem Sekret tropischer Schildläuse gewonnen. Heute findet sich das Wundermaterial überall – im künstlichen Hüftgelenk oder Auto-Bauteil – und ist zur großen Umweltplage geworden.
Daniela Pufky-Heinrich: "Kunststoffe sind was ganz Tolles, die haben ja ganz tolle Eigenschaften, ja, und wir verwenden die ja überall."
Christin Neubert:" Ich denke an Müll, an Ozeanverschmutzung, an Tiere mit Plastik im Magen und an schädliches Plastik, an Zwitter-Schnecken und an solche Sachen."
Christin Neubert:" Ich denke an Müll, an Ozeanverschmutzung, an Tiere mit Plastik im Magen und an schädliches Plastik, an Zwitter-Schnecken und an solche Sachen."
Material, das der Mensch nach seiner Vorstellung formen kann
Kunststoffe sind überall. Und auch oft da, wo sie nicht hingehören. Manche enthalten giftige Zusatzstoffe. Sie helfen aber auch, Energie zu sparen. Sie retten Leben und dringen gleichzeitig in die Nahrungskette ein. 335 Millionen Tonnen Kunststoff werden auf der Welt jedes Jahr produziert, Tendenz steigend. Knapp ein Fünftel davon in Europa.
Allein in der EU arbeiten etwa 1,5 Millionen Menschen in der Kunststoffindustrie. Sind Kunststoffe das Problem oder sind Kunststoffe Teil der Lösung? Für Uta Scholten sind sie eher Letzteres. Sie ist die Kuratorin des Deutschen Kunststoffmuseums in Oberhausen.
"Der Mensch hatte immer gerne Materialien, die er nach seinen Vorstellungen formen kann, und da ist der Kunststoff natürlich der Traum."
"Der Mensch hatte immer gerne Materialien, die er nach seinen Vorstellungen formen kann, und da ist der Kunststoff natürlich der Traum."
Uta Scholten öffnet eine große Schublade, in der mehrere alte und sehr kunstvoll gestaltete Gegenstände liegen. Sie holt einen schwarzen Handspiegel heraus: das wahrscheinlich älteste Stück der Sammlung, wie sie sagt. Es stammt aus England und besteht aus Schellack - einem der ersten natürlichen Kunststoffe aus dem Sekret von tropischen Schildläusen.
"Diese Schildläuse suchen sich Gabelungen und da bauen die so kleine Köcher, die sind dann so dunkelbraun und da legen die ihre Eier rein."
Um die Eiergelege an den Zweigen zu schützen, sondern die Weibchen einen Saft ab. Diese Zweige mit dem sogenannten Brutlack wurden geerntet.
"Und ich weiß nicht, wie viele man da sammeln musste für eine Schallplatte, wahrscheinlich Tausende, vielleicht sogar Millionen, ich weiß es nicht."

Erste wertvolle Kunststoff-Erzeugnisse: die Schellack-Platten.© picture alliance / dpa / Peter Zimmermann
Vom Einzelstück zum massenhaft produzierten Imitat
Schmuck, Schatullen, Kästchen und die ersten Schallplatten wurden mit großem Aufwand aus Schellack hergestellt. Schwer liegt der kleine Spiegel in der Hand, auf der Rückseite ist er mit einer grazilen Frauenfigur verziert. Solche Gegenstände konnte sich nur die Oberschicht leisten.
"Das ist ja häufig auch das Problem bei diesen frühen Vorläufermaterialien, die stammten oft aus prekären Ökosystemen und daher war es eigentlich eine gute Sache, Ersatzstoffe zu finden, dass man eben nicht mehr in den tropischen Regenwald musste, um da Ressourcen abzusammeln."
Schon damals versuchte man deshalb, Abfallstoffe mit chemischen Mitteln in plastische Werkstoffe zu verwandeln. Uta Scholten zeigt ein weiteres Sammlungsstück.
"Das ist hier was ganz Besonderes, auch aus dem dritten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das ist das sogenannte 'Bois Durci', gehärtetes Holz. Wie der Name zeigt, es kommt aus Frankreich. Es wurde auch als 'Sang de Dragon' bezeichnet, also Drachenblut. Das ist ein bisschen euphemistisch, weil dieses Material aus Rinderblut bestand. Das war ein Abfallprodukt der Schlachthöfe in der Umgebung von Paris und man hat eben das zusammen mit Holzmehl, das in der Möbelindustrie anfiel, also zwei Abfallprodukte, hat man eben unter Hitze und Druck dieses Material hergestellt. Das heißt, das Eiweiß aus dem Rinderblut verband sich mit dem Harz - das funktioniert nur mit Tropenhölzern - aus dem Holzmehl und man hat dann eine sehr schöne feste Masse, die man dann unter Hitze und Druck in diese ausgearbeiteten Formen drücken konnte."
"Das ist ja häufig auch das Problem bei diesen frühen Vorläufermaterialien, die stammten oft aus prekären Ökosystemen und daher war es eigentlich eine gute Sache, Ersatzstoffe zu finden, dass man eben nicht mehr in den tropischen Regenwald musste, um da Ressourcen abzusammeln."
Schon damals versuchte man deshalb, Abfallstoffe mit chemischen Mitteln in plastische Werkstoffe zu verwandeln. Uta Scholten zeigt ein weiteres Sammlungsstück.
"Das ist hier was ganz Besonderes, auch aus dem dritten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das ist das sogenannte 'Bois Durci', gehärtetes Holz. Wie der Name zeigt, es kommt aus Frankreich. Es wurde auch als 'Sang de Dragon' bezeichnet, also Drachenblut. Das ist ein bisschen euphemistisch, weil dieses Material aus Rinderblut bestand. Das war ein Abfallprodukt der Schlachthöfe in der Umgebung von Paris und man hat eben das zusammen mit Holzmehl, das in der Möbelindustrie anfiel, also zwei Abfallprodukte, hat man eben unter Hitze und Druck dieses Material hergestellt. Das heißt, das Eiweiß aus dem Rinderblut verband sich mit dem Harz - das funktioniert nur mit Tropenhölzern - aus dem Holzmehl und man hat dann eine sehr schöne feste Masse, die man dann unter Hitze und Druck in diese ausgearbeiteten Formen drücken konnte."
Auch die biobasierten Casein-Kunststoffe und Zelluloid entstanden zu dieser Zeit. Letzteres wurde nicht nur für Filme genutzt. Weil es eine helle Farbe hat, konnte man Elfenbein und Horn nachahmen. Und Imitate massenhaft herstellen.
"Man wollte gerne ein Material, das man einfach, ohne große Mühe in jede gewünschte Form bringen konnte. Und ganz typisch, das sieht ja so aus als wäre das aus Ebenholz geschnitzt worden, also ein teures Tropenholz, aber hier eben in einem, ja, Mogelverfahren kann man fast sagen, nachgeahmt und wirkt eben auch sehr wertig."

Gegenstände aus Küche, Spielzimmer und Bad: Ausstellungsstücke im Deutschen Kunststoff-Museum. © Manuel Waltz
Kunststoff als Ersatz für andere Werkstoffe
Andere Materialien zu ersetzen, das ist ein Motiv, das sich durch die gesamte Entwicklung der Kunststoffe hindurchzieht. Waren es Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem sehr wertvolle Rohstoffe, so versucht man heute schwere Bauteile – vor allem solche aus Glas, Eisen und Stahl – durch leichte Hochleistungskunststoffe zu ersetzen. Vor allem im Automobilbau.
Jan Rudloff: "Kunststoffe sind ja nicht da zu einem Selbstzweck, sondern die Kunststoffe haben wir, weil sie uns das Leben leichter machen."
In Leuna, nahe Leipzig werden solche Kunststoffe produziert. Die BASF Niederlassung im Südosten von Sachsen-Anhalt versorgt Zulieferer der Automobilindustrie. Jan Rudloff leitet das Werk.
"Der Kunststoff ist sehr leicht und hilft damit, Kraftstoff zu sparen. Oder später dann eben Elektrizität zu sparen. Und es ist ein langer Weg vom ersten Kunststoff bis hin zu den Kunststoffen, die wir heute im Automobil haben, dass die alle diese Funktionen erfüllen, die sie erfüllen sollen."
Jan Rudloff: "Kunststoffe sind ja nicht da zu einem Selbstzweck, sondern die Kunststoffe haben wir, weil sie uns das Leben leichter machen."
In Leuna, nahe Leipzig werden solche Kunststoffe produziert. Die BASF Niederlassung im Südosten von Sachsen-Anhalt versorgt Zulieferer der Automobilindustrie. Jan Rudloff leitet das Werk.
"Der Kunststoff ist sehr leicht und hilft damit, Kraftstoff zu sparen. Oder später dann eben Elektrizität zu sparen. Und es ist ein langer Weg vom ersten Kunststoff bis hin zu den Kunststoffen, die wir heute im Automobil haben, dass die alle diese Funktionen erfüllen, die sie erfüllen sollen."
Kunststoff wird immer leistungsfähiger
Das Prinzip ist eigentlich einfach. In dem Werk in Leuna wird ein relativ eigenschaftsloser Grundstoff angeliefert, hier ist es ein Polyamid. Die Kunden von Rudloff bekommen dann aus diesem – wie es heißt – einen "maßgeschneiderten Kunststoff" zusammengestellt, der die gewünschten Eigenschaften hat. Und weil – was diese Eigenschaften angeht – mittlerweile fast nichts mehr unmöglich scheint, es kaum noch etwas gibt, das Kunststoffe nicht können, herrscht so etwas wie Goldgräberstimmung.
"Wir lernen, wie wir dem Kunststoff immer mehr beibringen können und die Eigenschaftsprofile haben wir gelernt, immer weiter zu erweitern."
"Wir lernen, wie wir dem Kunststoff immer mehr beibringen können und die Eigenschaftsprofile haben wir gelernt, immer weiter zu erweitern."
Es wird möglich, was noch vor Kurzem unmöglich erschien. Nicht nur beim Automobilbau. Künstliche Hüftgelenke mit Kunststoffanteil und resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial gehören zum medizinischen Alltag. Ärzte arbeiten jetzt daran, Gefäße vor komplizierten Operationen im 3D-Drucker auszudrucken und die OP daran zu simulieren.

Auch in der Medizin-Technik wird Kunststoff unverzichtbar: Fußprothesen aus Polyurethan© Emily Wabitsch / dpa/ lni
Dünne feuerfeste Dämmplatten für Häuser werden gerade entwickelt und leichte, haltbare Brücken im Straßenverkehr könnten bald aus Kunststoffen bestehen, genauso wie immer mehr Teile in den Autos, die darauf fahren. Sehr zur Freude von Jan Rudloff.
"Wir machen heute Teile im Automobil aus Kunststoff, da hätte man vor 20 Jahren noch nicht dran gedacht. So typische Sachen, ich sage mal wie eine Motoraufhängung. Da habe ich auch gedacht, so was muss aus Metall sein. Nein, sowas können wir aus Kunststoff machen."
"Wir machen heute Teile im Automobil aus Kunststoff, da hätte man vor 20 Jahren noch nicht dran gedacht. So typische Sachen, ich sage mal wie eine Motoraufhängung. Da habe ich auch gedacht, so was muss aus Metall sein. Nein, sowas können wir aus Kunststoff machen."
Leistungsfähige Computer sichern die Zukunft des Kunststoffs
Möglich wird das durch das sogenannte Compounding, indem man additive Zusatzstoffe beimischt. Glas- oder Karbonfasern für die Bruchfestigkeit etwa. Öle und Wachse dienen dazu, dass der flüssige Kunststoff beim Spritzguss besser in die Formen fließt und immer präzisere und kleinere Teile möglich macht. Zu wissen, welche Stoffe in welchen Mengen beigemischt werden müssen, um die entsprechenden Eigenschaften zu erhalten, das ist entscheidend. Und die Entwicklung dieses Wissens ist rasant. Das liegt auch daran, dass man mittlerweile anders forschen kann, als noch vor einigen Jahren. Leistungsfähige Computer sichern die Zukunft des Kunststoffs.
"Es gab so einen Paradigmenwechsel", erklärt Professor Bodo Fiedler. Er leitet an der Hochschule Hamburg Harburg das Institut für Kunststoffe.
"Früher hat man phänomenologisch gearbeitet. Da hat man dann geschmiedet und hat gesehen, aha, das funktioniert und das funktioniert nicht und dann hat man sich so weiter entwickelt. Und dann hat das so Zwischenstufen gegeben und heute könnte man im Prinzip Bottom-up auf Neudeutsch - also wirklich im Computer die einzelnen Bauelemente nehmen und ganz neue Werkstoffe kreieren."
Die Forscher geben die Bezeichnungen der Additive in das Programm ein und der Computer errechnet anschließend die Eigenschaften, gibt also genau an, wie bruchfest der neue Werkstoff ist oder wie glatt seine Oberfläche sein wird.
"Das wird eigentlich erst möglich durch die sehr leistungsfähigen Computer. Und dann gibt es auch internationale Programme, um wirklich so eine Datenbasis zu erarbeiten, wo man dann auch online an solche Informationen kommt und dann eben aus verschiedenen Bausteinen ganz neue Werkstoffe kreieren kann und die Werkstoffeigenschaften im Rechner prüft."
"Es gab so einen Paradigmenwechsel", erklärt Professor Bodo Fiedler. Er leitet an der Hochschule Hamburg Harburg das Institut für Kunststoffe.
"Früher hat man phänomenologisch gearbeitet. Da hat man dann geschmiedet und hat gesehen, aha, das funktioniert und das funktioniert nicht und dann hat man sich so weiter entwickelt. Und dann hat das so Zwischenstufen gegeben und heute könnte man im Prinzip Bottom-up auf Neudeutsch - also wirklich im Computer die einzelnen Bauelemente nehmen und ganz neue Werkstoffe kreieren."
Die Forscher geben die Bezeichnungen der Additive in das Programm ein und der Computer errechnet anschließend die Eigenschaften, gibt also genau an, wie bruchfest der neue Werkstoff ist oder wie glatt seine Oberfläche sein wird.
"Das wird eigentlich erst möglich durch die sehr leistungsfähigen Computer. Und dann gibt es auch internationale Programme, um wirklich so eine Datenbasis zu erarbeiten, wo man dann auch online an solche Informationen kommt und dann eben aus verschiedenen Bausteinen ganz neue Werkstoffe kreieren kann und die Werkstoffeigenschaften im Rechner prüft."
Neue Kunststoffrezepturen aus dem Computer
Neue Materialien wie intelligente Kunststoffe. Werkstoffe, die zum Beispiel ein Formgedächtnis haben oder eine integrierte Sensorik. Bodo Fiedler und seine Kollegen bauen leitende Nanopartikel in hauchdünne Folien, so können diese Folien via Funk Auskunft über ihren Zustand geben. Mittlerweile können sie solche Sensoren sogar drucken.
"Da kann man dann in verschiedenen Verfahren, Inkjet oder eben auch im Siebdruckverfahren, Sensor-Strukturen drucken, das ist auf Polymerbasis, der dann mit einem intelligenten Chip verknüpft ist und einer Antenne, die wird dann meistens aus Silber gedruckt, kann ich dann quasi autark, der hat keine Batterie oder einen Kondensator, sondern ich funke den an und der liefert mir die Informationen über Temperatur, Feuchte, Dehnungszustand zurück."
Große Holzkonstruktionen etwa müssen jährlich inspiziert werden. Diese haudünnen Kunststoffsensoren könnten an den wichtigen Stellen eingearbeitet werden und Kontrollen wesentlich vereinfachen. Möglich wird das, weil der Computer berechnen kann, wie sich die Materialien verhalten, wenn sie feucht werden oder sich dehnen.
"Die Schwierigkeit ist dabei zum Beispiel im Bereich der Polymere, dass es sehr viele Freiheitsgrade gibt, dass es kein geordnetes Kristall gibt, wie das im Metall ist, wo quasi alle Atome festsitzen. Sondern das ist im Prinzip wie so ein Teller Spaghetti, wo jede Spaghetti ein Kraftfeld wäre und die wollen sich irgendwie anordnen, dass sie möglichst wenig Energie gespeichert haben. Einen möglichst niedrigen Zustand annehmen. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen so einen Teller Spaghetti und würden das dann mit - ich sage jetzt mal - mit hundert Ketten, mit hundert Spaghetti im Computer simulieren wollen, dann rechnet der mehrere Tage."
Diese Simulationen werden auf Basis von Erfahrungen der Forscher programmiert. Auch beim Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen in Halle an der Saale arbeitet man daran. Hier berechnet man Eigenschaften von Kunststoffmischungen, baut sie anschließend im Labor nach und testet, wie gut die Berechnungen im Computer waren. Weichen sie von der Realität ab, justieren die Forscher nach. Professor Peter Michel ist genau dafür zuständig. Er sitzt in einem Besprechungsraum vor einer großen Leinwand und hat ein neues Programm mit seinem Computer aufgerufen, das Digilab.
Peter Michel: "Und man geht jetzt da so mit um, dass wir hier hergehen und sagen, wir haben eine Reihe von Eigenschaften in unserem Werkstoff. Ich habe die Steifigkeit und Festigkeit. Ich habe irgendwo eine Verpackung, die Glas schützen soll vielleicht, und muss dann die Kerbschlagzähigkeit entsprechend hoch setzen und ich will am Ende auch noch relativ leicht sein und nehme dann noch die Dichte da noch mit rein."
Peter Michel hat verschiede Kästchen angeklickt. Jedes dieser Kästchen steht für eine Eigenschaft, die der neue Kunststoff haben soll.
"Und wenn ich die Werte definiert habe, kann ich gewisse Räume setzen und kann relativ leicht hier sagen, das soll jetzt bis 18 Kilojoule pro Quadratmeter gehen und gehe dann in Suchen und kriege dann hier unten direkt angezeigt, welche Kunststoffe diese Eigenschaften erfüllen."
Am linken unteren Rand erscheinen nun mehrere verschiedene Kunststoffmischungen, die genau die von Peter Michel eingegebenen Eigenschaften erfüllen.
"Es ist aber nicht nur der Kunststoff, der diese Eigenschaften erfüllt, sondern ich habe hier sofort noch für den Experten die weitere Kenngröße, das Verfahren in dem dieses System hergestellt wird. Jetzt ist also derjenige, der dieses Compoundierverfahren betreibt, kriegt jetzt direkt auch noch angezeigt, welche Rohstoffe, welche Additive er jetzt dosieren muss, um diese Eigenschaften der angezeigten Werkstoffe hinzubekommen. Das heißt also, der braucht dann nur noch in seine Bestellliste gehen, holt die fünf oder sechs Rohstoffe und stellt seine Maschine ein, so wie wir ihm das vorher berechnet haben und kann dann also loslegen."
Fraunhofer arbeitet hierbei mit verschiedenen Firmen zusammen, entwickelt Verfahren, Prozesse und fertige Werkstoffe. Auch bei der BASF arbeitet man mit solchen Computerprogrammen, um dann – wie in Leuna – die berechneten Mischungen zu realisieren.
"Da kann man dann in verschiedenen Verfahren, Inkjet oder eben auch im Siebdruckverfahren, Sensor-Strukturen drucken, das ist auf Polymerbasis, der dann mit einem intelligenten Chip verknüpft ist und einer Antenne, die wird dann meistens aus Silber gedruckt, kann ich dann quasi autark, der hat keine Batterie oder einen Kondensator, sondern ich funke den an und der liefert mir die Informationen über Temperatur, Feuchte, Dehnungszustand zurück."
Große Holzkonstruktionen etwa müssen jährlich inspiziert werden. Diese haudünnen Kunststoffsensoren könnten an den wichtigen Stellen eingearbeitet werden und Kontrollen wesentlich vereinfachen. Möglich wird das, weil der Computer berechnen kann, wie sich die Materialien verhalten, wenn sie feucht werden oder sich dehnen.
"Die Schwierigkeit ist dabei zum Beispiel im Bereich der Polymere, dass es sehr viele Freiheitsgrade gibt, dass es kein geordnetes Kristall gibt, wie das im Metall ist, wo quasi alle Atome festsitzen. Sondern das ist im Prinzip wie so ein Teller Spaghetti, wo jede Spaghetti ein Kraftfeld wäre und die wollen sich irgendwie anordnen, dass sie möglichst wenig Energie gespeichert haben. Einen möglichst niedrigen Zustand annehmen. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen so einen Teller Spaghetti und würden das dann mit - ich sage jetzt mal - mit hundert Ketten, mit hundert Spaghetti im Computer simulieren wollen, dann rechnet der mehrere Tage."
Diese Simulationen werden auf Basis von Erfahrungen der Forscher programmiert. Auch beim Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen in Halle an der Saale arbeitet man daran. Hier berechnet man Eigenschaften von Kunststoffmischungen, baut sie anschließend im Labor nach und testet, wie gut die Berechnungen im Computer waren. Weichen sie von der Realität ab, justieren die Forscher nach. Professor Peter Michel ist genau dafür zuständig. Er sitzt in einem Besprechungsraum vor einer großen Leinwand und hat ein neues Programm mit seinem Computer aufgerufen, das Digilab.
Peter Michel: "Und man geht jetzt da so mit um, dass wir hier hergehen und sagen, wir haben eine Reihe von Eigenschaften in unserem Werkstoff. Ich habe die Steifigkeit und Festigkeit. Ich habe irgendwo eine Verpackung, die Glas schützen soll vielleicht, und muss dann die Kerbschlagzähigkeit entsprechend hoch setzen und ich will am Ende auch noch relativ leicht sein und nehme dann noch die Dichte da noch mit rein."
Peter Michel hat verschiede Kästchen angeklickt. Jedes dieser Kästchen steht für eine Eigenschaft, die der neue Kunststoff haben soll.
"Und wenn ich die Werte definiert habe, kann ich gewisse Räume setzen und kann relativ leicht hier sagen, das soll jetzt bis 18 Kilojoule pro Quadratmeter gehen und gehe dann in Suchen und kriege dann hier unten direkt angezeigt, welche Kunststoffe diese Eigenschaften erfüllen."
Am linken unteren Rand erscheinen nun mehrere verschiedene Kunststoffmischungen, die genau die von Peter Michel eingegebenen Eigenschaften erfüllen.
"Es ist aber nicht nur der Kunststoff, der diese Eigenschaften erfüllt, sondern ich habe hier sofort noch für den Experten die weitere Kenngröße, das Verfahren in dem dieses System hergestellt wird. Jetzt ist also derjenige, der dieses Compoundierverfahren betreibt, kriegt jetzt direkt auch noch angezeigt, welche Rohstoffe, welche Additive er jetzt dosieren muss, um diese Eigenschaften der angezeigten Werkstoffe hinzubekommen. Das heißt also, der braucht dann nur noch in seine Bestellliste gehen, holt die fünf oder sechs Rohstoffe und stellt seine Maschine ein, so wie wir ihm das vorher berechnet haben und kann dann also loslegen."
Fraunhofer arbeitet hierbei mit verschiedenen Firmen zusammen, entwickelt Verfahren, Prozesse und fertige Werkstoffe. Auch bei der BASF arbeitet man mit solchen Computerprogrammen, um dann – wie in Leuna – die berechneten Mischungen zu realisieren.
Wertschöpfung durch Know-how
Jan Rudloff ist inzwischen zur Werkhalle in den ersten Stock gegangen, wo die sogenannten Extruder stehen, in denen der Kunststoff mit den Zusatzstoffen vermischt wird.
"Hier führen wir normalerweise keine Besucher hin, aber ich zeige es trotzdem mal. Das sind diese Spindeln, die immer im Paar in diesen Extrudern laufen."
In einem Regal aus Metall liegen mehrere massive Spindeln, jede mehrere Meter lang. Sie sehen ein wenig aus wie die Spindeln in einem Fleischwolf.
"Und Sie sehen, das ist nicht einfach nur eine Schnecke, hier haben wir Schnecken mit verschiedenen Steigungen. Daran sieht man, hier wird eingezogen, hier wird die Steigung etwas enger, hier wird verdichtet, hier wird aufgeschmolzen, hier muss ich dafür sorgen, dass die Kunststoffschmelze nicht zurückströmt."
Die Spindeln laufen durch die ebenfalls mehrere Meter langen Extruder und kneten das flüssige Plastik durch die Maschine. Der Grundstoff wird mit mehreren Additiven von oben durch große Zylinder in die Maschine gegeben. Durch dieses Verflüssigen, Mischen und Kneten wird aus relativ eigenschaftslosem Polyamid ein Hochleistungskunststoff für Spezialanwendungen.
"Und dieses Know-how, wie so eine Schnecke aussieht, wie die generiert ist, bei welcher Temperatur die gefahren wird, bei welchem Durchsatz die gefahren wird, das ist das, was wir über viele Jahre entwickelt haben und das ist das, womit wir unsere Wertschöpfung betreiben."
Am Ende kommen aus der Maschine wie bei einem Fleischwolf lange Kunststoffschnüre heraus, die abgekühlt und in kleine Stücke zerhackt werden. Dieses Granulat geht dann an die Firmen, die daraus im Spritzgussverfahren die entsprechenden Teile herstellen. Jan Rudloff ist ans Fenster der Halle gelaufen. Von hier hat man einen guten Blick über den riesigen Chemiepark in Leuna. Gut 100 Jahre ist der alt. Auf der linken Seite schaut er auf einen großen mit Bäumen bewachsenen Hügel – die ehemalige Halde. Hier wurden die Reste der Kohle aufgeschüttet.
"Hier führen wir normalerweise keine Besucher hin, aber ich zeige es trotzdem mal. Das sind diese Spindeln, die immer im Paar in diesen Extrudern laufen."
In einem Regal aus Metall liegen mehrere massive Spindeln, jede mehrere Meter lang. Sie sehen ein wenig aus wie die Spindeln in einem Fleischwolf.
"Und Sie sehen, das ist nicht einfach nur eine Schnecke, hier haben wir Schnecken mit verschiedenen Steigungen. Daran sieht man, hier wird eingezogen, hier wird die Steigung etwas enger, hier wird verdichtet, hier wird aufgeschmolzen, hier muss ich dafür sorgen, dass die Kunststoffschmelze nicht zurückströmt."
Die Spindeln laufen durch die ebenfalls mehrere Meter langen Extruder und kneten das flüssige Plastik durch die Maschine. Der Grundstoff wird mit mehreren Additiven von oben durch große Zylinder in die Maschine gegeben. Durch dieses Verflüssigen, Mischen und Kneten wird aus relativ eigenschaftslosem Polyamid ein Hochleistungskunststoff für Spezialanwendungen.
"Und dieses Know-how, wie so eine Schnecke aussieht, wie die generiert ist, bei welcher Temperatur die gefahren wird, bei welchem Durchsatz die gefahren wird, das ist das, was wir über viele Jahre entwickelt haben und das ist das, womit wir unsere Wertschöpfung betreiben."
Am Ende kommen aus der Maschine wie bei einem Fleischwolf lange Kunststoffschnüre heraus, die abgekühlt und in kleine Stücke zerhackt werden. Dieses Granulat geht dann an die Firmen, die daraus im Spritzgussverfahren die entsprechenden Teile herstellen. Jan Rudloff ist ans Fenster der Halle gelaufen. Von hier hat man einen guten Blick über den riesigen Chemiepark in Leuna. Gut 100 Jahre ist der alt. Auf der linken Seite schaut er auf einen großen mit Bäumen bewachsenen Hügel – die ehemalige Halde. Hier wurden die Reste der Kohle aufgeschüttet.
Vollsynthetischer Kunststoff für die Zukunftstechnologien
"Ursprünglich wurde die gesamte Chemie, die wir in Deutschland betreiben, auf Kohlebasis gemacht. Klassisch sowieso, weil ursprünglich wurde Kohle zum Heizen eingesetzt, um Kokerei-Gas herzustellen. Und dann eben als Nebenprodukte diese ganzen Dinge wie Phenole und so weiter zu erzeugen, das war mal so der Ausgangspunkt."
Der erste vollsynthetische Kunststoff, das Bakelit, bestand zum Großteil aus Phenol, einem Abfallprodukt der Koksherstellung. 1905 hatte der belgischen Chemiker Leo Hendrik Baekeland entdeckt, dass sich aus Phenol und Formaldehyd ein plastischer Stoff herstellen ließ, der aushärtete. Es wurde nach ihm Bakelit genannt.
"Und dann kam mehr und mehr das Öl ins Geschäft, weil das Öl gewisse Vorteile liefert."
Ab den 1950er-Jahren wurde nach und nach auf das nun auf dem Weltmarkt in immer größeren Mengen verfügbare Erdöl umgestellt.
"Ja, das Öl ist flüssig und Öl kann ich mit deutlich weniger Ressourcen deutlich schonender in Kunststoffe oder überhaupt in ein Wertprodukt verwandeln. Das ist ein viel, viel sauberer Prozess. Also die Sachen auf Kohlebasis, ich bin ja auch noch nicht so alt, ich kenne das eben von den Bilanzen und wie die Verfahren funktioniert haben, das lernt man ja noch im Studium, also das ist wirklich eine Sache wo ich sage, Junge, Junge, das war wirklich eine ganz schöne Sauerei."
Dennoch waren die damals neuen plastischen Kunststoffe, allen voran Bakelit, ein Erfolg und es entwickelten sich neue Industrien. Denn die nun produzierten Stoffe hatten besondere Eigenschaften. Jetzt begann man auch, nicht mehr nur wertvolle und seltene Rohstoffe zu ersetzen, sondern viele neue Produkte zu entwickeln.
Uta Scholten: "Bakelit hatte den großen Vorteil, es war preiswert und es leitete den elektrischen Strom nicht. Das heißt, es war ein hervorragendes Isolationsmaterial."
Uta Scholten ist im Kunststoffmuseum mittlerweile zu den Bakelit-Exponaten gekommen. Vor ihr im Regal liegen verschiedene Stecker und Schalter aus den 1920er- und 30er-Jahren. Alle sind schwarz.
"Und man muss sehen, 1909, 1910, die Elektroindustrie kam gerade auf, die Telekommunikation kam gerade auf, das heißt, es waren zwei Zukunftstechnologien, die sich da auch getroffen haben. Und es wurden halt dann relativ schnell Schalter, Stecker, Radiogehäuse, Telefone wurden eben aus diesem Bakelit hergestellt. Und es hatte den Vorteil, es isoliert nicht nur sehr gut, natürlich für ein Radiogehäuse kann man auch Holz nehmen, aber es ist halt relativ leicht und kann eben in einer Form gepresst werden. Das heißt, ich kann in einem Arbeitsgang ein Radiogehäuse herstellen und dann baue ich noch das Technische innen rein und habe dann schon ein Radio."
Uta Scholten hat ein altes Telefon von Siemens und Halske aus dem Regal genommen, den Tischapparat Modell 36. Es stammt aus den 1930er-Jahren und ist ein Design-Klassiker. Das gesamte Gehäuse ist aus Bakelit gefertigt. Nur die Wählscheibe ist aus schwarz lackiertem Metall. Bakelit ist dunkel- bis rotbraun. Alle Teile aus diesem Material sind deshalb entweder braun oder schwarz. Helle Farben sind nicht möglich. Auf einer geschwungenen Gabel liegt der Hörer des Telefons, ebenfalls aus Bakelit.
"Es ist sehr vielseitig eingesetzt worden. Es gab dann auch einen Werbeslogan: Das Material der tausend Möglichkeiten. Aber es gibt eine Anwendung für die es überhaupt nicht geeignet ist und das sind Lebensmittel."
Uta Scholten hat das Telefon wieder zurückgestellt und nimmt eine alte dunkelbraune Dose aus dem Regal.
"Und das kann ich Ihnen mal demonstrieren: Jetzt bräuchte man Geruchsradio. Das ist also eine alte Munitionsdose aus dem Weltkrieg aus Bakelit und die habe ich immer deswegen... Ja, das ist ein ganz charakteristischer stechender Geruch und wenn man sich vorstellt, dass man darin Lebensmittel aufbewahrt oder isst, das geht also auch auf die Lebensmittel über, das heißt, für Lebensmittel ist es also nicht geeignet."
Der erste vollsynthetische Kunststoff, das Bakelit, bestand zum Großteil aus Phenol, einem Abfallprodukt der Koksherstellung. 1905 hatte der belgischen Chemiker Leo Hendrik Baekeland entdeckt, dass sich aus Phenol und Formaldehyd ein plastischer Stoff herstellen ließ, der aushärtete. Es wurde nach ihm Bakelit genannt.
"Und dann kam mehr und mehr das Öl ins Geschäft, weil das Öl gewisse Vorteile liefert."
Ab den 1950er-Jahren wurde nach und nach auf das nun auf dem Weltmarkt in immer größeren Mengen verfügbare Erdöl umgestellt.
"Ja, das Öl ist flüssig und Öl kann ich mit deutlich weniger Ressourcen deutlich schonender in Kunststoffe oder überhaupt in ein Wertprodukt verwandeln. Das ist ein viel, viel sauberer Prozess. Also die Sachen auf Kohlebasis, ich bin ja auch noch nicht so alt, ich kenne das eben von den Bilanzen und wie die Verfahren funktioniert haben, das lernt man ja noch im Studium, also das ist wirklich eine Sache wo ich sage, Junge, Junge, das war wirklich eine ganz schöne Sauerei."
Dennoch waren die damals neuen plastischen Kunststoffe, allen voran Bakelit, ein Erfolg und es entwickelten sich neue Industrien. Denn die nun produzierten Stoffe hatten besondere Eigenschaften. Jetzt begann man auch, nicht mehr nur wertvolle und seltene Rohstoffe zu ersetzen, sondern viele neue Produkte zu entwickeln.
Uta Scholten: "Bakelit hatte den großen Vorteil, es war preiswert und es leitete den elektrischen Strom nicht. Das heißt, es war ein hervorragendes Isolationsmaterial."
Uta Scholten ist im Kunststoffmuseum mittlerweile zu den Bakelit-Exponaten gekommen. Vor ihr im Regal liegen verschiedene Stecker und Schalter aus den 1920er- und 30er-Jahren. Alle sind schwarz.
"Und man muss sehen, 1909, 1910, die Elektroindustrie kam gerade auf, die Telekommunikation kam gerade auf, das heißt, es waren zwei Zukunftstechnologien, die sich da auch getroffen haben. Und es wurden halt dann relativ schnell Schalter, Stecker, Radiogehäuse, Telefone wurden eben aus diesem Bakelit hergestellt. Und es hatte den Vorteil, es isoliert nicht nur sehr gut, natürlich für ein Radiogehäuse kann man auch Holz nehmen, aber es ist halt relativ leicht und kann eben in einer Form gepresst werden. Das heißt, ich kann in einem Arbeitsgang ein Radiogehäuse herstellen und dann baue ich noch das Technische innen rein und habe dann schon ein Radio."
Uta Scholten hat ein altes Telefon von Siemens und Halske aus dem Regal genommen, den Tischapparat Modell 36. Es stammt aus den 1930er-Jahren und ist ein Design-Klassiker. Das gesamte Gehäuse ist aus Bakelit gefertigt. Nur die Wählscheibe ist aus schwarz lackiertem Metall. Bakelit ist dunkel- bis rotbraun. Alle Teile aus diesem Material sind deshalb entweder braun oder schwarz. Helle Farben sind nicht möglich. Auf einer geschwungenen Gabel liegt der Hörer des Telefons, ebenfalls aus Bakelit.
"Es ist sehr vielseitig eingesetzt worden. Es gab dann auch einen Werbeslogan: Das Material der tausend Möglichkeiten. Aber es gibt eine Anwendung für die es überhaupt nicht geeignet ist und das sind Lebensmittel."
Uta Scholten hat das Telefon wieder zurückgestellt und nimmt eine alte dunkelbraune Dose aus dem Regal.
"Und das kann ich Ihnen mal demonstrieren: Jetzt bräuchte man Geruchsradio. Das ist also eine alte Munitionsdose aus dem Weltkrieg aus Bakelit und die habe ich immer deswegen... Ja, das ist ein ganz charakteristischer stechender Geruch und wenn man sich vorstellt, dass man darin Lebensmittel aufbewahrt oder isst, das geht also auch auf die Lebensmittel über, das heißt, für Lebensmittel ist es also nicht geeignet."
Bakelit ist ein sogenanntes Duroplast. Es wird nicht weich, wenn es erhitzt wird. Wenn es trocknet bildet sich eine kristalline Struktur, deshalb ist es hart und nicht verformbar. Anders die thermoplastischen Kunststoffe wie die bekannten PVC – Polyvinylchlorid oder PE – Polyethylen. Diese Kunststoffe werden weich und flüssig, wenn sie erhitzt werden. Und sie können durch Zusätze auch weich gehalten werden, durch die sogenannten Weichmacher.
"Das ist also hier ganz aktuell, sind Designerschuhe von einer brasilianischen Firma und die stellen also Schuhe aus PVC her, also diese Schuhe kosten 150 Euro. Also das ist wirklich Designer-Ware, aber eigentlich vom Material her sind die eben... Plastik. Man zahlt eben den Namen des Designers dafür und so was wirklich vom Tragekomfort so toll ist so ein Schuh aus so einer Plastikfolie und was hier auch ganz interessant ist. Die riechen ja auch so ein bisschen blumig, kaugummimäßig, das ist halt... Diese Marke wirbt auch damit, dass diese Schuhe parfümiert sind und das hat eigentlich wirklich nur den banalen Grund: PVC-Weichmacher riecht ein bisschen chemisch unangenehm und wenn man den so stark parfümiert, ist eben dieser Weichmacher-Geruch schön überdeckt."

Das Telefon aus Bakelit: Der neue Kunststoff eröffnete neue Möglichkeiten für damalige Zukunftstechnologien. © imago/Westend61
Ungelöste Probleme des Kunststoffs
Weichmacher, auch das sind Additive, die dem Kunststoff beigemischt werden. Sie sind auch in Plastikverpackungen enthalten. Manche von ihnen können wirken wie Hormone im Körper. Besonders bekannt ist Bisphenol A, das in manchen Einweg-Plastikflaschen enthalten ist. Bei vielen anderen Zusatzstoffen weiß man nicht einmal, wie sie im Körper wirken.
Uta Scholten: "Der Kunststoff an sich ist nicht böse, sondern wie wir damit umgehen, ist das Problem."
Zu den größten Problemen gehört der Müll. Hochleistungskunststoffe, die Autos und Flugzeuge leichter machen, Dämmmaterialen für den Bau, die Heizkosten senken, das ist nur ein kleiner Teil der weltweiten Produktion. 40 Prozent des Plastiks wird zu Verpackungen, hinzukommen viele Produkte mit einer sehr kurzen Nutzungsdauer. Danach sind sie Abfall. Dann ist Kunststoff keine Lösung mehr sondern ein Problem, wie Robert Habeck, der Parteivorsitzende der Grünen beklagt.
"Wir müssen uns jetzt fragen als Menschheit, wenn ich so pathetisch reden darf, ob wir für die kurzfristigste Verwendung, und darum geht es ja, von den Wattestäbchen, mit denen ich mir die Ohren sauber mache bis zum Aufreißen von einer Folie, in der eine Gurke eingeschweißt ist, ob wir für die kurzfristigste, einmalige Verwendung das langlebigste Produkt nehmen und die Antwort kann eigentlich nur Nein sein."
Uta Scholten: "Der Kunststoff an sich ist nicht böse, sondern wie wir damit umgehen, ist das Problem."
Zu den größten Problemen gehört der Müll. Hochleistungskunststoffe, die Autos und Flugzeuge leichter machen, Dämmmaterialen für den Bau, die Heizkosten senken, das ist nur ein kleiner Teil der weltweiten Produktion. 40 Prozent des Plastiks wird zu Verpackungen, hinzukommen viele Produkte mit einer sehr kurzen Nutzungsdauer. Danach sind sie Abfall. Dann ist Kunststoff keine Lösung mehr sondern ein Problem, wie Robert Habeck, der Parteivorsitzende der Grünen beklagt.
"Wir müssen uns jetzt fragen als Menschheit, wenn ich so pathetisch reden darf, ob wir für die kurzfristigste Verwendung, und darum geht es ja, von den Wattestäbchen, mit denen ich mir die Ohren sauber mache bis zum Aufreißen von einer Folie, in der eine Gurke eingeschweißt ist, ob wir für die kurzfristigste, einmalige Verwendung das langlebigste Produkt nehmen und die Antwort kann eigentlich nur Nein sein."
Einkaufen ohne Plastikmüll
Diese Antwort hat auch Christin Neubert für sich gefunden. Sie kommt aus ihrem Laden in Leipzig heraus, setzt sich auf die Bank davor. "Einfach Unverpackt" heißt das kleine Geschäft. Wer hier etwas kaufen will, muss Behältnisse und Tragetasche mitbringen.
"Ich finde, wir sind die Generation, die damit aufgewachsen ist, es wurde uns vorgelebt oder wir sind es gewohnt, alles in Plastik zu kaufen. Und dadurch ist es schon eine Herausforderung für unsere Generation speziell wieder zu versuchen, darauf zu verzichten. Aber wir merken ganz viel, wenn die ältere Kundschaft zu uns kommt, dass die das ja noch von früher kennen, wo noch nicht alles in Plastik war oder wo die Kinder mit der Milchkanne losgeschickt wurden, um Milch zu holen, da kommen die Erinnerungen hoch, und man sagt sich klar, warum - das ging früher auch, warum soll man das nicht heute wieder so machen."
Christin Neubert hat auch Handy und Laptop, in denen Kunststoffe verbaut sind, aber sie versucht, in ihrem Leben soweit es geht auf Plastik zu verzichten. Das war zwar erst einmal eine größere Umstellung, wenn man sich aber daran gewöhnt habe, sagt sie, sei es nicht mehr schwer. Zum Beispiel beim Einkaufen.
"Bei uns ist das so, dass man quasi ja zu Hause schon sich überlegen muss, was möchte ich einkaufen. Und nimmt dann Behälter mit. Also Spontaneinkäufe sind ein bisschen schwieriger, aber auch die sind möglich, wenn man sich, wie ich es jetzt habe, im Rucksack zum Beispiel eine Dose und einen Stoffbeutel dabei hat, dann kann man zumindest ein paar Kleinigkeiten spontan einkaufen."
Solche Maßnahmen sind freiwillig. Bei der EU sieht man den vielen Plastikmüll als Problem und will einige Einweg-Artikel aus Plastik verbieten, Trinkhalme und Wattestäbchen beispielsweise. Sie werden besonders oft an Stränden gefunden. Im Bundesumweltministerium setzt man vor allem auf Recycling, was Robert Habeck nicht weit genug geht.
"Also das Problem bei Recycling ist, dass die Rohstoffe immer schlechter werden und dass gerade die Plastikstoffe häufig sehr schlechte Qualität haben, sodass man keine geschlossenen Kreisläufe innerhalb der gleichen Stoffgruppen hinbekommt. Also die Käsedinger, in denen die Käsescheiben eingeschweißt werden oder Wurstscheiben, die werden vielleicht zu Parkbankpfählen oder so was ähnliches. Vielleicht muss man auch Parkbankpfähle produzieren, aber es wird immer neu nachgezogen und wahrscheinlich ist auch der Weltmarkt an Parkbankpfählen irgendwann gesättigt."
"Ich finde, wir sind die Generation, die damit aufgewachsen ist, es wurde uns vorgelebt oder wir sind es gewohnt, alles in Plastik zu kaufen. Und dadurch ist es schon eine Herausforderung für unsere Generation speziell wieder zu versuchen, darauf zu verzichten. Aber wir merken ganz viel, wenn die ältere Kundschaft zu uns kommt, dass die das ja noch von früher kennen, wo noch nicht alles in Plastik war oder wo die Kinder mit der Milchkanne losgeschickt wurden, um Milch zu holen, da kommen die Erinnerungen hoch, und man sagt sich klar, warum - das ging früher auch, warum soll man das nicht heute wieder so machen."
Christin Neubert hat auch Handy und Laptop, in denen Kunststoffe verbaut sind, aber sie versucht, in ihrem Leben soweit es geht auf Plastik zu verzichten. Das war zwar erst einmal eine größere Umstellung, wenn man sich aber daran gewöhnt habe, sagt sie, sei es nicht mehr schwer. Zum Beispiel beim Einkaufen.
"Bei uns ist das so, dass man quasi ja zu Hause schon sich überlegen muss, was möchte ich einkaufen. Und nimmt dann Behälter mit. Also Spontaneinkäufe sind ein bisschen schwieriger, aber auch die sind möglich, wenn man sich, wie ich es jetzt habe, im Rucksack zum Beispiel eine Dose und einen Stoffbeutel dabei hat, dann kann man zumindest ein paar Kleinigkeiten spontan einkaufen."
Solche Maßnahmen sind freiwillig. Bei der EU sieht man den vielen Plastikmüll als Problem und will einige Einweg-Artikel aus Plastik verbieten, Trinkhalme und Wattestäbchen beispielsweise. Sie werden besonders oft an Stränden gefunden. Im Bundesumweltministerium setzt man vor allem auf Recycling, was Robert Habeck nicht weit genug geht.
"Also das Problem bei Recycling ist, dass die Rohstoffe immer schlechter werden und dass gerade die Plastikstoffe häufig sehr schlechte Qualität haben, sodass man keine geschlossenen Kreisläufe innerhalb der gleichen Stoffgruppen hinbekommt. Also die Käsedinger, in denen die Käsescheiben eingeschweißt werden oder Wurstscheiben, die werden vielleicht zu Parkbankpfählen oder so was ähnliches. Vielleicht muss man auch Parkbankpfähle produzieren, aber es wird immer neu nachgezogen und wahrscheinlich ist auch der Weltmarkt an Parkbankpfählen irgendwann gesättigt."
Geht es um Vermeidung von Plastikmüll, fällt sofort das Stichwort biologisch abbaubar. Möglich ist dies unter ganz speziellen Bedingungen, wie sie in einer industriellen Kompostieranlage herrschen: Eine bestimmte Temperatur, ein bestimmter Feuchtigkeitsgrad und eine gute Durchmischung – dann zersetzt sich der Kunststoff zu Wasser und Kohlendioxid. Doch die Kunststoffe liefern kaum die für den Kompost wichtigen Nährstoffe.

Plastik ist mehr und mehr zum Verpackungsmüll verkommen.© imago
Der technologische Aufwand, die unterschiedliche Dauer der Abbauprozesse und der Sortieraufwand machen ihre Kompostierung zudem fragwürdig. Auch die BASF hat einen solchen abbaubaren Kunststoff im Portfolio, wie Jan Rudloff erklärt.
"Wir mischen dann die Sollbruchstellen in die Kettenmoleküle rein, die verteilen sich dann in diesen Kettemolekülen. Und sind dann später, nach der Anwendung dafür verantwortlich, dass der Kunststoff so abgebaut werden kann."
Auch im Meer würde sich ein solcher Kunststoff zersetzen, allerdings braucht er deutlich länger, vor allem in den Polarmeeren. Der Kunststoff könnte zwar so eingestellt werden, dass er auch im Meer schneller verrottet, dann würde er aber auch als Verpackung nicht mehr funktionieren und in der Sonne schnell zerfallen.
"Wir mischen dann die Sollbruchstellen in die Kettenmoleküle rein, die verteilen sich dann in diesen Kettemolekülen. Und sind dann später, nach der Anwendung dafür verantwortlich, dass der Kunststoff so abgebaut werden kann."
Auch im Meer würde sich ein solcher Kunststoff zersetzen, allerdings braucht er deutlich länger, vor allem in den Polarmeeren. Der Kunststoff könnte zwar so eingestellt werden, dass er auch im Meer schneller verrottet, dann würde er aber auch als Verpackung nicht mehr funktionieren und in der Sonne schnell zerfallen.
"Das hat auch in Zukunft noch Zukunft"
Dennoch wird an solchen Lösungen weiter geforscht, auch von Daniela Pufky-Heinrich am Fraunhoferinstitut für chemisch-biotechnologische Prozesse in Leuna. Genauso wie an biobasierten Kunststoffen, also solche die nicht mehr aus Öl sondern aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Und damit kehrt man gewissermaßen ein wenig zu den Anfängen zurück. Und wie so oft in der Geschichte des Materials geht es um die Nutzung von Stoffen, die bei der Herstellung anderer Produkte abfallen.
Daniela Pufky-Heinrich: "Es gibt für unsere Arbeiten zwei Triebkräfte, will ich mal so sagen. Also einmal biobasierte Chemikalien-Kunststoffe herzustellen, um nachhaltige Produkte mit keinem Carbon-Footprint, also mit einer neutralen CO2-Bilanz. Und dann gibt es natürlich die Triebkraft aus der Industrie, zum Beispiel Zellstoffindustrie, Pflanzenölindustrie die große Mengen an Rohstoff-Abfallströmen, Restströme haben, die sie verwerten möchten."
Indem sich die Forschung darauf konzertiert, Reststoffe als Rohstoff nutzbar zu machen, soll vermieden werden, dass man in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion gerät. Lignin beispielsweise kann mit Hilfe von Mikroorganismen zu Zucker und anschließend in Polylactid umgewandelt werden, ein bioabbaubarer Kunststoff. Lignin ist ein Abfallprodukt der Zellstoffindustrie.
"Das ist 50 Prozent, was übrig bleibt. Das wird momentan verbrannt und da ist halt die Motivation groß, können wir da noch mehr als Energie gewinnen und welche Produkte können wir zum Beispiel gewinnen."
Für die Chemikerin Daniela Pufky-Heinrich jedenfalls ist kein Ende bei der Entwicklung von Kunststoff absehbar. "Das hat auch in Zukunft noch Zukunft."
Auch in der Industrie forscht man daran, Öl irgendwann als Rohstoff zu ersetzen. Biomasse ist eines der großen Forschungsfelder, Erdgas, das noch länger als Öl zur Verfügung stehen wird, ein anderes. Öl als Rohstoff wird aber auch die nächste Zeit dominieren, auch weil es sehr billig ist. Für Robert Habeck von den Grünen ist aber gerade das billige Öl das Hauptproblem.
"Also als ich mich damit beschäftigt habe und ein paar Mal laut gesagt habe, ich bin dafür Plastik zu verteuern, über eine Steuer beispielsweise, da habe ich gleich stapelweise Briefe von der plastikproduzierenden Industrie bekommen, wie großartig Plastik ist. Und das ist es ja auch. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass, was soll ich denn jetzt sagen, Herzklappen aus Plastik sind. Es geht nur darum den Müll zu reduzieren und dann vor allem den Müll, der ganz leicht zu ersetzen ist."
Uta Scholten ist nun am Ende der Sammlung ihres Kunststoffmuseums angelangt. Bei aller Begeisterung für Kunststoffe sieht auch sie große Probleme. Mikroplastik in Zahncremes und Kosmetika würde sie am liebsten sofort verbieten. Auch den sorglosen Umgang mit Plastik kann sie nicht verstehen, dass es manchmal nur deshalb eingesetzt wird, weil es wenig kostet. Mit ihrem Museum will sie auch dazu beitragen, Kunststoff Wert zu schätzen, um vielleicht irgendwann dazu zu kommen, dass es sich bei Plastik nicht um ein billiges Wegwerfprodukt handelt.
"Wenn wir weiter auf diesem Planeten leben wollen, dann müssen wir langsam mal über unsere Art zu wirtschaften nachdenken."
Ein kleiner Anfang ist gemacht: Seit die Deutschen für die Plastik-Tragetüte im Supermarkt und anderswo zahlen müssen, ist der Verbrauch drastisch zurückgegangen. 2,4 Milliarden Tüten wurden 2017 in Umlauf gebracht, zwar immer noch viel zu viel, aber ein Drittel weniger als im Vorjahr.
Daniela Pufky-Heinrich: "Es gibt für unsere Arbeiten zwei Triebkräfte, will ich mal so sagen. Also einmal biobasierte Chemikalien-Kunststoffe herzustellen, um nachhaltige Produkte mit keinem Carbon-Footprint, also mit einer neutralen CO2-Bilanz. Und dann gibt es natürlich die Triebkraft aus der Industrie, zum Beispiel Zellstoffindustrie, Pflanzenölindustrie die große Mengen an Rohstoff-Abfallströmen, Restströme haben, die sie verwerten möchten."
Indem sich die Forschung darauf konzertiert, Reststoffe als Rohstoff nutzbar zu machen, soll vermieden werden, dass man in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion gerät. Lignin beispielsweise kann mit Hilfe von Mikroorganismen zu Zucker und anschließend in Polylactid umgewandelt werden, ein bioabbaubarer Kunststoff. Lignin ist ein Abfallprodukt der Zellstoffindustrie.
"Das ist 50 Prozent, was übrig bleibt. Das wird momentan verbrannt und da ist halt die Motivation groß, können wir da noch mehr als Energie gewinnen und welche Produkte können wir zum Beispiel gewinnen."
Für die Chemikerin Daniela Pufky-Heinrich jedenfalls ist kein Ende bei der Entwicklung von Kunststoff absehbar. "Das hat auch in Zukunft noch Zukunft."
Auch in der Industrie forscht man daran, Öl irgendwann als Rohstoff zu ersetzen. Biomasse ist eines der großen Forschungsfelder, Erdgas, das noch länger als Öl zur Verfügung stehen wird, ein anderes. Öl als Rohstoff wird aber auch die nächste Zeit dominieren, auch weil es sehr billig ist. Für Robert Habeck von den Grünen ist aber gerade das billige Öl das Hauptproblem.
"Also als ich mich damit beschäftigt habe und ein paar Mal laut gesagt habe, ich bin dafür Plastik zu verteuern, über eine Steuer beispielsweise, da habe ich gleich stapelweise Briefe von der plastikproduzierenden Industrie bekommen, wie großartig Plastik ist. Und das ist es ja auch. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass, was soll ich denn jetzt sagen, Herzklappen aus Plastik sind. Es geht nur darum den Müll zu reduzieren und dann vor allem den Müll, der ganz leicht zu ersetzen ist."
Uta Scholten ist nun am Ende der Sammlung ihres Kunststoffmuseums angelangt. Bei aller Begeisterung für Kunststoffe sieht auch sie große Probleme. Mikroplastik in Zahncremes und Kosmetika würde sie am liebsten sofort verbieten. Auch den sorglosen Umgang mit Plastik kann sie nicht verstehen, dass es manchmal nur deshalb eingesetzt wird, weil es wenig kostet. Mit ihrem Museum will sie auch dazu beitragen, Kunststoff Wert zu schätzen, um vielleicht irgendwann dazu zu kommen, dass es sich bei Plastik nicht um ein billiges Wegwerfprodukt handelt.
"Wenn wir weiter auf diesem Planeten leben wollen, dann müssen wir langsam mal über unsere Art zu wirtschaften nachdenken."
Ein kleiner Anfang ist gemacht: Seit die Deutschen für die Plastik-Tragetüte im Supermarkt und anderswo zahlen müssen, ist der Verbrauch drastisch zurückgegangen. 2,4 Milliarden Tüten wurden 2017 in Umlauf gebracht, zwar immer noch viel zu viel, aber ein Drittel weniger als im Vorjahr.




