Geschichte des Völkermords
Völkermord ist keine Erfindung der Moderne. Bereits vor tausenden von Jahren wurden die Besiegten von den Siegern ausgerottet. Ben Kiernan zeigt in einem Buch "Erde und Blut" die Geschichte des Völkermords auf.
Schon auf der ersten Seite macht der Autor deutlich worum es geht:
"Es gibt Belege für die Vernichtung ganzer Gemeinschaften. Ausgrabungen an einer frühen jungsteinzeitlichen Fundstätte in Talheim bei Heilbronn haben ergeben, dass vor 7000 Jahren eine Gruppe von Angreifern, die mit sechs Steinäxten bewaffnet war, 18 Erwachsene und 16 Kinder erschlug und die Leichen anschließend in eine Grube warf."
Das klingt auf eine unangenehme Weise bekannt. Wer bei dieser uralten Szene an das moderne Massengrab von Katyn denkt, erkennt das Muster. Der Konflikt wird gelöst, indem der Konfliktpartner ausgelöscht wird: Troja und Theben, Jerusalem, Karthago, Dresden. Kiernan behandelt die dunkle Seite der menschlichen Geschichte, Mord und Totschlag, Raub und Vergewaltigung, Gier und Gemeinheit. Aber er versucht die Abläufe und die Leidenschaften, die Interessen und die Ängste aufzudecken, die schließlich im mörderischen Akt kulminieren. Er geht zurück zu der biblischen Darstellung des Konfliktes zwischen Kain und Abel. Kiernan greift weit aus, thematisch, zeitlich, geographisch. Er macht deutlich, dass die Ausrottung der Besiegten normal war, über Jahrtausende das übliche Verfahren zwischen Siegern und Besiegten darstellte. Oft genug – und nicht nur in der abendländischen Tradition - wurde damit die Ausrottung des Gegners sogar göttliches, biblisches Gebot:
"Und wenn sie der Herr, Dein Gott, vor Dir dahingibt, dass Du sie schlägst, so sollst Du sie verbannen, dass Du keinen Bund mit ihnen machest noch ihnen Gunst erzeigest ... Du wirst alle Völker verzehren, die der Herr, Dein Gott, Dir geben wird. Du sollst ihrer nicht schonen. … So zieh nun hin und schlage die Amalekiter und verbanne sie mit allem, was sie haben. Schone ihrer nicht; sondern töte Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel."
Einerseits belegt Kiernan, dass Völkermord ein moderner Begriff ist, ein Produkt der Aufklärung und für die Vergangenheit nicht sinnvoll angewendet werden darf, andererseits schreibt er:
"Das vorliegende Buch, eine komparative Untersuchung der Sozial-, Politik- und Geistesgeschichte genozidaler Gewalt, wendet die Definition der UN-Konvention von 1948 auf historisch frühere als auch spätere völkermörderische Ereignisse an."
Das schafft Probleme für seine Untersuchung und schränkt deren wissenschaftliche Bedeutung ein. Mit seinem Vorgehen übersieht Kiernan nämlich die historischen und damit qualitativen Unterschiede zwischen den Ereignissen, die er kultur- und epochenübergreifend gleich behandelt: Damit sind die Rechtfertigungskonzepte für die Tötung des Gegners gemeint, also das jeweilige ideologische Konstrukt. Pol Pot hat "marxistisch", also mit einer hehren Idee, Alexander der Große hat "pragmatisch" ausgerottet. Das macht für ein Verständnis der geschichtlichen Situation – und dessen langfristige Folgen - einen erheblichen Unterschied.
Das alles ist ärgerlich, insbesondere in Anbetracht des weitgefächerten empirischen Panoramas, das das Werk entfaltet. Kiernan beschreibt die konkreten Umstände der massenhaften Morde in den verschieden Epochen und Kulturen, beginnend mit der Antike bis in die Moderne. Das ist dann allerdings spannend und interessant, wenn man bereit ist, das Buch als faktenorientierte Dokumentation zu lesen und nicht als wissenschaftlichen Beitrag. Als Dokumentation hat das Buch viel zu bieten. Ethnische Elemente im Terror Stalins, die englische Eroberung Irlands, die Massaker der Indianer durch Cortez und Pizarro, der Nationalchauvinismus im schrumpfenden Osmanenreich, Massenmorde in Ruanda und in Kambodscha im 20. Jahrhundert werden ausführlich und lebhaft beschrieben, zum Teil mit zeitgenössischen Darstellungen, die in ihrer naiven Drastik ein Gefühl für das "fröhliche Morden" jener Zeit vermitteln. Einige Bereiche werden sehr viel ausführlicher behandelt als andere, ohne dass klar wird warum. Das ändert jedoch wenig am vermittelten Erkenntnisgewinn.
Sehr zu kurz kommen die sozialpolitischen Folgen dieser vielen Morde. Nicht nur die Opfer selbst, auch deren Traditionen, deren Sprachen, deren Lebensgefüge wurden nämlich durch die Massaker beschädigt, oft genug zerstört. Das, was es an staatlichen oder Stammes-Strukturen gegeben hatte, wurde einem Prozess der Verwahrlosung preisgeben. Besonders deutlich wird das am Schicksal der amerikanischen Indianer, sowohl dort, wo die Engländer und Franzosen als auch die Spanier und Portugiesen kulturelle Wüsten hinterlassen hatten. Dass im Index Thomas Hobbes nur einmal und Hitler 21 Mal genannt wird, ist symptomatisch. Hitler macht mehr her. Wer über Hobbes spricht, muss über die Folgen der Massaker für Staat und Gesellschaft nachdenken. Wenn es eine wirklich dauerhafte Folge der Massaker gibt, dann ist es weniger die statistisch messbare Zahl der Toten, sondern es ist der Verlust an sozialer Substanz, der Zusammenbruch eines oft über Jahrtausende gewachsenen Gemeinwesens. Anomie nennt man das. Und Hobbes und Dürkheim hätten hier wichtige Anregungen geben können.
""Die Heilung und Prävention des genoziden Verbrechens muss mindestens zu einem Teil in der Diagnose seiner stets wiederkehrenden Ursachen und Symptome liegen", …"
schreibt Kiernan. In der Tat, vor allem aber auch in seinen politischen und kulturellen Folgen.
Ben Kiernan: Erde und Blut. Völkermord und Vernichtung von der Antike bis heute
DVA, München/2009
"Es gibt Belege für die Vernichtung ganzer Gemeinschaften. Ausgrabungen an einer frühen jungsteinzeitlichen Fundstätte in Talheim bei Heilbronn haben ergeben, dass vor 7000 Jahren eine Gruppe von Angreifern, die mit sechs Steinäxten bewaffnet war, 18 Erwachsene und 16 Kinder erschlug und die Leichen anschließend in eine Grube warf."
Das klingt auf eine unangenehme Weise bekannt. Wer bei dieser uralten Szene an das moderne Massengrab von Katyn denkt, erkennt das Muster. Der Konflikt wird gelöst, indem der Konfliktpartner ausgelöscht wird: Troja und Theben, Jerusalem, Karthago, Dresden. Kiernan behandelt die dunkle Seite der menschlichen Geschichte, Mord und Totschlag, Raub und Vergewaltigung, Gier und Gemeinheit. Aber er versucht die Abläufe und die Leidenschaften, die Interessen und die Ängste aufzudecken, die schließlich im mörderischen Akt kulminieren. Er geht zurück zu der biblischen Darstellung des Konfliktes zwischen Kain und Abel. Kiernan greift weit aus, thematisch, zeitlich, geographisch. Er macht deutlich, dass die Ausrottung der Besiegten normal war, über Jahrtausende das übliche Verfahren zwischen Siegern und Besiegten darstellte. Oft genug – und nicht nur in der abendländischen Tradition - wurde damit die Ausrottung des Gegners sogar göttliches, biblisches Gebot:
"Und wenn sie der Herr, Dein Gott, vor Dir dahingibt, dass Du sie schlägst, so sollst Du sie verbannen, dass Du keinen Bund mit ihnen machest noch ihnen Gunst erzeigest ... Du wirst alle Völker verzehren, die der Herr, Dein Gott, Dir geben wird. Du sollst ihrer nicht schonen. … So zieh nun hin und schlage die Amalekiter und verbanne sie mit allem, was sie haben. Schone ihrer nicht; sondern töte Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel."
Einerseits belegt Kiernan, dass Völkermord ein moderner Begriff ist, ein Produkt der Aufklärung und für die Vergangenheit nicht sinnvoll angewendet werden darf, andererseits schreibt er:
"Das vorliegende Buch, eine komparative Untersuchung der Sozial-, Politik- und Geistesgeschichte genozidaler Gewalt, wendet die Definition der UN-Konvention von 1948 auf historisch frühere als auch spätere völkermörderische Ereignisse an."
Das schafft Probleme für seine Untersuchung und schränkt deren wissenschaftliche Bedeutung ein. Mit seinem Vorgehen übersieht Kiernan nämlich die historischen und damit qualitativen Unterschiede zwischen den Ereignissen, die er kultur- und epochenübergreifend gleich behandelt: Damit sind die Rechtfertigungskonzepte für die Tötung des Gegners gemeint, also das jeweilige ideologische Konstrukt. Pol Pot hat "marxistisch", also mit einer hehren Idee, Alexander der Große hat "pragmatisch" ausgerottet. Das macht für ein Verständnis der geschichtlichen Situation – und dessen langfristige Folgen - einen erheblichen Unterschied.
Das alles ist ärgerlich, insbesondere in Anbetracht des weitgefächerten empirischen Panoramas, das das Werk entfaltet. Kiernan beschreibt die konkreten Umstände der massenhaften Morde in den verschieden Epochen und Kulturen, beginnend mit der Antike bis in die Moderne. Das ist dann allerdings spannend und interessant, wenn man bereit ist, das Buch als faktenorientierte Dokumentation zu lesen und nicht als wissenschaftlichen Beitrag. Als Dokumentation hat das Buch viel zu bieten. Ethnische Elemente im Terror Stalins, die englische Eroberung Irlands, die Massaker der Indianer durch Cortez und Pizarro, der Nationalchauvinismus im schrumpfenden Osmanenreich, Massenmorde in Ruanda und in Kambodscha im 20. Jahrhundert werden ausführlich und lebhaft beschrieben, zum Teil mit zeitgenössischen Darstellungen, die in ihrer naiven Drastik ein Gefühl für das "fröhliche Morden" jener Zeit vermitteln. Einige Bereiche werden sehr viel ausführlicher behandelt als andere, ohne dass klar wird warum. Das ändert jedoch wenig am vermittelten Erkenntnisgewinn.
Sehr zu kurz kommen die sozialpolitischen Folgen dieser vielen Morde. Nicht nur die Opfer selbst, auch deren Traditionen, deren Sprachen, deren Lebensgefüge wurden nämlich durch die Massaker beschädigt, oft genug zerstört. Das, was es an staatlichen oder Stammes-Strukturen gegeben hatte, wurde einem Prozess der Verwahrlosung preisgeben. Besonders deutlich wird das am Schicksal der amerikanischen Indianer, sowohl dort, wo die Engländer und Franzosen als auch die Spanier und Portugiesen kulturelle Wüsten hinterlassen hatten. Dass im Index Thomas Hobbes nur einmal und Hitler 21 Mal genannt wird, ist symptomatisch. Hitler macht mehr her. Wer über Hobbes spricht, muss über die Folgen der Massaker für Staat und Gesellschaft nachdenken. Wenn es eine wirklich dauerhafte Folge der Massaker gibt, dann ist es weniger die statistisch messbare Zahl der Toten, sondern es ist der Verlust an sozialer Substanz, der Zusammenbruch eines oft über Jahrtausende gewachsenen Gemeinwesens. Anomie nennt man das. Und Hobbes und Dürkheim hätten hier wichtige Anregungen geben können.
""Die Heilung und Prävention des genoziden Verbrechens muss mindestens zu einem Teil in der Diagnose seiner stets wiederkehrenden Ursachen und Symptome liegen", …"
schreibt Kiernan. In der Tat, vor allem aber auch in seinen politischen und kulturellen Folgen.
Ben Kiernan: Erde und Blut. Völkermord und Vernichtung von der Antike bis heute
DVA, München/2009
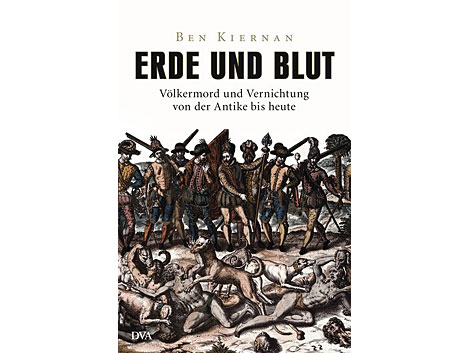
Ben Kiernan: "Erde und Blut"© DVA
