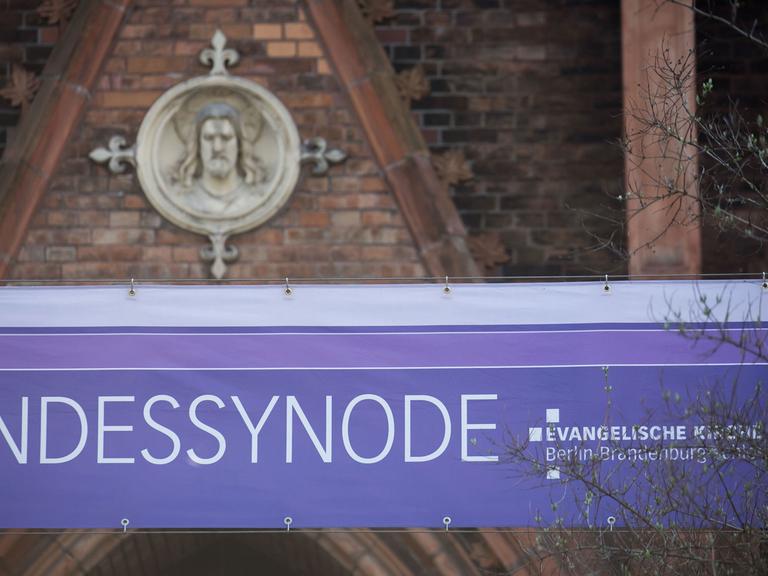Georg Romer, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie an der Universitäts-Klinik Münster. Er gehörte zu den Ersten in Deutschland, der Beratung für transidente Kinder und Jugendliche anbot, zunächst am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, seit 2013 in Münster.
"Transidentität ist Schicksal"
29:45 Minuten

Immer mehr Kinder empfinden, im falschen Geschlecht zu leben. Ihre Zahl steigt, weil das Verständnis für Transidentität gewachsen ist, sagt der Jugendpsychiater Georg Romer. Für eine gute weitere Entwicklung der Kinder sind die Eltern zentral.
"Transidentität ist Schicksal", sagt Georg Romer, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychotherapie an der Uni-Klinik Münster.
"Das kann sich kein Mensch aussuchen. Das müssen auch Eltern verstehen, dass das keine beliebige Entscheidung ist, so wie man sich für eine Parteizugehörigkeit, eine Religion oder einen Beruf entscheiden kann, was ja auch Teil unserer persönlichen Identität ist."
Zeit für Diagnostik
Die Zahl der Anfragen in der Spezialsprechstunde für transidente Kinder und Jugendliche an der Uniklinik Münster habe sich im vergangenen Jahrzehnt vervielfacht. Transident nennt man Kinder, wenn das selbst empfundene Geschlecht nicht mit den körperlichen Merkmalen übereinstimmt.
Wenn ein zwölfjähriges Mädchen in die Sprechstunde kommt und sagt: "Eigentlich bin ich ein Junge." Was passiert dann?
Wenn ein zwölfjähriges Mädchen in die Sprechstunde kommt und sagt: "Eigentlich bin ich ein Junge." Was passiert dann?
"Zunächst mal nehmen wir uns Zeit. Zeit, mit diesem Kind in einem respektvollen Dialog uns seine Geschichte erzählen zu lassen, dabei sehr gut zuzuhören, auch den Eltern, ihnen auch in separaten Gesprächen sehr gut zuzuhören."
Dialog und Respekt
Georg Romer betont, dass es sich um eine dialogische Herangehensweise handelt und die Ärzte gemeinsam mit dem Kind oder der Jugendlichen zu der Einsicht kommen, ob es sich um eine Transidentität handelt oder nicht.
"Die Zeiten, in denen wir uns quasi als TÜV-Gutachter, als Nadelöhr verstanden hätten, um zu entscheiden: 'Du bist trans und du bist nicht trans' – diese Zeiten sind vorbei. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Sondern es geht ums Zuhören, auch ums Dazulernen."
Schwerer Abschied für die Eltern
Romer sieht es als eine der wichtigsten fachlichen Herausforderungen, die Eltern "mit ins Boot" zu holen. Sie müssten akzeptieren, dass ihr Kind sich aus dem Innersten heraus in einer anderen geschlechtlichen Identität empfinde. Gelinge das nicht, dann könnten junge Menschen daran zerbrechen. Es brauche oft sehr viel Zeit und tränenreiche Gespräche.
"Es geht darum, Eltern dafür die Augen zu öffnen, dass sie vielleicht das innere Bild einer Tochter verlieren, dafür aber einen wunderbaren Sohn adoptieren können. Und das Zauberhafte der Situation ist dann auch noch, dass es sich dabei um den gleichen Menschen handelt."
Das Irreversibilitäts-Dilemma
Jede Entscheidung habe langfristige Konsequenzen: Die Folgen einer hormonellen Behandlung vor der Pubertät sind irreversibel, nicht rückgängig zu machen. Dasselbe gilt allerdings auch, wenn man die Pubertät laufen lasse. Die irreversible Verweiblichung oder Vermännlichung des Körpers kann bei transidenten Menschen zu schweren psychischen Langzeitschäden führen.
"Das heißt, wir als Ärzte und auch die Verantwortung tragenden Erwachsenen, die einen jungen Menschen begleiten, müssen uns dem Irreversibilitäts-Dilemma stellen."
Jede Entscheidung müsse in jedem Einzelfall hervorragend begründet sein. Eine große Verantwortung.
(sf)
Erstsendung war am 22. August 2020.
Das Interview in ganzer Länge:
Deutschlandfunk Kultur: Ein Mädchen kommt auf die Welt. Die ganze Familie freut sich. Das Mädchen kommt in die Kita, dann in die Schule. Und eines Tages sagt es, "eigentlich bin ich ein Junge", obwohl alle körperlichen Merkmale eindeutig sagen: Es ist ein Mädchen. Das nennt man dann "Transidentität".
Sie beschäftigen sich schon einige Jahre mit transidenten Kindern und Jugendlichen. Kommen heute eigentlich mehr solche Kinder und Jugendliche zu Ihnen als früher?
Romer: Deutlich mehr. Das hat sich in den vergangenen zehn Jahren von den Anfragen betroffener Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien verzehnfacht oder verzwanzigfacht. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass es zunehmend qualifizierte Beratungs- und Behandlungsangebote für diesen Personenkreis gibt, auch in dieser Altersgruppe. Als wir vor zwanzig Jahren damit angefangen haben, waren wir – ich damals in Hamburg – mit einer universitären Spezialsprechstunde in Frankfurt die Einzigen, die fachliche Unterstützung angeboten haben. Das Feld hat sich entwickelt. Damit wird das Bewusstsein in der Gesellschaft für dieses Thema zunehmend sensibilisiert. Das führt verständlicherweise dazu, dass auch immer früher diese Kinder und Jugendliche professionelle Hilfe suchen.
Nicht die Transidentität, die Verhältnisse machen krank
Deutschlandfunk Kultur: Das waren zwei Gründe. Der eine ist, es gibt mehr Angebote für die Behandlung und deswegen steigt die Nachfrage – das würde mich jetzt nicht so überzeugen. Aber der zweite lautet, dass es überhaupt ein Bewusstsein dafür gibt, ein Wissen davon. Gab es das vielleicht vor zehn, zwanzig Jahren nicht so?
Romer: Selbstverständlich. Es geht Hand in Hand, das Bewusstsein in der Gesellschaft, dass es überhaupt dieses Problem gibt. In den vergangenen Jahrzehnten haben betroffene Menschen ihren Weg in einer vereinsamten Nische für sich finden müssen und wussten vielleicht gar nicht, dass es so etwas wie Transidentität überhaupt gibt und dass es eine Erscheinungsform der menschlichen Natur ist, die für sich gesehen überhaupt gar keinen Störungs- und Krankheitswert hat.
Man kann da ein bisschen die historische Parallele zur Homosexualität ziehen. Die Homosexualität galt bis in die 70er-Jahre hinein als psychiatrische Störung. Das macht man sich heute oft gar nicht mehr bewusst. Erst Ende der 70er-Jahre wurde sie als eine normale Variante menschlicher Sexualität anerkannt und aus dem Katalog psychiatrischer Störungen gestrichen.
Gleichwohl gab es viele Homosexuelle, die psychische Probleme hatten. Das lag aber an der gesellschaftlichen Stigmatisierung und an der damit verbundenen Angst und psychischen Belastung, sich überhaupt mit dieser sexuellen Orientierung im sozialen Raum zu zeigen und dazu zu stehen.
Und mit der Transidentität ist es im Grunde sehr ähnlich, auch in der Entwicklung ähnlich gelaufen. Transsexuelle Menschen hatten über Jahrzehnte, von Psychiatern sogar treffend beschrieben, deutlich gehäuft Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit, deutlich gehäuft Depressionen, Angststörungen, Suchtstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Selbstverletzung, Suizidalität. Das hat zu einem jahrzehntelangen Missverständnis geführt, dass es sich dabei um eine psychiatrische Störung per se handele.
Und dann gab es einen Donnerschlag in der Fachwelt, ausgelöst durch den Mut der Fachkollegen in den Niederlanden, die vor etwa 25 Jahren in Utrecht und in Amsterdam damit begonnen haben, Jugendlichen erstmalig weltweit im Laufe ihrer noch offenen pubertären Reifeentwicklung Zugang zu qualifizierter Hormonbehandlung zu ermöglichen. Wenn die Jugendlichen diese Transidentität als Entwicklung in sehr deutlichen Fällen zeigten. Am Anfang mussten fünf Experten in einem Genderteam im Einzelfall der diagnostischen Einschätzung zustimmen. Und dann hat man diese Jugendlichen weiterverfolgt.
Und es stellte sich heraus, wenn man diese jungen Menschen mit 25 nachuntersucht, dass sie psychische Auffälligkeiten in einer Häufigkeit haben oder nicht haben exakt im Bereich der Durchschnittsbevölkerung. Das heißt, sie gehen einen ganz normalen Weg mit psychischer Gesundheit. Und die jahrzehntelang vorher beschriebenen gehäuften psychischen Probleme sind die sekundäre, man könnte auch sagen traumatische Folgeerscheinung des unerträglichen Gefühls, in einem als falsch empfundenen Körper, der nicht zur selbst empfundenen Identität passt, zurechtkommen zu müssen und auch insbesondere in der Jugend die Pubertät durchleiden zu müssen.
Seit wir das wissen, bieten wir das an. Und seither hat auch die Weltgesundheitsorganisation die Transidentität als psychiatrische Diagnose abgeschafft. Damit steigt das Bewusstsein in der Gesellschaft, dass das etwas ist, womit man Hilfe suchen kann und darf.
Keine Selbstbedienung für Hormone
Deutschlandfunk Kultur: Es gibt ja auch die klare Gegenthese, die sagt, Transidentität, Transsexualität sei heute so ein Hype, eine Mode, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und es sind gerade Kinder und Jugendliche, die psychische Schwierigkeiten haben wie Depression zum Beispiel, selbstverletzendes Verhalten, die dann in dieser vermeintlichen Transidentität eine Lösung sehen.
Romer: Als pauschale Gegenthese ist mir das nicht geläufig. Es gibt da teilweise medial verzerrte Einzeldarstellungen von Positionen einzelner Kollegen. Selbstverständlich kann es im Einzelfall so etwas geben, dass ein Jugendlicher, der von Haus aus psychische Probleme hat, auf einen Zug aufspringt, sich eine Pseudoidentität sucht und sich das als Weg im Sinne eines Irrweges als falsch erweist.
Das ist der Grund, warum wir auch in der Medizin keinen – ich sage mal etwas salopp zugespitzt – "Selbstbedienungsladen" befürworten können oder verantworten können, in dem ein junger Mensch einfach sagt, "ich bin jetzt trans und möchte eine Hormonbehandlung haben", dann kriegt er die automatisch. – Nein!
Wir haben in jedem Einzelfall eine hohe Begründungslast, auch ethisch, uns da aus dem Fenster zu lehnen und einem jungen Menschen eine Behandlung anzubieten, wie in einem solchen Fall, wenn in der Pubertät ein Leidensdruck entsteht, auch durch medizinische Maßnahmen in die körperliche Entwicklung einzugreifen. Das muss man in jedem Einzelfall gut entwickeln.
Eine gute Diagnostik braucht Zeit ...
Deutschlandfunk Kultur: Da sitzt jetzt ein zwölfjähriges Mädchen vor Ihnen und sagt: "Ich bin ein Junge." – Was tun Sie dann?
Romer: Zunächst mal nehmen wir uns Zeit. Zeit, mit diesem Kind in einem respektvollen Dialog uns seine Geschichte erzählen zu lassen, dabei sehr gut zuzuhören, auch den Eltern, ihnen auch in separaten Gesprächen sehr gut zuzuhören. So ein Erstvorstellungs-Termin in unserer Spezialsprechstunde an der Münsteraner Uni-Klinik wird, weil die Familien oft von sehr weit anreisen, mit drei Stunden terminiert.
Und dann gibt es über mehrere Wochen und Monate Folgegespräche, damit man die Entwicklung auch unter diesen Gesprächen über einen längeren Zeitraum begleitet, um im Einzelfall miteinander im Dialog herauszufinden: Was verbirgt sich hinter dieser Aussage?
... und Respekt
Deutschlandfunk Kultur: Es kommt schon auch vor, dass Sie mal sagen, "das ist was anderes als Transidentität"?
Romer: Dass wir gemeinsam im Gespräch mit den jungen Menschen diese Einsicht entwickeln. Es ist eine dialogische Herangehensweise. Die Zeiten, in denen wir uns quasi als TÜV-Gutachter, als Nadelöhr verstanden hätten, um zu entscheiden, "du bist trans und du bist nicht trans", diese Zeiten sind vorbei. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Sondern es geht ums Zuhören, auch ums Dazulernen. Und wenn jemand beispielsweise eine solche Selbstwahrnehmung sehr rasch entwickelt, vorher jahrelang problemlos in seinem Geburtsgeschlecht zurechtzukommen schien, dann gibt es natürlich berechtigte Zweifel, meist zunächst vorgebracht von den Eltern: "Wie kann das denn sein?"
Das schließt im Einzelfall überhaupt nicht aus, dass sich auch hier eine Transidentität entwickelt. Manchmal gibt es solche Verläufe, dass das relativ spät zum Vorschein kommt. Aber wenn es berechtigte Zweifel gibt, nimmt man sich die Zeit und muss sich die Mühe machen, als geschulter Psychotherapeut einen jungen Menschen auch für diese Zweifel in eigener Sache im Gespräch zu gewinnen.
Das gelingt auch meist sehr gut, denn es geht um ernsthafte Fragen. Ob es wirklich Sinn macht, ein Leben lang Hormone zu nehmen beispielsweise, ein Leben lang später unfruchtbar zu sein. Junge Menschen haben es überhaupt nicht verdient, dass ihnen generell unterstellt wird, dass sie damit leichtfertig umgehen würden. Das Gegenteil ist der Fall.
Die Menschen, die zu uns kommen, machen sich diese Fragen überhaupt nicht leicht. Und es gelingt sehr gut, sich die Zeit von mehreren Monaten zu lassen, bis wir diese Indikation entwickeln. Es gibt Fälle, wo das relativ rasch super-eindeutig daherkommt, wo schon im Kindergarten eine solche Transidentität sich deutlich gezeigt hat und kein Mensch mehr im Umfeld überrascht ist. Und es gibt Fälle, wo es einfach mehr Zeit braucht, um eine Klarheit über den Weg der Identitätsentwicklung miteinander zu gewinnen.
Auf die Eltern kommt es an
Deutschlandfunk Kultur: Gemeinsam mit den Eltern, die haben Sie ja erwähnt. Die kommen mit, weil die Kinder minderjährig sind. Ich nehme mal an, dass alle mitzureden haben, nicht nur das Kind, auch die Eltern. – Was machen Sie, wenn der Wille auseinandergeht?
Romer: Das ist eine der wichtigsten fachlichen Herausforderungen für unsere Arbeit, weil es in aller Regel wenig Sinn macht, einen solchen Weg zu gehen, wenn Eltern nicht mit im Boot sind. Und "mit im Boot" heißt nicht, dass sie eine Unterschrift leisten und in eine Behandlung einwilligen, sondern "mit im Boot sein" heißt, dass sie auch den emotionalen Prozess durchlaufen haben, zu akzeptieren, dass ihr Kind sich in einer anderen geschlechtlichen Identität als der, die bei Geburt aufgrund der körperlichen Merkmale zugewiesen wurde, aus dem Innersten heraus empfindet und danach leben möchte.
Das ist ein Schicksal. Das kann sich kein Mensch heraussuchen. Das müssen auch Eltern verstehen, dass das keine beliebige Entscheidung ist, so wie man sich für eine Parteizugehörigkeit, eine Religion oder einen Beruf entscheiden kann, was ja auch Teil unserer persönlichen Identität ist. Nein, die Geschlechtsidentität ist so tief in uns angelegt, auch hier vergleichbar zur sexuellen Orientierung. Wenn es um eine Transidentität geht, dann ist dagegen kein Kraut gewachsen. Dann wird sie sich ihren Weg irgendwie bahnen müssen. Und dann gibt es nur noch die Entscheidung für einen mehr oder weniger schmerzlichen Weg, einen mehr oder weniger reibungsvollen Weg.
Und ein Teil unserer Arbeit besteht darin, Eltern dies vor Augen zu führen, dass sie diesen Weg mitgehen können. Wenn das nicht gelingt, dann drohen junge Menschen auch daran zu zerbrechen, weil es in der Regel für einen jungen Menschen eine psychische Überforderung ist, einen solchen Weg gegen die Eltern zu gehen. Es braucht sehr viel Zeit und tränenreiche Gespräche in Sitzungen, denn Eltern müssen realisieren: Über kurz oder lang werden sie ihr Kind verlieren. Also, ein Beziehungsbruch ist unabdingbar, wenn ein junger Mensch, der transident ist, auf Dauer das Gefühl hat, in dieser Identität von seinen eigenen Eltern nicht akzeptiert zu werden.
Transidentität ist Schicksal
Deutschlandfunk Kultur: So, wie Sie das schildern, Herr Romer, bleibt den Eltern eigentlich gar keine andere Wahl. Ich habe mir vorgestellt, ich bin die Mutter dieses Mädchens und Sie hätten mir jetzt all das gesagt. Ich würde mich, glaube ich, fast erpresst fühlen.
Romer: Nicht mehr und nicht weniger als von jedem anderen angeborenen Schicksal. Wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn schwul wäre und Sie hätten aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen damit ein Problem, gäbe es keinen Weg, diesem Sohn das Schwulsein oder der Tochter das Lesbischsein abzugewöhnen oder es durch Therapien umzudrehen. Das ist sogar neuerdings seit Mai dieses Jahres gesetzlich in Deutschland verboten. Aus gutem Grund, weil die geschlechtliche Identität und Orientierung von Minderjährigen gesetzlich geschützt wird.
Die Frage der Erpressung stellt sich nicht, sondern es geht um die Haltung. Um es mit einem Lied von Rolf Zuckowski auszudrücken: "So, wie du bist, so wie du bist, so und nicht anders sollst du sein."
Eltern durchleben einen Schmerz, wenn sie sich von der Vorstellung verabschieden, "ich habe doch mein Kind als Mädchen auf den Armen getragen". Das ist eine Trauer, weil ein inneres Bild verloren geht. Und es geht darum, und das ist manchmal eine therapeutisch mühevolle Aufgabe, die Zeit braucht, Eltern dafür die Augen zu öffnen, dass sie vielleicht das innere Bild einer Tochter verlieren, dafür aber einen wunderbaren Sohn adoptieren können. Und das Zauberhafte der Situation ist dann auch noch, dass es sich dabei um den gleichen Menschen handelt.
Abwarten ist keine Option
Deutschlandfunk Kultur: Auf jeden Fall schließe ich daraus, dass die Eltern eine psychotherapeutische Begleitung dieses Prozesses fast noch nötiger haben als die Kinder oder die Jugendlichen selbst.
Wenn Sie diese Transidentität diagnostizieren – mit der größtmöglichen Sicherheit, die menschlichen Urteilen überhaupt zukommen kann, ich nehme an, hundertprozentig sicher kann man sich nie sein – …
Romer: … vollkommen richtig.
Deutschlandfunk Kultur: …, dann wird im Allgemeinen die Pubertät aufgehalten durch Pubertätsblocker, also Hormone, die die Pubertät erst mal aufhalten. Später dann werden weitere Hormone gegeben, die entweder vermännlichen oder verweiblichen, je nachdem. – Warum ist denn eigentlich das Nichtstun keine Option? Warum kann man nicht sagen: Lass uns doch mal abwarten. Lass uns warten, bis das Kind volljährig ist.
So viele Menschen verändern sich im Laufe ihrer Pubertät. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich an Zeiten in unserer Pubertät, in der wir unglücklich waren, desorientiert, auch sexuell desorientiert. – Wäre es nicht besser, diese stürmische Zeit erst mal vorbeigehen zu lassen?
Romer: Das kann im Einzelfall eine richtige und wertvolle Überlegung sein. Das ist das, was ich vorher mit dem medizinischen Selbstbedienungsladen meinte. Es braucht eine kinder- und jugendpsychiatrische Erfahrungsexpertise über die gesamte Variationsbreite von Entwicklungsverläufen – genau das, was Sie gerade angeschnitten haben. Es gibt Umwege der Identitätsfindung bei Jugendlichen, wo jemand vielleicht über eine Transphase für sich selber erst herausfinden muss und kann, dass er mit seinem eigenen Körper doch noch seinen Frieden findet und sich vielleicht in einer homosexuellen Orientierung stimmiger wiederfindet.
Und auch den umgekehrten Weg kennen wir, dass Jugendliche einen lesbischen oder schwulen Selbstfindungsprozess durchlaufen und irgendwann merken: "Das ist es gar nicht, sondern im Kern fühle ich mich als Mädchen und es geht nicht darum, wen ich begehre." – Solche Entwicklungswege müssen wir, wenn sie offen erscheinen, auch mit der genügenden Zeit begleiten, bis jemand sich selber sicher genug sein kann.
Dass wir generell empfehlen, zu sagen, "lasst doch alle bis 18 warten", wäre fatal, weil die Uhr davonläuft. Das heißt, die damit fortschreitenden irreversiblen Körperveränderungen der Vermännlichung und Verweiblichung des Körpers im Zuge der biologisch angelegten Reifeentwicklung führen zu all den Langzeitschäden für die psychische Gesundheit, zu all den erhöhten Risiken für chronifizierte Depression, chronifizierte soziale Ängste, Selbstverletzung, Suizidalität. Also, das Risiko für eine lebenslange psychische Morbidität, wie wir es nennen, steigt damit gewaltig.
Das heißt, wir als Ärzte und auch die Verantwortung tragenden Erwachsenen, die einen jungen Menschen begleiten, müssten uns dem Irreversibilitäts-Dilemma stellen. Wenn wir eingreifen, brauchen wir eine hohe Begründung, eine fachlich hervorragend entwickelte Begründung im Einzelfall, dass wir uns sicher genug sind, hier handelt es sich um eine Transidentität.
Wenn wir entscheiden, wir warten ab und nehmen dabei billigend in Kauf, dass sich der Körper zunehmend verweiblicht oder vermännlicht, sodass vielleicht jemand ein Leben lang daran leidet – und das ist irreversibel, das sieht man jemandem ein Leben lang an und die Menschen leiden beträchtlich darunter – nehmen wir psychische Gesundheitsrisiken in Kauf, über die wir genauso aufklären müssen.
Man muss in jedem Einzelfall den Zwischenweg finden, der eine hinreichend gute Entscheidungssicherheit aufgrund der Beurteilung des Entwicklungsverlaufes garantiert und gleichzeitig die Gefahren eines irreversiblen Fortschreitens einer Reifeentwicklung, mit der ein Mensch ein Leben lang keinen Frieden finden kann, im Blick behält.
Große Verantwortung der Erwachsenen
Deutschlandfunk Kultur: Eine große Verantwortung, die Sie tragen.
Romer: Definitiv. Deswegen machen wir es uns auch nicht leicht. Aber das war genau der Grund, als ich mir das vor etwa 25 Jahren anhand der Verlaufsdaten, die die holländischen Kollegen der Fachwelt vorgestellt haben, vor Augen geführt habe. Als ich erkannt habe, dass man aus diesem Irreversibilitäts-Dilemma so oder so nicht rauskommt, war mir es wichtig, ein fachlich qualifiziertes Angebot zu entwickeln, um genau diese Verantwortung zu übernehmen.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben es vorhin gesagt, Transmenschen müssen ein Leben lang Hormone nehmen, sie werden in der Regel unfruchtbar, bei der Operation werden vollkommen gesunde Organe entfernt. – Muss das alles sein? Anders gefragt: Muss denn überhaupt jede Transidentität medizinisch behandelt werden, hormonell, operativ?
Romer: Das ist eine ganz individuelle Entscheidung in jedem Einzelfall. Was wir sagen können, ist, dass die allermeisten transidenten Menschen die Hormonbehandlung definitiv wünschen und ohne sie auch psychisch schlecht durchs Leben kommen.
Bei der Operation sieht es schon anders aus. Es gibt zunehmend junge Menschen, die sich mit der Geschlechtsangleichung durch Hormonbehandlung wohlfühlen und auf die Genital-OP reflektiert verzichten und sagen, "ich muss mich nicht im Genitalbereich operieren lassen, um mich als Frau zu fühlen oder als Mann zu fühlen". Auch darüber müssen wir aufklären, dass wir kein Schema F anbieten mit normativen Setzungen, wie der Weg einer Transition stattzufinden hat.
Die meisten Trans-Männer legen großen Wert darauf, sich die Brüste entfernen zu lassen, weil das erheblichen Einfluss auf die Teilhabe hat. Wenn ein junger Mensch drei Jahre kein Schwimmbad und keinen Strand mehr besucht hat, kann man ermessen, wie hoch der Leidensdruck ist. Aber bei der Genitaloperation wird es zunehmend individualisiert in der Entscheidung der Betroffenen.
Deutschlandfunk Kultur: Man kann also auch sozusagen den halben Weg gehen, sich die Brust amputieren lassen, aber die Vagina bleibt intakt?
Romer: Es gibt zunehmend Trans-Personen, die sich für einen solchen Weg entscheiden, ja.
Das soziale Umfeld ist gefragt
Deutschlandfunk Kultur: Gibt es denn überhaupt Menschen, die unter dieser Geschlechts-Inkongruenz nicht leiden? Also: Liegt es am gesellschaftlichen Umfeld, ob ich leide oder nicht? Oder spielt das für die Geschlechtsidentität dann vielleicht doch keine Rolle?
Romer: Ich würde sagen, das ist eine sehr komplexe Wechselwirkung. Je mehr das soziale Umfeld sich auf geschlechtliche Nonkonformität, wie wir es nennen, einstellt und tolerant wird, desto mehr wird auch Leidensdruck von Betroffenen genommen, und zwar im Bereich des sozial bedingten Leidensdruckes. Ich habe schon die Transition eines Trans-Jungen auf einem katholischen Mädchengymnasium begleitet, der es geschafft hat, mit seinem selbstverständlichen Auftreten das gesamte Lehrerkollegium, alle Mitschüler, alle Eltern hinter sich zu bringen. Die haben gesagt, "du gehörst zu uns". Und dann durfte er als erster Trans-Junge mit 19 auf diesem katholischen Mädchengymnasium sein Abitur machen.
Das sind ganz wunderbare Verläufe, die ganz viel Druck rausnehmen. Es bleibt aber bei vielen Betroffenen das Leiden am eigenen Körper. Das lässt sich mit sozialer Toleranz nicht ausgleichen. Die können den Anblick im Spiegel nicht ertragen. Eine Menstruation wird zur Qual. Sie können sich nicht im Intimbereich anfassen, weil das Störgefühl einfach nicht zur Ruhe kommt.
Das muss man ernst nehmen. Das hat für sich keinen Krankheitswert, aber die sekundären Belastungssymptome – dass man davon depressiv werden kann – die haben natürlich Krankheitswert. Und das nennen wir dann Geschlechtsdysphorie.
Psychische Folgen machen krank
Deutschlandfunk Kultur: Das ist dann auch der Grund, warum die Krankenkassen die Kosten einer Behandlung übernehmen, nehme ich an. Denn wenn die Transidentität selbst nicht als Krankheit gilt, dann dürfte das ja eigentlich nicht sein.
Romer: Da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, das im Fluss begriffen ist. Natürlich gibt es Befürchtungen, dass das Sozialrecht irgendwann diesen Krankheitswert nicht mehr anerkennen könnte. Solange die Transsexualität als solche als Krankheit galt, war das kein Problem. Heute haben wir genau diese differenzierte Sichtweise, dass die psychischen Folgeerscheinungen Krankheitswert haben, aber die dahinterstehende Identität nicht. Und die Krankenkassen folgen bislang diesem Ansatz, sodass es da sozialrechtlich nach wie vor keine Probleme gibt, weil die Geschlechtsdysphorie als Krankheit anerkannt ist.
Im Übrigen kann man aber auch sagen: Schwangerschaft ist auch keine Krankheit und Geburt auch nicht. Und alles, was an medizinischer Unterstützung zur Aufrechterhaltung von Gesundheit in Schwangerschaft und um die Geburt herum nötig ist, wird von Krankenkassen gezahlt. Möglicherweise wird man für den Personenkreis sexueller Minderheiten auch ähnliche Statusregelungen im Sozialrecht noch kreieren müssen in der Zukunft.
Diagnostik ja, Therapiepflicht nein
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben eingangs gesagt, Sie seien kein "Selbstbedienungsladen". Sie beharren, wenn ich Sie richtig interpretiere, damit auf der Notwendigkeit einer psychiatrischen, psychotherapeutischen Begleitung eines möglichen Prozesses einer Geschlechtsumwandlung, einer Geschlechtsangleichung.
Jetzt gibt es Forderungen aus Transgender-Kreisen, dass der individuelle Wille ausreichen soll, wenn man das Geschlecht wechseln will. Nicht nur beim Eintrag im Personalausweis - da muss man nach wie vor Gutachten vorlegen –, sondern eben auch für das ganze medizinische Prozedere.
Romer: Wir vertreten die Ansicht, dass eine fachgerechte Begleitung unverzichtbar ist. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit der althergebrachten Therapiepflicht. Wenn es einem jungen Menschen, dem es vielleicht mit seiner Transidentität aufgrund der Unterstützung durch die Eltern, aufgrund der Akzeptanz im schulischen Umfeld, der die Unterstützung einer Hormonbehandlung bekommt, so gut geht, dass er als selbstbewusster junger Mensch da durchmarschiert und überhaupt keine Psychotherapie braucht, gibt es keinen Grund, sie von ihm zu verlangen, damit er hinterher Zugang zu operativer Behandlung erfährt, wie das früher der Fall war.
Auch hier ist ein ganz individualisiertes Vorgehen gefragt. Wir bieten psychotherapeutische Unterstützung an für die, die davon profitieren, die vielleicht auch in der Selbstfindung noch mehr Zeit brauchen. Aber die diagnostische Einschätzung – dass man über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten nach einer Erstvorstellung im Dialog mit Eltern und den betroffenen Jugendlichen den Weg als solchen sondiert, um zu einer Einschätzung zu kommen –, die ist nicht gleichbedeutend mit Gutachten, sondern die ist gleichbedeutend mit einer sorgfältigen Diagnosestellung.
Deutschlandfunk Kultur: Würden Sie das auch für Erwachsene anwenden?
Romer: Auch bei Erwachsenen braucht es eine Diagnosestellung. Wobei das Empfinden über die eigene Identität so urpersönlicher Natur ist, dass am Ende des Tages natürlich nur das Individuum selbst für sich entscheiden kann.
Den Zugang zur Behandlung generell an ein Nadelöhr einer Begutachtung zu hängen, ist ethisch nicht mehr statthaft.
Mehr biologische Mädchen wollen das Geschlecht ändern
Deutschlandfunk Kultur: Es gibt eine Tatsache, die mich doch beunruhigt, nämlich, dass offenbar wesentlich mehr biologische Mädchen das Geschlecht wechseln wollen als biologische Jungen.
Romer: Wir machen diese Beobachtung. Das ist richtig. Das hat auch zu einer Diskussion über von jugendlichen Subkulturen getriggerte Modeerscheinungen geführt, für die es aber wiederum empirisch keinerlei Belege gibt.
Das Interessante bei diesem Phänomen ist, dass es nach neueren Daten auch bei den ausführlichen Begutachtungen zu Namens- und Personenstandsänderungen diesen Trend gibt. Die sind nach wie vor so geregelt, dass zwei voneinander unabhängige psychiatrische Gutachter in umfangreichen Gesprächen im Einzelfall überprüfen müssen, ob die betreffende Person seit mindestens drei Jahren in der inneren festen Überzeugung lebt, sich dem anderen Geschlecht zugehörig zu fühlen und dass sich daran nichts mehr ändern wird und dass das gut durchreflektiert ist.
Wir wissen letztlich nicht, woran es liegt. Eine mögliche Erklärung ist, dass im Zuge der allgemein steigenden Akzeptanz für die Transidentität die Trans-Jungen selbstbewusster voranschreiten und früher in Erscheinung treten. Das müsste sich dann aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren durch eine entsprechende Entwicklung bewahrheiten, dass die Trans-Frauen, also die geburtsgeschlechtlichen Jungen, dann nachziehen und ebenso häufig irgendwann aufschlagen. – Das wissen wir letztlich noch nicht.
Selbsthass oder Avantgarde?
Deutschlandfunk Kultur: Meine Assoziation lautete sofort, dass es eine sehr lange und unrühmliche Tradition des weiblichen Körperselbsthasses gibt und die Stellung der Frau in der Gesellschaft trotz aller Anstrengungen immer noch eine andere ist, als ein Mann zu sein.
Romer: Verzeihen Sie. Das halte ich für nicht gut belegt. Das ist sehr plakativ, so zu argumentieren – aus meiner Sicht. Wir haben vor dreißig Jahren beim Abitur 50:50 junge Mädchen gehabt. Wir sind mittlerweile im Abitur bei 60:40 zugunsten der Mädchen. Bei Medizinstudienanfängerinnen 70:30 junge Frauen. Junge Mädchen bekommen, egal wie sie sich aufstellen, ob sie sich für Kfz-Mechatronik und Autos interessieren oder ob sie gerne rosa Kleidchen tragen wollen, von allen Seiten im postfeministischen Zeitalter die Signale: "Du bist ein prima Mädchen."
Ich sehe eher eine wachsende Verunsicherung der heranwachsenden Jungen, die sich hinter den Stoppschildern "Vorsicht Weichei" oder "Vorsicht Macho" viel schwerer tun, Männerbilder zu entwickeln, die wirklich im Umfeld sozial gut akzeptiert sind.
Es gibt keinen Anhalt dafür, dass die Weiblichkeit in ihrer Vielfalt ein schwereres Schicksal sein soll.
Mehr Akzeptanz für Vielfalt!
Deutschlandfunk Kultur: Ein weites Feld, sage ich mal diplomatisch, für das uns die Zeit fehlt, uns auf diesem weiter die Klingen kreuzen zu lassen. – Schlussfrage: Wenn Sie etwas ändern könnten für die Trans-Menschen in Deutschland, was wäre das?
Romer: Es hat sich in den letzten zwanzig Jahren viel getan in Richtung Toleranz und Akzeptanz. Es gibt aber noch sehr viele Diskriminierungserfahrungen für Betroffene. Von daher wünsche ich mir für Trans-Menschen, dass es in allen Bereichen der Gesellschaft eine selbstverständlichere Kultur der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt gibt.