Pumpen bis ultimo
30:35 Minuten

Qualmende Schlote und Flugasche: Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt galt lange als "schmutzigster Ort Europas". 30 Jahre nach dem Fall der Mauer warten immer noch 200 Millionen Kubikmeter giftiges Grundwasser auf Sanierung.
Über eine Seepromenade zu flanieren, mit seinem Boot in der Marina vor Anker zu gehen – all das verband man mit vielen Orten, aber ganz gewiss nicht mit Bitterfeld im DDR-Chemiedreieck. Helmut Kohls prophezeite blühende Landschaften sind wahr geworden. Doch sollte es tatsächlich möglich gewesen sein, in 30 Jahren den schmutzigsten Ort Europas in ein Naherholungsgebiet zu verwandeln? Zweifel sind angebracht, findet Fred Walkow. Kaum einer kennt das geschundene Braunkohle- und Industrierevier so gut wie er.
Bestandsaufnahme nach der Wende
Der promovierte Chemiker wechselte 1990 in das Umweltamt beim Landkreis Bitterfeld, wurde dessen Chef. Und eckte erst einmal an, als er kurz nach der Wiedervereinigung eine Bestandsaufnahme aller Belastungen im Kreis Bitterfeld initiierte. Er war nicht auf eine Skandalisierung aus, sondern wollte endlich Schluss machen mit dem jahrzehntelangen Totschweigen der Umweltsünden. Er berief eine Umweltkonferenz ein, mit der er sich damals vor allem bei der Industrie-und Handelskammer (IHK) keineswegs nur Freunde machte.
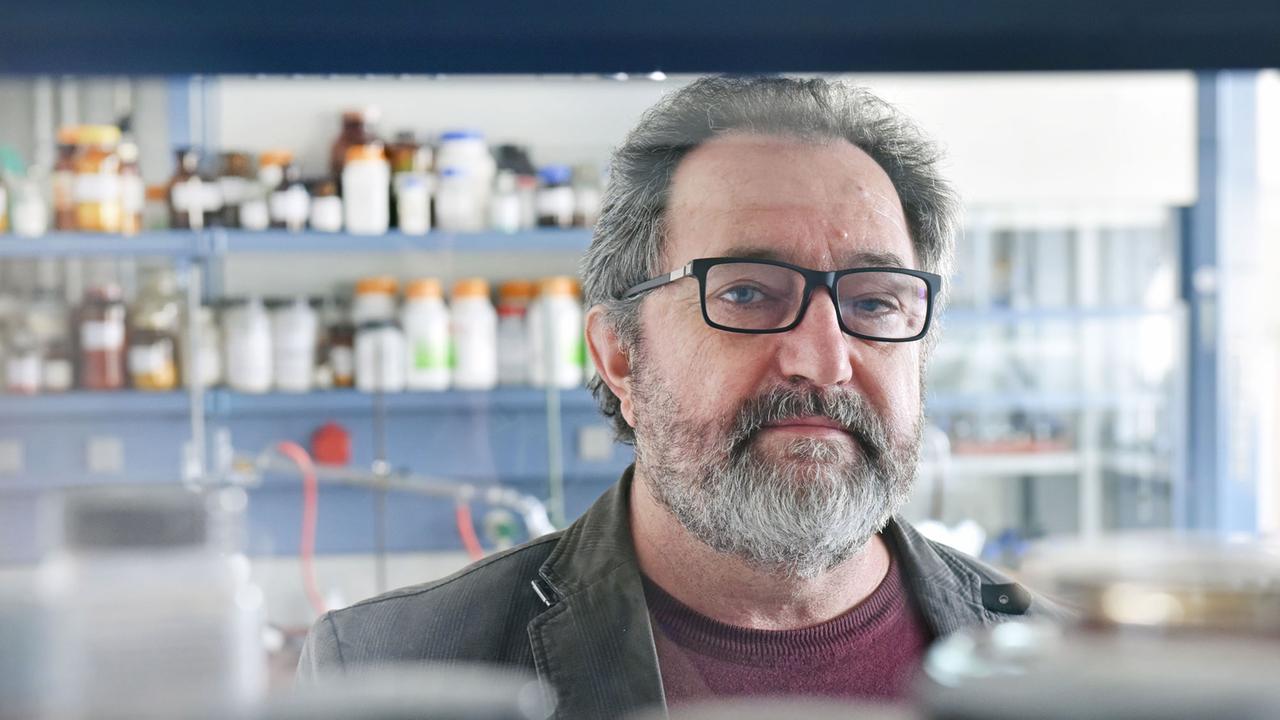
Bis 2015 war Fred Walkow Umweltdezernent des Landkreises Anhalt-Bitterfeld© André Kehrer
"Dieses Vorhaben der Umweltkonferenz ist teilweise heftig bekämpft worden von der IHK. Wie blöd wir doch sind, alles so offen darzustellen. Das gab's auch teilweise in der Bevölkerung. Es war durchaus nicht so, dass hier in Bitterfeld, weil wir ein Problem hatten, ein verschärftes Bewusstsein dafür da war. Im Gegenteil. Man ahnte natürlich früh, dass das noch Auswirkungen auf Arbeitsplätze haben könnte. Da wurde schon heftig geblockt und wir hatten da etwas keck das Motto für die öffentliche Diskussion: Stellen Sie jetzt die Fragen, für die Sie früher nach Bautzen gekommen wären."
Die damalige Bestandsaufnahme ist noch heute Bezugsgröße für das Davor und Danach der Sanierung. Auch wenn sich das ganze Ausmaß der Verschmutzung erst nach und nach offenbarte.
Zwei, drei Talsperren Giftbrühe
Fred Walkow zeigt mir die berüchtigte Grube Antonie zwischen Bitterfeld und Wolfen, rechterhand hinter der sogenannten Säurekreuzung, wo früher direkt an der Straße dicht gedrängt mehrere Schornsteine standen. Der schlimmste blies beständig orange-gelbe Schwaden in die Luft, Stickstoffdioxid. Am Eingang steht ein Schild: Industriedeponie Antonie, das Tor ist zu, bis auf einen asphaltierten Weg ist von der Giftmülldeponie rein äußerlich nichts zu erkennen. Das größte Problem ist ohnehin nicht von oben auszumachen: nämlich dass diese Deponie wie alle unten undicht ist.
"Das Problem ist, dass sie eine ständige Quelle der Grundwasserkontamination ist. Sie ist 20 Meter tief und der Deponie-Fuß steht komplett im Grundwasser und wird permanent von Grundwasser durchströmt. Was hier alles reingegangen ist, weiß keiner ganz genau. Man geht von 70.000 Tonnen aus, aus der HCH- und aus der DDT-Produktion. HCH, Lindan ist vielleicht ein Begriff. Was also hier zu beobachten war: Es gab also Wildschweine und auch Vögel, die sich in dem offen anstehenden HCH suhlten, um damit ihre Schädlinge zu bekämpfen."

Holger Weiß, Grundwasserexperte beim Helmholtz-Zentrum Leipzig, rechnet mit einer Verschmutzung im Volumen von zwei Talsperren. © Deutschlandradio / Sabine Adler
Das Helmholtz-Zentrum Leipzig verzeichnet unter anderem 76.000 Tonnen HCH aus der Lindan-Produktion, 70.000 Tonnen Schwefelsäure, die direkt aus Eisenbahnkesselwaggons über Schläuche in die Deponie Antonie abgelassen wurden. Holger Weiß öffnet ein Schraubglas mit einer braunen Brühe:
"Es ist offensichtlich, dass Grundwasser so nicht aussehen und so nicht riechen sollte."
Der Grundwasserexperte vom Helmholtz-Zentrum zeigt auf eine Karte. Die Giftmülldeponie Antonie ist darauf verschwindend klein, wie die Spitze eines Eisbergs. Der verschmutzte Untergrund darunter um ein Vielfaches größer.
"Also, wir reden von einer Fläche, die vielleicht zehn Kilometer Nord-Süd-Erstreckung und zwei bis drei Kilometer Ost-West-Erstreckung hat, wenn Sie den Fluss Mulde als Begrenzung nehmen. Und von bis zu 70 Metern unter Gelände. Dann kommen Sie eben auf ein Volumen von bis zu 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser, das belastet ist. Das sind also zwei, drei Talsperren. "
An die Deponien wagt sich keiner ran
Der Chemiestandort Bitterfeld mit all seinen qualmenden Schornsteinen galt zu DDR-Zeiten als schmutzigste Stadt Europas. Die Gefahr heute ist nicht sichtbar, sie steckt im völlig vergifteten Grundwasser. Das ist selbst manchem Einheimischen kaum bewusst, obwohl niemand seinen Garten mit Brunnenwasser gießen darf und das Trinkwasser schon seit Jahrzehnten per Fernleitung kommt.
Das Gift aus den Industriedeponien suppt unablässig weiter ins Grundwasser. In der Schweiz müssen die Chemiekonzerne solche Gruben ausbaggern und die toxischen Abfälle in Sondermüllverbrennungsanlagen bringen. Anders in Bitterfeld-Wolfen: Nach dem Abriss der alten Chemiebetriebe wurde zwar oft auch das Erdreich entfernt und mit ihm Quecksilber, Chlorbenzole, DDT und HCH aus der Insektizid- und Pestizidproduktion. Doch an die größten Quellen der Verschmutzung, die Deponien, wagt sich keiner heran, obwohl dort die Gifte in riesigen Mengen liegen. Die landeseigene Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungs GmbH wäre zuständig. Geschäftsführer Harald Rötschke erklärt, was sie abschreckt:
"Wenn Sie alles wegnehmen wollen, müssten Sie das ganze Gebiet auskoffern, acht Quadratkilometer, 40 Meter tief. Unmöglich."
Die Sanierer kapitulieren vor der schieren Größe des verschmutzten Areals. Der Schweizer Geograf und Altlasten-Experte Martin Forter plädiert dennoch für das Ausbaggern der Deponie:
"Wenn man diese Deponie ausgraben würde, dann würde man die Quelle beseitigen. Und wenn die Quelle beseitigt ist, kann man sich in aller Ruhe an das Grundwasser machen. Vorher macht es keinen Sinn, weil immer Schadstoffe von der Deponie nachlaufen."

Altlastenexperte Martin Forter aus der Schweiz fordert, den Giftmüll abzutragen. © Dave Joss
Zusammen mit Umweltverbänden und Kommunen hat Martin Forter in und um Basel bewirkt, dass Firmen wie BASF alte Giftmüll-Deponien beseitigen mussten. Was in der größten Bitterfelder Deponie Antonie entsorgt wurde, hat niemand vollständig analysiert. Trotzdem behaupteten die Sanierungsgesellschaft und deren Aufsichtsbehörde, die Landesanstalt für Altlastenfreistellung, dass alle Stoffe bekannt seien.
Auf die Bitte, dann die Liste der Stoffe zur Verfügung zu stellen, erfolgte Abwehr. Es hieß, dass das wohl kaum für eine Reportage nötig sei. Schließlich gehe es nicht um eine Dissertation. Auf erneute Aufforderung ruderten die Behördenvertreter schließlich zurück: Eine vollständige Liste der Abfälle existiere nicht. Sie schlagen ein Treffen an der Giftmülldeponie Antonie vor. Für die Landesanstalt erscheint deren Chef Jürgen Stadelmann, der erklärt, dass derzeit getan werde, was machbar und finanzierbar sei. Das Ausbaggern der toxischen Abfälle aus der Grube Antonie gehört nicht dazu.
Phenol im Biosphärengebiet
"Es gab ein Forschungsprojekt, da wurde Anfang der 1990er-Jahre festgestellt, dass das hier über eine Milliarde DM kosten würde. Sachsen-Anhalt hat über einen Generalvertrag mit dem Bund insgesamt für alle Altlasten eine Milliarde Euro erhalten. Jetzt können Sie sich die Verhältnismäßigkeit leicht ausrechnen: Das ist unmöglich."
Der Schweizer Altlastenexperte Forter findet: Höchste Zeit umzudenken.
"Man hat lange in Deutschland und in der Schweiz gemeint, man könnte solche Deponien langfristig kontrollieren. Das kostet nur unendlich viel Geld, aber löst das Problem nie."
200 Millionen Kubikmeter giftiges Grundwasser in Bitterfeld warten 30 Jahre nach dem Fall der Mauer noch immer auf Sanierung.

Zu DDR-Zeiten war es üblich, Schwefelsäure aus Kesselwaren in die Giftmülldeponie Antonie abzulassen.© MDSE
Nicht selten tauchen die schweren, mit Salz versetzten Chlorverbindungen an ganz unerwarteten Stellen wieder auf. Im Auenwald in der Nähe des Flusses Mulde zum Beispiel. Dort, wo nie ein Chemiebetrieb gestanden hat. Im Biosphärengebiet.
Es ist paradox: Während in Bitterfeld und Wolfen kaum ein Quadratkilometer unbebaut und sauber blieb, wähnt man sich drei Kilometer weiter, in der Muldeaue, in unberührter Natur. Eine Landschaft mit Birken, Wiesen und Flussarmen, die sich durch den Auenwald schlängeln. Biber sind hier zu Hause. Doch der Schein trügt, die eigene Nase allerdings nicht, denn mitten in dieser Idylle riecht es nach Chemie, nach Phenol, genauer gesagt. Von zahlreichen Naturschutzschildern des 1990 ausgewiesenen Biosphärenreservats fühlt man sich in die Irre geführt.
Das Heu auf den Wiesen hier darf nicht verfüttert werden. Die Auenlandschaft ist alles andere als naturbelassen. Gerade die moorartigen Böden nehmen wie ein Schwamm die Chemieschadstoffe auf. Bei jedem Hochwasser werden sie neu verteilt.
Waren Wissenschaftler in Bitterfeld und Wolfen früher vor allem für die Entwicklung von Produkten und ihre Herstellung tätig, beschäftigen sie sich heute vorwiegend mit den Folgeschäden, die Bergbau, Chemie, aber auch Rüstungsindustrie hinterlassen haben. Während des Zweiten Weltkrieges wurde in Bitterfeld auch Magnesium für die Flugzeugherstellung produziert. Daher stammen die Dioxine, die sich über die Region hinaus verbreiten, unter anderem über das Spittelwasser, einen kleinen Zufluss der Mulde. Der Bach fließt flink durch die Auenlandschaft. Mit Fred Walkow stehe ich an einer kleinen Brücke, wo sich das Wasser staut.
Dioxine wandern bis in die Nordsee
"500 Meter flussabwärts ist eine Stelle, die wie ein See aussieht. Dort war die höchste Belastung mit Sedimenten", sagt Walkow. "Die Dioxinbelastung ist ja eine Folge des Zweiten Weltkrieges, der Magnesiumproduktion, die hier 1944/45 extrem hoch war. Und da wurde eine Technologie eingesetzt, bei der Dioxine entstanden. Die wurden durch das Abwasser verspült und deswegen findet man kaum Dioxinspuren am eigentlichen Entstehungsort, dafür aber außerhalb."
Da heißt es, dass auf einer Strecke von 900 Metern in einem Flöz von zwei Metern Sedimente, die stark mit Dioxinen belastet waren, abgelagert waren. Und jetzt hat sich das Problem buchstäblich aufgelöst?
"Aufgelöst nicht, das sind ja unlösliche Sedimente. Das ist einfach nur mechanisch durch den Druck des Hochwassers von 2002 und 2013 flussabwärts gespült worden."
Damals haben Wissenschaftler gesagt, dass dieses Dioxinflöz abgetragen werden muss. Das klingt ja ein bisschen so, dass sich aussitzen lohnt.
"Ja, im Ergebnis muss man das leider so sagen."
Und jetzt haben andere Regionen das Problem.
"Das sind alle die, die flussabwärts wohnen. Das beginnt also mit Dessau, mit Magdeburg, mit Hamburg, und auch bis zu Nordsee sind die Dioxine getragen worden."

Zeitunglesen mit Gasmaske: Eine Frau in der Nähe der Grube Antonie© Deutschlandradio / Fred Walkow
Ein Drittel der Einwohner ist weggezogen
Ein Müllauto zieht seine Runde durch Greppin. Dass der Ort einmal der dreckigste Europas war, sieht man heute noch an den Fassaden, wenn auch nur noch bei wenigen Einfamilienhäusern. Sie sind Greppin-typisch verrußt, auch die Dachziegel sind schmutzig schwarz. Und noch immer führen meterdicke Industrierohre auf Stelzen mitten durch die Gärten. Doch die Greppiner waren und sind hart im Nehmen, weiß Fred Walkow, der langjährige Chef des Umweltamtes von Bitterfeld, aus eigener Erfahrung:
"Also, die Diskussion mit den Leuten, dass man dort lieber doch keine Hühner halten sollte und keine Kaninchen und Möhren lieber nicht anbauen, schrecklich. Also, hier ist kein Bewusstsein. Solange ich nicht tot umfalle, ist alles in Ordnung. 'Greppiner, die Härtesten Europas' - da gab es so einen Aufkleber, hab ich heute noch als Bild."
Ein Drittel der Einwohner ist weggezogen. Aber es sind auch neue hinzugekommen, der 37-jährige Henrik S. zum Beispiel, der in Arbeitskleidung zur Schicht radelt.
- "Stammen Sie hier aus der Gegend?", frage ich ihn.
- "Nee, ich stamme aus der Merseburger Ecke."
- "Sind Sie hergezogen?"
- "Hergezogen. Es ist doch sauberer geworden hier, als es bis vor ein paar Jahren war. Mich stört es nicht."
- "Arbeiten Sie auch in der Chemieindustrie?"
- "Nee, Textilrecycling."
- "Lebt es sich jetzt gut hier?
- "Ja, es lebt sich sehr gut hier, ich bin zufrieden."
- "Nee, ich stamme aus der Merseburger Ecke."
- "Sind Sie hergezogen?"
- "Hergezogen. Es ist doch sauberer geworden hier, als es bis vor ein paar Jahren war. Mich stört es nicht."
- "Arbeiten Sie auch in der Chemieindustrie?"
- "Nee, Textilrecycling."
- "Lebt es sich jetzt gut hier?
- "Ja, es lebt sich sehr gut hier, ich bin zufrieden."

In Bitterfeld muss das Grundwasser gefiltert und aufbereitet werden.© Deutschlandradio / Sabine Adler
In der Luft hängt ein Geruch wie Klebstoff. Die weit größere Gefahr aber kann der Laie nicht ausmachen: das hochtoxische Grundwasser, das seine Fracht aus den Giftmülldeponien Antonie und Greppin mitbringt. Damit es den 2200 Anwohnern nicht in die Keller läuft, soll 2021 eine Millionen Euro teure unterirdische Wand von 650 Metern Länge und 35 Meter Tiefe gebaut werden. Bis dahin pumpen zehn Brunnen das toxische Grundwasser an die Oberfläche, wo es Aktivkohlefilter reinigen. Doch die Technik fällt wegen der Natronlauge im Grundwasser ständig aus, muss immerzu erneuert werden. Es kostet ein Vermögen, schmutziges Grundwasser an Greppin vorbeizuleiten.
Die Benutzung von privaten Trinkwasserbrunnen empfiehlt sich weder in Greppin noch woanders in Bitterfeld-Wolfen. Der promovierte Chemiker Fred Walkow erklärt, warum.
"Trinkwasser wird hier schon ewig nicht mehr gewonnen. Das hat einfach mit der Pyrit-Verwitterung was zu tun. Den Bergbau gab es ja schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen: Wenn man sich mit Seife gewaschen hat, dann fiel da immer so ein krisseliges Zeug aus. Das ist durch das Sulfat. Und das schmeckt auch nicht, das Grundwasser. Den ersten Prozess wegen verschmutztem Grundwasser gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg. Da hat ein Bauer in Greppin gegen die Farbenwerke geklagt, weil die seinen Brunnen verschmutzt hatten. Und der kriegte dann sauberes Wasser geliefert. Zu DDR-Zeiten gab's ja dieses Fernwasser, diese Fernwasserversorgung. Da war Bitterfeld immer mit dabei. Also, da gibt's zwei Quellen. Einmal das Uferfiltrat von der Elbe und dann vom Harz."
Gespräch mit einem, der nicht weg will
So ist es bis heute. All das kann Klaus Hausmann nichts anhaben. Der große hagere Mann, Schlosser von Beruf, will nicht weg aus Greppin.
- "Ich habe früher hier gearbeitet, bis zur Rente. Jetzt bin ich Rentner, warum soll ich da weggehen?"
- "Ich sage Ihnen ja nichts Neues, das wissen wir beide, dass die Stadt mal als die schmutzigste Europas oder sogar der Welt gegolten hat."
- "Ich habe ja 40 Jahre in der Chemie gearbeitet."
- "Lebt es sich jetzt gut in Greppin?"
- "Jetzt ja, früher hat es jeden Tag anders gerochen."
- "Und früher war Ihr Haus auch nicht so schön gelb wie jetzt."
- "Da war ja alles grau, die Häuser, die Dächer, alles grau."
- "Und konnten Sie ihr Haus billig kaufen?"
- "Das ist seitdem es gebaut war, immer im Familienbesitz."
- "Sie haben es immer schon besessen. Also Ihnen würde es nicht einfallen, wegen der Umweltbelastung wegzuziehen?"
- "Jetzt sowieso nicht mehr. Wohin?"
- "Merkt man noch etwas von der Umweltbelastung?"
- "Jetzt nicht mehr, nö."
- "Haben Sie auch einen Garten, in dem Sie auch Gemüse anbauen?"
- "Zu DDR-Zeiten haben wir hier Gemüse gehabt und haben es auch überlebt."
- "Und Sie hatten nicht die Sorge, dass …"
- "Nö, warum?"
- "Naja, das war ja auch zu DDR-Zeiten bekannt, dass es nicht gerade eine ökologisch saubere Region war."
- "Muss es ja gewesen sein, sonst wäre ja meine Mutter nicht 92 Jahre geworden. Aber tut mir leid, ich muss jetzt los."
- "Ich sage Ihnen ja nichts Neues, das wissen wir beide, dass die Stadt mal als die schmutzigste Europas oder sogar der Welt gegolten hat."
- "Ich habe ja 40 Jahre in der Chemie gearbeitet."
- "Lebt es sich jetzt gut in Greppin?"
- "Jetzt ja, früher hat es jeden Tag anders gerochen."
- "Und früher war Ihr Haus auch nicht so schön gelb wie jetzt."
- "Da war ja alles grau, die Häuser, die Dächer, alles grau."
- "Und konnten Sie ihr Haus billig kaufen?"
- "Das ist seitdem es gebaut war, immer im Familienbesitz."
- "Sie haben es immer schon besessen. Also Ihnen würde es nicht einfallen, wegen der Umweltbelastung wegzuziehen?"
- "Jetzt sowieso nicht mehr. Wohin?"
- "Merkt man noch etwas von der Umweltbelastung?"
- "Jetzt nicht mehr, nö."
- "Haben Sie auch einen Garten, in dem Sie auch Gemüse anbauen?"
- "Zu DDR-Zeiten haben wir hier Gemüse gehabt und haben es auch überlebt."
- "Und Sie hatten nicht die Sorge, dass …"
- "Nö, warum?"
- "Naja, das war ja auch zu DDR-Zeiten bekannt, dass es nicht gerade eine ökologisch saubere Region war."
- "Muss es ja gewesen sein, sonst wäre ja meine Mutter nicht 92 Jahre geworden. Aber tut mir leid, ich muss jetzt los."
Zu den größten Umweltsündern in Bitterfeld gehörten das CKB, das Chemiekombinat Bitterfeld, zudem das Braunkohlekraftwerk und eine Brikettfabrik. Für immer neue Industriebauten wurde Kies gefördert. War eine Kiesgrube leer, durften Arbeiter und Angestellte in der Grube billig Land kaufen und ebendort Eigenheime bauen. 1920 entstanden so die Arbeitersiedlungen Annahof und Bergmannshof. In der Annastraße wohnt Gerhard Zeder seit 1967.
Eine Dichtwand gegen das Grundwasser
In Annahof/Bergmannshof ist man zwar Kummer gewohnt, denn die Siedlung war immer eine Dreckecke, sagt Gerhard Zeder. Aber kam das Ungemach früher vor allem von oben aus den Schornsteinen, so erreicht es heute rund 20 der 50 Häuser von unten. Denn das zurückkehrende Grundwasser ist giftig und bringt krebserregende Chlorbenzole, leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie man sie für Lösungsmittel braucht, in die Häuser. Damit die stinkende, toxische Fracht nicht in die Keller steigt, wurden neue Pumpen installiert und eine 23 Meter tiefe Dichtwand. So soll der Grundwasserpegel niedrig gehalten werden.

Die Bitterfelder Siedlung Annahof/Bergmannshof wird mit einer unterirdischen Dichtwand gegen das giftige Grundwasser geschützt.© Deutschlandradio / Sabine Adler
Gerhard Zeder, der 76-jährige Rentner, kennt den früheren Umweltdezernenten Walkow und die Materie. Er bittet ins Haus, das sein ganzer Stolz ist. Als jahrzehntelanger Mieter hat er es 1997 gekauft und seitdem grundsaniert.
"Das war ja eine reine Katastrophe, diese Siedlung hier", sagt er. "Hinten war die Brikett-Fabrik, hinten war das Kraftwerk Süd. Das Kraftwerk Süd hat im Schnitt sieben bis acht Tonnen Flugasche pro Stunde rausgebracht. Seit 1908 hat die Brikett-Fabrik existiert. Ich habe einmal hier 70 Zentimeter Flugasche abgefahren. Und dann habe ich jetzt noch einmal Flugasche abgetragen. Da hatte ich auf dem Mutterboden, den ich damals, 1970, aufgetragen hatte, schon wieder 20 Zentimeter Flugasche."
Er erinnert sich noch, wann es mit dem Wasser angefangen hat:
"Mit dem Wasser begann es wieder 1990/91, als nämlich die Entwässerung in den Tagebauen stillgelegt worden ist. Die Goitzsche – wir hatte dort ja den Wasserspiegel um 30, 40 Meter abgesenkt. Als dann die Pumpen abgestellt wurden, ist das Grundwasser ja wieder angestiegen und dann gab es die Probleme hier, dass man die Leute aussiedeln wollte, die Siedlung abreißen, die Keller verfüllen mit Beton. Durch die Abschaltung der Pumpen ist das Problem gekommen, dass die Leute hier 30, 40 Zentimeter Wasser in den Kellern stehen hatten."
Wusste man, dass das passieren kann?
"Ich sage, ja. Man hat den Leuten erzählt, wir machen das für euch. Es ging nur um das kontaminierte Wasser, was vom CKB hier durch die Siedlung geflossen ist. Die Leute hatten ja das Verbot, Lebensmittel in den Kellern aufzubewahren. Weil das Wasser ausgegast hat. Das waren Giftstoffe. Die ganze Geschichte hier mit der Dichtwand, die 5, 6 Millionen Euro gekostet hat, sind nicht gemacht worden, um die paar Hansel hier vom Grundwasser zu befreien."
Sondern? Seine Vermutung: "Das ist nur wegen der Chemie. Wir haben total vergiftetes Wasser."
Ein Gespräch über umweltpolitisches Engagement
- "Sie kennen sich hier aus, wissen, was hier gebacken ist. Haben Sie jemals daran gedacht, sich politisch zu engagieren?"
- "Ich war zehn Jahre lang im Kreistag, da habe ich dann meinen Hut genommen, nach der Wende. Und seitdem habe ich mich in diese Sachen nicht mehr reingehängt."
- "Menschen wie Sie kennen die Situation ziemlich genau, Sie haben auch eine Idee, was man machen könnte, was nötig ist und was nicht nötig ist. Es protestiert niemand, es interessiert sich niemand, es engagiert sich niemand. Warum? Erklären Sie es mir."
- "Kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt bloß von mir aus. In den zehn Jahren, in denen ich im Umweltschutz waren, waren wir ja mehr als aktiv."
- "Aber in der DDR konnten Sie doch überhaupt nichts ausrichten."
- "Nein, das hat ja nichts gebracht. Und erfahren haben wir ja sowieso nicht, was wirklich war mit diesen ganzen Umweltsünden."
- "Ihnen waren die Hände gebunden, da haben Sie sich engagiert. Dann waren Ihnen nicht mehr die Hände gebunden, da haben Sie aufgehört? Also, richtig logisch ist das nicht."
- "Mag sein, dass es nicht logisch ist, aber es war so. Ich habe nie aufgehört, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen."
- "Um diese Siedlung hier zu schützen und Ihnen das Weiterleben hier zu ermöglichen, wird ja viel Geld ausgegeben. Das könnte man ja auch mal honorieren. Sagen die Leute: Ja, die Politik macht was für uns?"
- "Sie sind erst einmal zufrieden, die Leute, dass sie kein Wasser mehr in den Kellern haben. Das ist erst einmal das wichtigste für sie. Egal, ob das Wasser kontaminiert war oder nicht. Für sie war entscheidend: Das Wasser ist gefallen."
- "Beunruhigt Sie das, dass das Grundwasser so schmutzig ist?"
- "Eigentlich nicht."
- "Die Werbemanager sprechen von der hohen Chemietoleranz der Bevölkerung hier. Und hier sitzt ja ein lebendes Beispiel vor mir. Wie ist das eigentlich mit der Gesundheit der Nachbarn?"
- "Die waren früher gesünder. Also die Großeltern, die hier gewohnt haben, sind 88, 89 geworden. Die alten Leute in der Siedlung, es wohnen jetzt noch Leute dort mit 92, 94 Jahren. Ich kann nicht sagen, dass irgendwelche Krankheiten hier auf Grund dieser Dreckecke hier gibt, und das war ja 'ne schlimme Dreckecke hier."
- "Ich war zehn Jahre lang im Kreistag, da habe ich dann meinen Hut genommen, nach der Wende. Und seitdem habe ich mich in diese Sachen nicht mehr reingehängt."
- "Menschen wie Sie kennen die Situation ziemlich genau, Sie haben auch eine Idee, was man machen könnte, was nötig ist und was nicht nötig ist. Es protestiert niemand, es interessiert sich niemand, es engagiert sich niemand. Warum? Erklären Sie es mir."
- "Kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt bloß von mir aus. In den zehn Jahren, in denen ich im Umweltschutz waren, waren wir ja mehr als aktiv."
- "Aber in der DDR konnten Sie doch überhaupt nichts ausrichten."
- "Nein, das hat ja nichts gebracht. Und erfahren haben wir ja sowieso nicht, was wirklich war mit diesen ganzen Umweltsünden."
- "Ihnen waren die Hände gebunden, da haben Sie sich engagiert. Dann waren Ihnen nicht mehr die Hände gebunden, da haben Sie aufgehört? Also, richtig logisch ist das nicht."
- "Mag sein, dass es nicht logisch ist, aber es war so. Ich habe nie aufgehört, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen."
- "Um diese Siedlung hier zu schützen und Ihnen das Weiterleben hier zu ermöglichen, wird ja viel Geld ausgegeben. Das könnte man ja auch mal honorieren. Sagen die Leute: Ja, die Politik macht was für uns?"
- "Sie sind erst einmal zufrieden, die Leute, dass sie kein Wasser mehr in den Kellern haben. Das ist erst einmal das wichtigste für sie. Egal, ob das Wasser kontaminiert war oder nicht. Für sie war entscheidend: Das Wasser ist gefallen."
- "Beunruhigt Sie das, dass das Grundwasser so schmutzig ist?"
- "Eigentlich nicht."
- "Die Werbemanager sprechen von der hohen Chemietoleranz der Bevölkerung hier. Und hier sitzt ja ein lebendes Beispiel vor mir. Wie ist das eigentlich mit der Gesundheit der Nachbarn?"
- "Die waren früher gesünder. Also die Großeltern, die hier gewohnt haben, sind 88, 89 geworden. Die alten Leute in der Siedlung, es wohnen jetzt noch Leute dort mit 92, 94 Jahren. Ich kann nicht sagen, dass irgendwelche Krankheiten hier auf Grund dieser Dreckecke hier gibt, und das war ja 'ne schlimme Dreckecke hier."
Blühende Landschaft auf belastetem Boden
Die Region Bitterfeld-Wolfen, einst ökologisches Notstandsgebiet, ist eine blühende Landschaft geworden, wenngleich auf belastetem Boden. Auf dem Bitterfelder Berg, der in Wahrheit eine Abraumhalde ist, installierte der Künstler Klaus Puri 2006 den sogenannten Bitterfelder Bogen. Eine Art Aussichtsplattform, deren Gestalt an die Schaufeln der Bagger im Tagebau erinnern soll. Der Wechsel von nach unten bzw. nach oben geöffneten Bögen ist eine Reminiszenz an die Halden und Gruben. Mancher erkennt in der Form auch Schmetterlingsflügel, die für die Wiederbelebung der Natur in der geschundenen Landschaft stehen. Ich habe mich mit Werner Rauball und Armin Schenk verabredet, der eine, SPD, kam aus dem Westen, Nordrhein-Westfalen und war 14 Jahre lang Bürger- bzw. Oberbürgermeister in Bitterfeld, der andere, Armin Schenk, CDU, ist es seit drei Jahren.

Noch heute steht am "Silbersee" ein altes Verbotsschild aus DDR-Zeiten.© Deutschlandradio / Fred Walkow
Ich frage sie, warum es hier nur relativ wenige öffentliche Diskussionen zu Umweltfragen gibt.
"Schwierige Frage", sagt Schenk. "Also, ich bin überzeugt, dass diese Diskussion gleich nach der Wende, wo dieses Thema eine große Bedeutung gehabt hätte, haben sich die Menschen zunächst andere Fragen gestellt. Sie hatten keine Arbeit oder haben zum Teil ihre eigenen Gebäude und Anlagen abgerissen. Viele haben den Weg woanders genommen, da war das kein Thema."
Und Rauball meint: "Ich glaube, weil die Leute zwar wussten, dass Bitterfeld die schmutzigste Stadt Europas war, aber die technischen Lösungen zu erkennen und umzusetzen, das ist sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, das ist ein Punkt, weshalb die Menschen sagen: interessiert mich nicht. Macht mal, aber das interessiert mich nicht."




