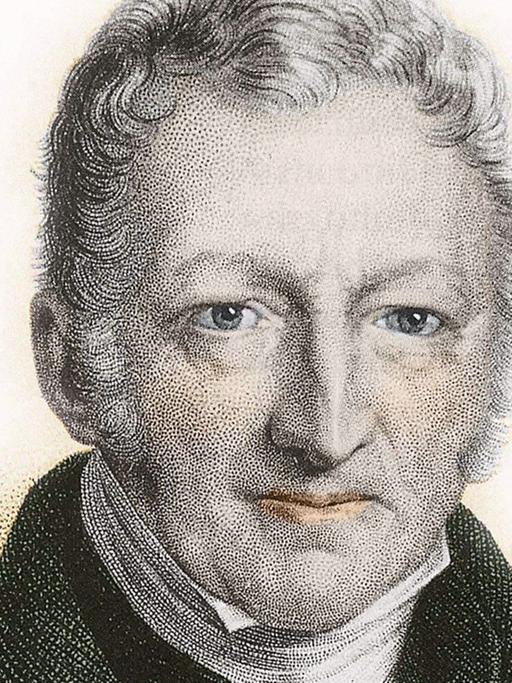Giorgos Kallis: „Grenzen. Warum Malthus falsch lag und warum uns das alle angeht“
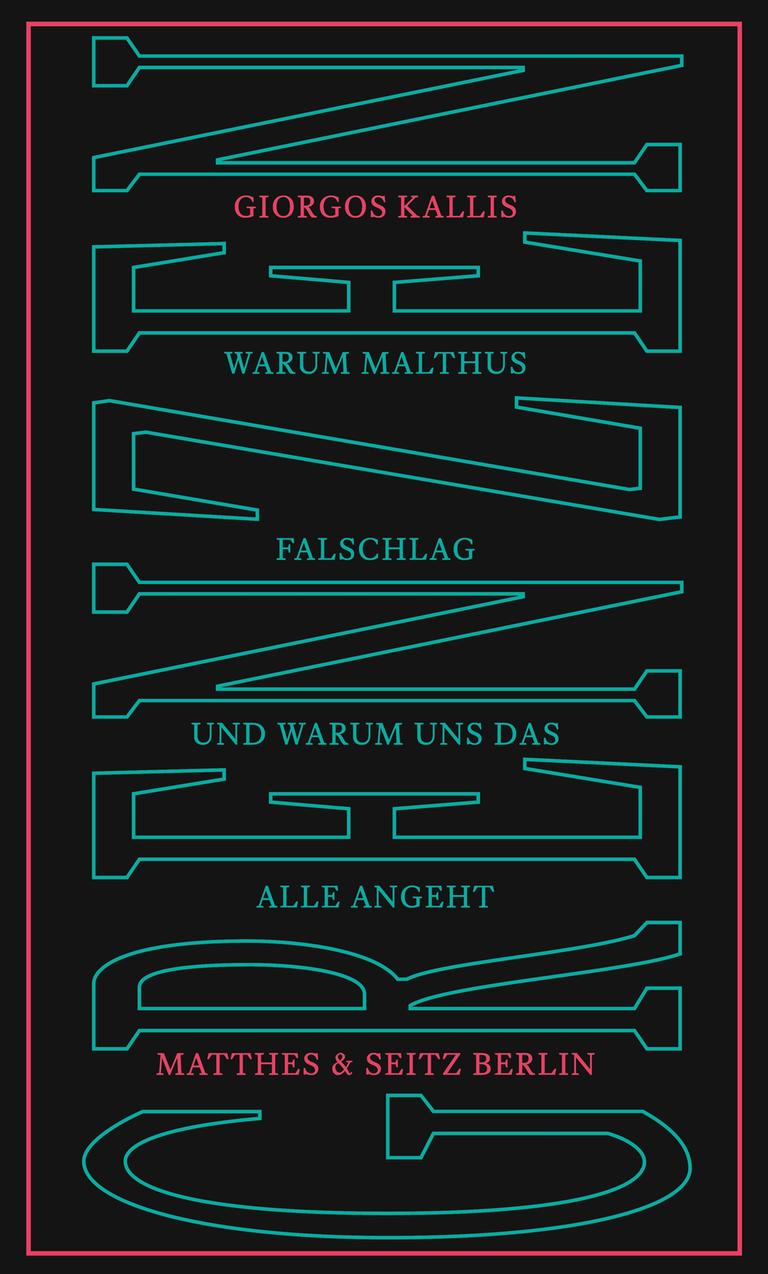
© Matthes & Seitz Verlag
Wir müssen weniger haben wollen
05:22 Minuten
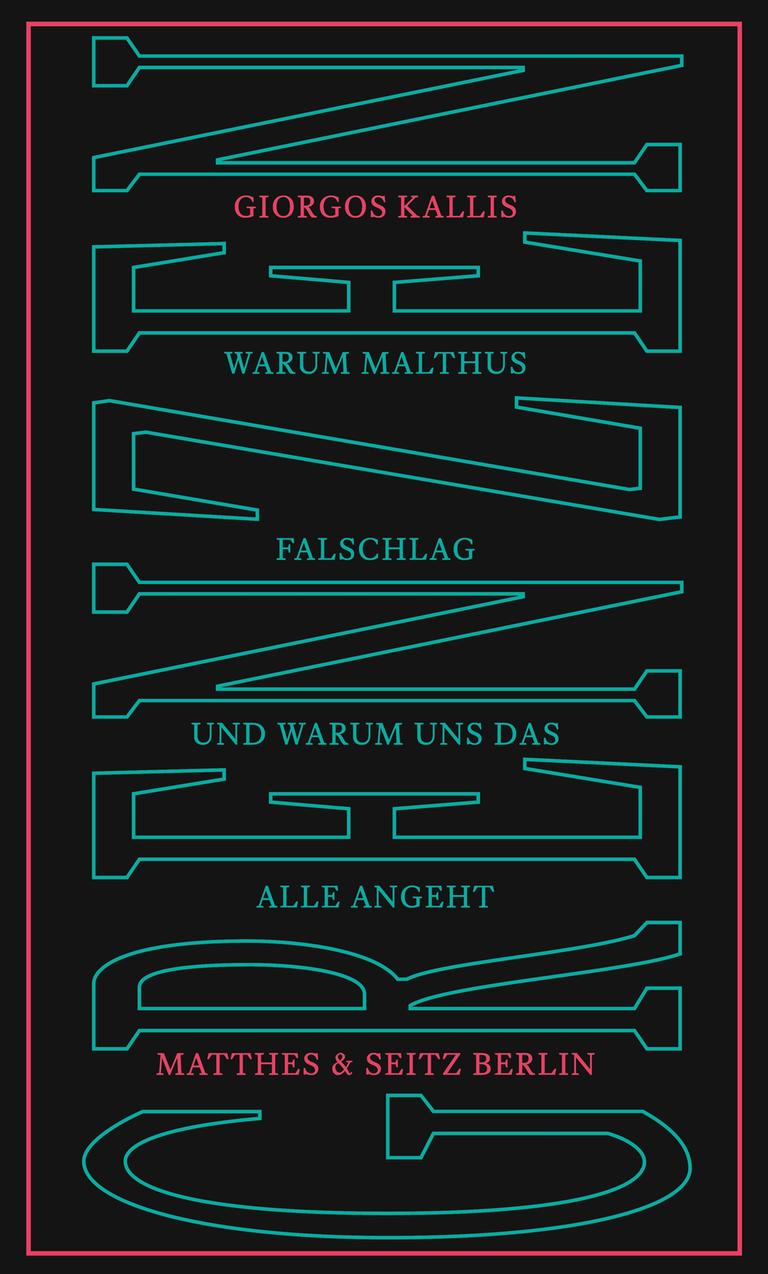
Giorgos Kallis
Übersetzt von Max Henninger
Grenzen. Warum Malthus falsch lag und warum uns das alle angehtMatthes & Seitz Berlin, Berlin 2021171 Seiten
20,00 Euro
Der griechische Ökonom Giorgos Kallis ist einer der führenden Wachstumskritiker der Gegenwart. In seinem neuen Essay knöpft er sich Malthus, den Theoretiker des Bevölkerungswachstums vor.
Die Postwachstumsökonomie boomt. Denn dass die kapitalistische Wachstumsideologie den gestressten Planeten für Menschen unbewohnbar zu machen droht, wird mit jeder weiteren Schreckensmeldung über Dürren und Fluten, Erderwärmung und Artensterben, Zoonosen und Umweltgifte anschaulicher. Harald Welzer etwa predigt die „Kultur des Aufhörens“, und sein Buch ist ein Bestseller.
Aber woher stammt die verderbliche Ideologie? Giorgos Kallis macht den britischen Geistlichen und Ökonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834) hauptverantwortlich. Berühmt-berüchtigt ist Malthus' Essay "Das Bevölkerungsgesetz", den Kallis radikal gegen den Strich bürstet.
Malthus, der Wachstumsprophet
Malthus glaubte, die Fähigkeit der Menschen, sich zu vermehren, sei größer als ihre Fähigkeit, das Überleben aller zu sichern. Deshalb seien Armut und Hunger stets unvermeidlich, aber zugleich ein Ansporn für größere Produktivität. Von Armenhilfe hielt Malthus gar nichts, den Reichtum der Bessergestellten dagegen für völlig natürlich. Gleichheit erschien ihm unmöglich – ein tolles Gedankengeschenk für neoliberale Marktfetischisten. Heute gilt als „Malthusianer“, wer auf die begrenzten Ressourcen verweist.
Laut Kallis jedoch hat Malthus viel eher die Grenzenlosigkeit des modernen Subjekts und dessen Ansprüche zum Fixpunkt unserer Ökonomie gemacht: „Entgegen seinem ikonischen Status als Prophet der Grenzen war Malthus tatsächlich ein Wachstumsprophet.“
Die Akzeptanz von Armut
Folgt man Kallis, sind Grenzen und Knappheit bei Malthus eine Art Trojanisches Pferd, mit dem er die wachsende Konsumlust und zugleich die Akzeptanz von Armut in die Ökonomie geschmuggelt hat. Auch viele „trübsinnige Umweltschützer“ sieht Kallis in der Malthus-Falle. Sie würden auf die knappen Ressourcen starren, aber doch nur an der Geschwindigkeit des Wachstums herumdoktern, um möglichst viele Menschen möglichst lange gut versorgen zu können.
Kallis will viel mehr. Er will den Rahmen des modernen Denkens verändern.
Für Malthus stand fest, dass die Menschen nicht anders können und wollen, als sich – siehe Genesis – „die Erde untertan“ zu machen. Und zwar mittels Vermehrung ihrer selbst und ihrer Produkte.
Kallis' Rezept zur Befreiung aus den Wachstumsfesseln aber lautet: Wir müssen weniger haben wollen – wodurch wir mehr Freiheit und Glück gewinnen.
Die Kunst der Selbstbegrenzung
„Fortschritt kann heute mehr denn je bedeuten, stehen zu bleiben“: Ein Gedanke, der mit der Wachstumsideologie über Kreuz liegt, aber kein neuer Gedanke.
Kallis untermauert ihn mit einem Ausflug ins antike Griechenland. Damals habe man die „Kunst der Selbstbegrenzung“ in Ehren gehalten, nicht die maximale Befriedigung aller möglichen Begehren. Und das soll auch heute möglich sein, denn: „Malthus lag falsch. Unsere Wünsche sind nicht unbegrenzt, und unbegrenztes Wünschen entspricht nicht unserer Natur.“
Das gigantische Hamsterrad der modernen Zivilisation
Eine sympathische These, die den Weg aus dem persönlichen Hamsterrad weisen kann. Aber wie viele schlagen ihn ein? Und was kümmert das den Kapitalismus, dessen unerbittlicher Gott Wachstum heißt?
Gewiss, "Grenzen" ist ein starker Essay, Kallis schreibt inspirierend, er glaubt an die Verheißung solidarischer Begrenzung. Erhebt man aber nach der Lektüre die Augen, sieht man Milliarden kleiner Hamsterräder, die sich im gigantischen Hamsterrad der modernen Zivilisation immer weiterdrehen. Und dessen Kraft, mag sie auch ins kollektive Verderben führen, erscheint grenzenlos.