Gott und der säkulare Staat
Staat und Religion müssen getrennt sein. Der Staat muss säkular, er muss weltanschaulich neutral sein. Das ist der moderne westliche Standpunkt, und dieser Standpunkt ist vernünftig und wohlbegründet.
Anders die islamische Welt. Dort dominiert fast überall die Vorstellung der Einheit von Staat und Religion. Der säkulare Staat wird häufig als gottlos verworfen, stattdessen versucht man, eine Theokratie - also Gottesherrschaft - durch das islamische Recht, die Scharia zu verwirklichen.
Theokratische Ambitionen haben heutzutage aber nicht nur Islamisten, sondern auch christliche Fundamentalisten in den USA und ultrakonservative Juden in Israel - ebenso die vom Papst in die katholische Kirche zurückgeholten Pius-Brüder, die den säkularen Staat lieber heute als morgen durch einen katholisch verfassten Staat ersetzen würden.
Eine theokratische Tendenz liegt im Wesen fast aller Religionen. Sie hat sich in der Geschichte mal mehr, mal weniger gezeigt. Religionen werden politisch, wenn sie den Staat und die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen formen wollen.
Religionen beanspruchen oberste Autorität in Fragen des Sinns und Zwecks des menschlichen Daseins, der Ethik und Moral. Judentum, Christentum und Islam verlangen, dass Gott als Schöpfer von Himmel und Erde und als Herr der Geschichte anerkannt wird; sie fordern, dass die menschlichen Daseinsordnungen - Familie, Gesellschaft, Staat - sich nach dem Willen Gottes richten, der sich durch die heiligen Schriften und die geistlichen Autoritäten kundtue.
Theokratien oder Gottesstaaten, wo sie in der Geschichte verwirklicht wurden – bis heute im Iran und anderen islamischen Ländern -, sind meist repressive, totalitäre Systeme. Sie unterdrücken die Pluralität der Weltanschauungen und Lebensstile. Stattdessen wird eine politische Theologie zur obersten Staatsdoktrin gemacht und ein drakonisches Recht kommt zur Anwendung, das aus den religiösen Schriften als Wille Gottes abgeleitet wird.
Die Rechtfertigung der Theokratie hat jedoch eine unbehebbare Schwäche: Für die Existenz Gottes, an der alles hängt, gibt es keinerlei Beweis – und kann es auch keinen Beweis geben, wie wir seit Immanuel Kant wissen. Und was die Offenbarungsschriften betrifft, auf die sich die Theokraten berufen, so sind sie nicht als Wort Gottes vom Himmel gefallen, sondern das Werk von Menschen mit einer magisch-mythischen Weltauffassung, die längst nicht mehr die unsere ist. Auf solchen Grundlagen ein Staatswesen in unserer Zeit aufzubauen, ist absurd.
Und doch glaube ich – wie Max Horkheimer, Eric Voegelin und andere politische Denker -, dass auch in der theokratischen Idee etwas steckt, was uns ernsthaft angeht. Und zwar der Gedanke, dass die Welt sich nicht in der Immanenz abschließen darf, dass die Welt offen bleiben muss für Transzendenz, für das, was der Physiker Werner Heisenberg die "zentrale Ordnung der Wirklichkeit" oder auch Gott genannt hat. In der meditativen Hinwendung sei die Harmonie der zentralen Ordnung erfahrbar, meinte Heisenberg, sie könne für die Menschheit zum Kompass in eine friedlichere Zukunft werden.
Mahatma Gandhi war so ein Mann, dessen Politik der Gewaltlosigkeit aus seiner meditativen Hinwendung zur Transzendenz kam – es war "Politik aus dem Überpolitischen", wie der Philosoph Karl Jaspers sagte. Gandhis politisches Wirken floss aus seinem Einheitsbewusstsein mit Gott – zugleich warnte Gandhi aber vor einem theokratischen Staat, weil so etwas wie der "Wille Gottes" von Menschen niemals sicher erkannt werden könne. Der Staat, so Gandhi, müsse deshalb "unbedingt säkular" sein.
In der Tat, der moderne Staat muss säkular sein. Aber trotzdem sollte er sich immer eine Spur von Transzendenz-Bewusstsein bewahren – wie in der Präambel zum Grundgesetz, wo es heißt: "Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen ..."
Nikolaus German, Autor und freier Journalist, M. A., geb. 1950, Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Lebt als Autor und freier Journalist in München, schreibt v. a. für "Süddeutsche Zeitung", "Rheinischer Merkur", "Das Parlament"; zahlreiche Beiträge für Rundfunk und Fernsehen sowie mehrere Dokumentarfilme, darunter "Botschafter der Hoffnung - Sergiu Celibidache in Rumänien", "München unterm Hakenkreuz - Hitlers Hauptstadt der Bewegung", "Max Mannheimer - ein Überlebender aus Dachau".
Theokratische Ambitionen haben heutzutage aber nicht nur Islamisten, sondern auch christliche Fundamentalisten in den USA und ultrakonservative Juden in Israel - ebenso die vom Papst in die katholische Kirche zurückgeholten Pius-Brüder, die den säkularen Staat lieber heute als morgen durch einen katholisch verfassten Staat ersetzen würden.
Eine theokratische Tendenz liegt im Wesen fast aller Religionen. Sie hat sich in der Geschichte mal mehr, mal weniger gezeigt. Religionen werden politisch, wenn sie den Staat und die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen formen wollen.
Religionen beanspruchen oberste Autorität in Fragen des Sinns und Zwecks des menschlichen Daseins, der Ethik und Moral. Judentum, Christentum und Islam verlangen, dass Gott als Schöpfer von Himmel und Erde und als Herr der Geschichte anerkannt wird; sie fordern, dass die menschlichen Daseinsordnungen - Familie, Gesellschaft, Staat - sich nach dem Willen Gottes richten, der sich durch die heiligen Schriften und die geistlichen Autoritäten kundtue.
Theokratien oder Gottesstaaten, wo sie in der Geschichte verwirklicht wurden – bis heute im Iran und anderen islamischen Ländern -, sind meist repressive, totalitäre Systeme. Sie unterdrücken die Pluralität der Weltanschauungen und Lebensstile. Stattdessen wird eine politische Theologie zur obersten Staatsdoktrin gemacht und ein drakonisches Recht kommt zur Anwendung, das aus den religiösen Schriften als Wille Gottes abgeleitet wird.
Die Rechtfertigung der Theokratie hat jedoch eine unbehebbare Schwäche: Für die Existenz Gottes, an der alles hängt, gibt es keinerlei Beweis – und kann es auch keinen Beweis geben, wie wir seit Immanuel Kant wissen. Und was die Offenbarungsschriften betrifft, auf die sich die Theokraten berufen, so sind sie nicht als Wort Gottes vom Himmel gefallen, sondern das Werk von Menschen mit einer magisch-mythischen Weltauffassung, die längst nicht mehr die unsere ist. Auf solchen Grundlagen ein Staatswesen in unserer Zeit aufzubauen, ist absurd.
Und doch glaube ich – wie Max Horkheimer, Eric Voegelin und andere politische Denker -, dass auch in der theokratischen Idee etwas steckt, was uns ernsthaft angeht. Und zwar der Gedanke, dass die Welt sich nicht in der Immanenz abschließen darf, dass die Welt offen bleiben muss für Transzendenz, für das, was der Physiker Werner Heisenberg die "zentrale Ordnung der Wirklichkeit" oder auch Gott genannt hat. In der meditativen Hinwendung sei die Harmonie der zentralen Ordnung erfahrbar, meinte Heisenberg, sie könne für die Menschheit zum Kompass in eine friedlichere Zukunft werden.
Mahatma Gandhi war so ein Mann, dessen Politik der Gewaltlosigkeit aus seiner meditativen Hinwendung zur Transzendenz kam – es war "Politik aus dem Überpolitischen", wie der Philosoph Karl Jaspers sagte. Gandhis politisches Wirken floss aus seinem Einheitsbewusstsein mit Gott – zugleich warnte Gandhi aber vor einem theokratischen Staat, weil so etwas wie der "Wille Gottes" von Menschen niemals sicher erkannt werden könne. Der Staat, so Gandhi, müsse deshalb "unbedingt säkular" sein.
In der Tat, der moderne Staat muss säkular sein. Aber trotzdem sollte er sich immer eine Spur von Transzendenz-Bewusstsein bewahren – wie in der Präambel zum Grundgesetz, wo es heißt: "Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen ..."
Nikolaus German, Autor und freier Journalist, M. A., geb. 1950, Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Lebt als Autor und freier Journalist in München, schreibt v. a. für "Süddeutsche Zeitung", "Rheinischer Merkur", "Das Parlament"; zahlreiche Beiträge für Rundfunk und Fernsehen sowie mehrere Dokumentarfilme, darunter "Botschafter der Hoffnung - Sergiu Celibidache in Rumänien", "München unterm Hakenkreuz - Hitlers Hauptstadt der Bewegung", "Max Mannheimer - ein Überlebender aus Dachau".
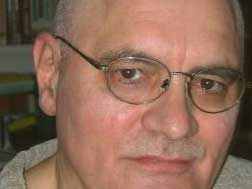
Nikolaus German© Privat