Michael Kempe: „Die beste aller möglichen Welten. Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit“
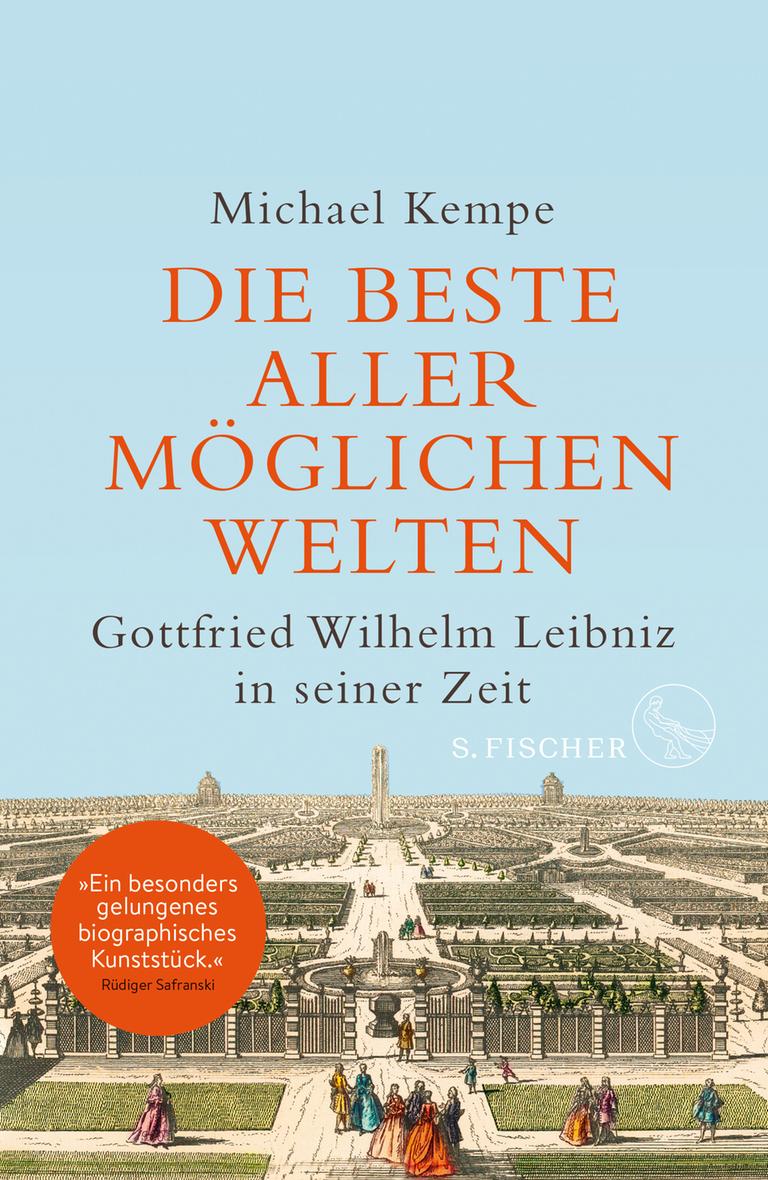
© S. Fischer Verlag
Aus dem Leben eines Universalgelehrten
06:28 Minuten
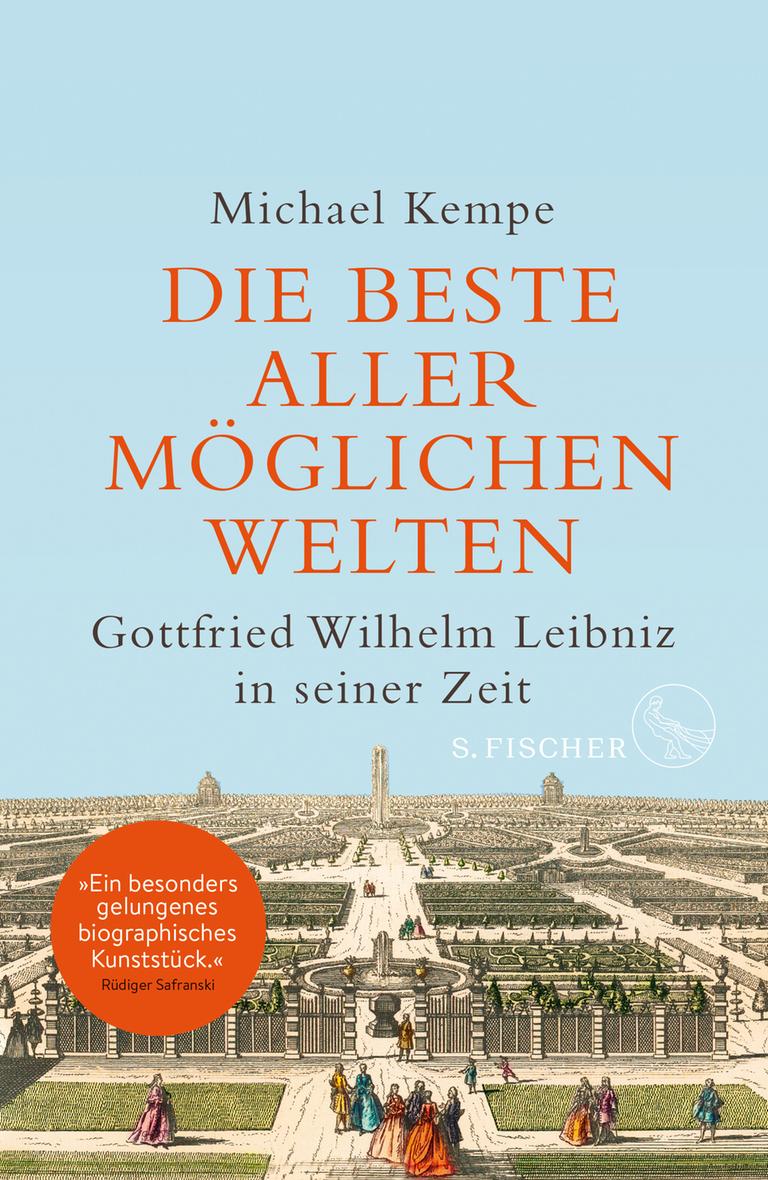
Michael Kempe
Die beste aller möglichen Welten. Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner ZeitS. Fischer, Frankfurt am Main 2022352 Seiten
24,00 Euro
Michael Kempe erzählt Leibniz’ Biografie nicht chronologisch von dessen Geburt 1646 bis zu seinem Tod 1716, sondern er greift aus dem Leben sieben Tage heraus, anhand derer er den Alltag des bedeutenden Philosophen und Mathematikers veranschaulicht.
Gottfried Wilhelm Leibniz, so ist aus Michael Kempes Biografie über das Universalgenie zu erfahren, liebte es, morgens länger im Bett liegen zu bleiben, denn noch vor dem Aufstehen fielen ihm die Lösungen schwieriger mathematischer Aufgaben ein und liegend erledigte er einen Teil seiner umfangreichen Korrespondenz. Insgesamt beläuft sich sein Nachlass auf 100.000 Blatt.
Leibniz war ein Freigeist, der sich dem unendlichen Universum ebenso zuwandte wie dem im Kleinsten sich zeigenden Mikrokosmos. Ihm auf seinen „Denkwegen“ zu folgen, erweist sich noch immer als schwierig. Man denke nur an die Infinitesimalrechnung, die er durch das von ihm eingeführte schlangenförmige Symbol „ò“ entscheidend konkretisierte.
Alltag eines Universalgelehrten
Diesem Universalgelehrten nähert sich Michael Kempe in seiner Biografie über seinen Alltag. Denn erst über die Rekonstruktion des Alltäglichen – so der Autor – ließe sich Leibniz’ „Leben und Handeln“ verstehen. Bemerkenswert ist des Biografen Idee, Leibniz’ Leben nicht chronologisch, sondern anhand von Begebenheiten zu erzählen, die sich an sieben Tagen, an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Lebensphasen ereignet haben.
Zunächst ist es der 29. Oktober 1675, dem Kempes Aufmerksamkeit gilt. An diesem Tag verwendet Leibniz – er hält sich gerade in Paris auf – zum ersten Mal das „ò“ als Summe-Symbol. Am 11. Februar 1686 weilt er in Zellerfeld im Harz und vollendet eine philosophische Schrift, in der er Glaube und Vernunft zu einer Einheit bringt. Am 13. August 1696 beginnt er in Hannover Tagebuch zu führen.
Am 17. April 1703 entwickelt er, indem er mit der 1 und der 0 rechnet, die Dyadik. Er vollendet am 17. Oktober mit der „Theodizee“ seine bedeutendste philosophische Arbeit; entwickelt im Brief vom 26. August 1714 – im Begriff, Wien zu verlassen – Überlegungen zum absoluten Raum, und schließlich wendet er sich zwei Jahre später, kurz vor seinem Tod, an Zar Peter I.
Die Idee überzeugt nur bedingt
Leibniz wurde von außergewöhnlichen Einfällen geradezu „überfallen“. Der Herr mit der Allongeperücke, der gern Kaffee und Schokolade trank, soll seinen Wein, den er nur in Maßen zu sich nahm, nachgesüßt haben.
Sehr viel Alltägliches hat sich in seinem Tagebuch gefunden, das er aber nur kurze Zeit führte, wie man aus Kempes im Erzählton geschriebener Biografie erfährt, die auch auf fiktive Episoden zurückgreift.
Vergleicht man sein Buch mit der umfassenden Biografie von Eike Christian Hirsch „Der berühmte Herr Leibniz“ (2000), bietet sie wenig Neues. Auch verwischt Kempes Einfall, Leibniz’ Leben auf der Grundlage von sieben Tagesereignissen zu rekonstruieren, wichtige seiner zentralen Lebensprojekte (angesichts der „Reduktion“ wäre eine Zeittafel unbedingt erforderlich gewesen). Zu kurz kommen nie fallengelassene Projekte wie die Entwicklung der Rechenmaschine und das Theater der Natur und Kunst.


