Grenzen im digitalen Zeitalter
Grenzen, sind nicht nur Begrenzungen, argumentiert Rainer Funk, sondern vor allem ein inneres Gerüst, das uns hält. Sie geben Orientierung. Deswegen gehe es darum, Grenzen als solche wahrzunehmen, sie zu verstehen und auch anerkennen zu können.
Rainer Funk analysiert ein zentrales psychologisches Problem des modernen Menschen: Seine zunehmende Entgrenzung und deren Folgen. Hinter all dem steht die Frage, wie viel Freiheit ist gut, wie viel Grenzen und Normen brauchen wir, um miteinander leben zu können? Wie viel Schranken sind nötig, damit wir mit uns selbst klarkommen.
In den westlichen Gesellschaften streben immer mehr Menschen nach Freiheit, nach Autonomie, danach sich selbst zu verwirklichen und ein Leben ohne Vorgabe, Maßstäbe und Berücksichtigung von Grenzen zu leben. Diese Tendenz, so beschreibt es der Psychoanalytiker, Schüler und Nachlassverwalter Erich Fromms, in seinem gut 200 Seiten langen Buch, lässt sich in fast allen Lebensbereichen finden. Sei es in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt, in Beziehungen, im Freizeitverhalten oder in der Erziehung.
Unsere moderne Welt ermöglicht es uns, weite Wege in kürzester Zeit zurückzulegen und sich damit fast überall gleichzeitig zu wähnen. Informationen, die früher nur mühselig zu erhalten waren, sind jetzt auf Knopfdruck abrufbar. Es ist möglich, in virtuellen Welten zu leben, Zeiten und Orte werden unwichtig. Menschen kontaktieren andere Menschen digital und täuschen sich dabei eine Verbundenheit vor, gehen Beziehungen gleichzeitig nur noch ein, wenn nicht der Anspruch der Verbindlichkeit erhoben wird. Denn Erwartungshaltungen wie Loyalität, Fürsorge und Verantwortung werden von immer mehr Menschen als Überforderung wahrgenommen, es begrenzt sie in ihrem Entgrenzungsstreben.
Anders als vormoderne Gesellschaften, die durch eine regulative Leitidee und eine unveränderliche Ordnung geprägt sind, zielt die Moderne auf ständige Veränderungen von Kommunikation, Zeit, Normen und Regeln. Alles, was sonst galt, wird ständig hinterfragt, unterlaufen oder neu erfunden.
Wie stark wir alle dieses Muster verinnerlicht haben, zeigt der letzte amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. Darin hat Barack Obama die Amerikaner auf "Change" eingeschworen, um ins "Weiße Haus" zu kommen, Präsident zu werden. Nicht das Bestehende oder gar die Tradition, das woher wir kommen, ist Kern der Botschaft, sondern das sich Verändernde, das Neue. Doch nicht nur in der Politik ist dieses Phänomen sichtbar.
Weitreichende Folgen für unser Leben hat auch die Entgrenzung der Wirtschafts- und Finanzwelt, in der sich die Finanzmärkte von der Realwirtschaft abkoppeln. Eine Finanzkrise folgt der anderen. Politische Instanzen, die in das Marktgeschehen nachhaltig eingreifen können, haben nur wenig Einfluss oder nutzen ihn nur in Ansätzen. Dieser weltweite Strukturwandel hat reale Auswirkungen auf unsere Arbeitwelt, auf den Einzelnen:
"Ernst zu nehmen ist, dass der flexible Arbeitsraum und insbesondere der virtuelle Arbeitsplatz in der Regel eine Vereinzelung und Isolierung des Arbeitenden mit sich bringen. Die damit einhergehende Entgrenzung des Bedürfnisses nach einem festen, abgegrenzten Ort, an dem die Erwerbsarbeit stattfindet und an dem im Vollzug der Arbeit zahlreiche soziale Kontakte wahrgenommen werden können, berührt das fundamentale Bedürfnis des Menschen, sich bezogen und verbunden erleben zu können. Dass die Beschäftigungsverhältnisse nicht nur flexibilisiert, sondern zunehmend auch instabil werden, ist ein weiterer Aspekt der Entgrenzung der Arbeitswelt."
Das Fazit: Das "unternehmerische Selbst", wie es Funk nennt, ist eine neue Persönlichkeit. Entweder er nimmt die Herausforderung an und unterwirft sich, erlebt die Methoden der Rationalisierung, Ökonomisierung und des Controlling nicht mehr als fremd, sondern als etwas Eigenes. Oder er steht früher oder später ohne neues Projekt da.
Damit einher geht, dass der moderne entgrenzte Mensch auch seine Beziehungen zu anderen verändert. Immer mehr Menschen wollen autonom ihr Ich leben und gleichzeitig definieren sie sich über bestimmte Milieus und Lebensstile. Sie wollen verbunden sein, ohne gebunden zu sein. Die elektronische Kommunikation hilft ihnen dabei.
"Tatsächlich geht es bei der Kontaktpflege nicht um Beziehung im Sinne von emotionalen Bindungen und entsprechenden Gefühlen von Sehnsucht, Rücksichtnahme, Verbindlichkeit, Nähe, Treue, Vermissen, sondern um punktuelle Berührungen (Kontakte). Entgrenztes Verbundensein macht nur dann frei, wenn durch das Verbundensein keine Verbindlichkeiten entstehen und wenn mit Beziehungsaufnahmen keine Erwartungen an Verlässlichkeit und anhaltenden Nähewünschen einhergehen."
Damit geht eine Veränderung des Menschen einher. Funk beschreibt das als "Doping der Seele". Der moderne Mensch konstruiert Wirklichkeit neu, inszeniert sich, erfährt Aufmerksamkeit, ist beruflich erfolgreich. Diese konstruierte Persönlichkeit, muss allerdings auch die eigene Prägung oder, wie Funk sagt, das Gebundensein an das Eigene überwinden, und zwar so, dass der Mensch sich neu erfindet und nicht nur ständig in unterschiedliche Rollen schlüpft. Funk bezweifelt, dass diese konstruierte Persönlichkeit eine innere Verbindung zu sich selbst hat. Vielmehr wird sie zu ihrer eigenen Simulation.
Was folgt daraus? Funk weist auf die Grenzen des entgrenzten Menschen hin und vergleicht diese mit dem Doping im Sport.
"Werden etwa Ängste oder Selbstzweifel vom Selbsterleben ausgeblendet, dann vermag man sein Selbst kraftvoll und selbstbewusst erleben und kann andere damit beeindrucken. Und doch ist ein solches Doping der Persönlichkeit wie das Doping im Sport nicht ohne Folgen. Beeinträchtigen Dopingmittel die körperliche Gesundheit noch nach Jahren, so hat auch das Ausblenden von bestimmten Persönlichkeitsaspekten Effekte, die der seelischen Gesundheit abträglich sind und deshalb Grenzen des entgrenzten Menschen sichtbar werden lassen. Mit den ausgeblendeten Selbstzweifeln wird auch die Fähigkeit ausgeblendet, sich noch selbstkritisch sehen zu können. Es kommt zu einer narzisstischen Verletzlichkeit. Umgeht man bestimmte Ängste und gibt man sich stattdessen ganz furchtlos, dann entwickeln sich nur zu oft irrationale Ängste."
Entgrenzte Menschen, so beschreibt Funk, verlieren innere Strukturen und suchen deshalb nach Feindbildern und haben eine zunehmende Unfähigkeit, Leidvolles und Anstrengendes noch aushalten zu können. Erkrankungen wie Bulimie, Magersucht oder Abhängigkeit von Alkohol und Drogen sind oft die Folgen.
Grenzen, so zeigt dieses Buch, sind eben nicht nur Begrenzungen, sondern vor allem ein inneres Gerüst, das uns hält. Grenzen geben Orientierung. Dabei geht es nicht darum, nie Grenzen zu überschreiten, Abenteuer einzugehen. Aber es geht darum, Grenzen als solche wahrzunehmen, sie zu verstehen und bisweilen auch sehr wohl anerkennen zu können.
Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Veränderung des Menschen im digitalen Zeitalter, in dem immer schneller mehr möglich zu sein scheint: das Leben als Spin. Sprachlich mutet es hingegen wie ein Werk aus einer anderen Zeit an. Oft ist der Satzbau umständlich, teilweise redundant. Das Buch ist leider nicht so stringent geschrieben, wie sein Thema aktuell ist.
Rainer Funk: Der entgrenzte Mensch. Warum ein Leben ohne Grenzen nicht frei, sondern abhängig macht
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011
In den westlichen Gesellschaften streben immer mehr Menschen nach Freiheit, nach Autonomie, danach sich selbst zu verwirklichen und ein Leben ohne Vorgabe, Maßstäbe und Berücksichtigung von Grenzen zu leben. Diese Tendenz, so beschreibt es der Psychoanalytiker, Schüler und Nachlassverwalter Erich Fromms, in seinem gut 200 Seiten langen Buch, lässt sich in fast allen Lebensbereichen finden. Sei es in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt, in Beziehungen, im Freizeitverhalten oder in der Erziehung.
Unsere moderne Welt ermöglicht es uns, weite Wege in kürzester Zeit zurückzulegen und sich damit fast überall gleichzeitig zu wähnen. Informationen, die früher nur mühselig zu erhalten waren, sind jetzt auf Knopfdruck abrufbar. Es ist möglich, in virtuellen Welten zu leben, Zeiten und Orte werden unwichtig. Menschen kontaktieren andere Menschen digital und täuschen sich dabei eine Verbundenheit vor, gehen Beziehungen gleichzeitig nur noch ein, wenn nicht der Anspruch der Verbindlichkeit erhoben wird. Denn Erwartungshaltungen wie Loyalität, Fürsorge und Verantwortung werden von immer mehr Menschen als Überforderung wahrgenommen, es begrenzt sie in ihrem Entgrenzungsstreben.
Anders als vormoderne Gesellschaften, die durch eine regulative Leitidee und eine unveränderliche Ordnung geprägt sind, zielt die Moderne auf ständige Veränderungen von Kommunikation, Zeit, Normen und Regeln. Alles, was sonst galt, wird ständig hinterfragt, unterlaufen oder neu erfunden.
Wie stark wir alle dieses Muster verinnerlicht haben, zeigt der letzte amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. Darin hat Barack Obama die Amerikaner auf "Change" eingeschworen, um ins "Weiße Haus" zu kommen, Präsident zu werden. Nicht das Bestehende oder gar die Tradition, das woher wir kommen, ist Kern der Botschaft, sondern das sich Verändernde, das Neue. Doch nicht nur in der Politik ist dieses Phänomen sichtbar.
Weitreichende Folgen für unser Leben hat auch die Entgrenzung der Wirtschafts- und Finanzwelt, in der sich die Finanzmärkte von der Realwirtschaft abkoppeln. Eine Finanzkrise folgt der anderen. Politische Instanzen, die in das Marktgeschehen nachhaltig eingreifen können, haben nur wenig Einfluss oder nutzen ihn nur in Ansätzen. Dieser weltweite Strukturwandel hat reale Auswirkungen auf unsere Arbeitwelt, auf den Einzelnen:
"Ernst zu nehmen ist, dass der flexible Arbeitsraum und insbesondere der virtuelle Arbeitsplatz in der Regel eine Vereinzelung und Isolierung des Arbeitenden mit sich bringen. Die damit einhergehende Entgrenzung des Bedürfnisses nach einem festen, abgegrenzten Ort, an dem die Erwerbsarbeit stattfindet und an dem im Vollzug der Arbeit zahlreiche soziale Kontakte wahrgenommen werden können, berührt das fundamentale Bedürfnis des Menschen, sich bezogen und verbunden erleben zu können. Dass die Beschäftigungsverhältnisse nicht nur flexibilisiert, sondern zunehmend auch instabil werden, ist ein weiterer Aspekt der Entgrenzung der Arbeitswelt."
Das Fazit: Das "unternehmerische Selbst", wie es Funk nennt, ist eine neue Persönlichkeit. Entweder er nimmt die Herausforderung an und unterwirft sich, erlebt die Methoden der Rationalisierung, Ökonomisierung und des Controlling nicht mehr als fremd, sondern als etwas Eigenes. Oder er steht früher oder später ohne neues Projekt da.
Damit einher geht, dass der moderne entgrenzte Mensch auch seine Beziehungen zu anderen verändert. Immer mehr Menschen wollen autonom ihr Ich leben und gleichzeitig definieren sie sich über bestimmte Milieus und Lebensstile. Sie wollen verbunden sein, ohne gebunden zu sein. Die elektronische Kommunikation hilft ihnen dabei.
"Tatsächlich geht es bei der Kontaktpflege nicht um Beziehung im Sinne von emotionalen Bindungen und entsprechenden Gefühlen von Sehnsucht, Rücksichtnahme, Verbindlichkeit, Nähe, Treue, Vermissen, sondern um punktuelle Berührungen (Kontakte). Entgrenztes Verbundensein macht nur dann frei, wenn durch das Verbundensein keine Verbindlichkeiten entstehen und wenn mit Beziehungsaufnahmen keine Erwartungen an Verlässlichkeit und anhaltenden Nähewünschen einhergehen."
Damit geht eine Veränderung des Menschen einher. Funk beschreibt das als "Doping der Seele". Der moderne Mensch konstruiert Wirklichkeit neu, inszeniert sich, erfährt Aufmerksamkeit, ist beruflich erfolgreich. Diese konstruierte Persönlichkeit, muss allerdings auch die eigene Prägung oder, wie Funk sagt, das Gebundensein an das Eigene überwinden, und zwar so, dass der Mensch sich neu erfindet und nicht nur ständig in unterschiedliche Rollen schlüpft. Funk bezweifelt, dass diese konstruierte Persönlichkeit eine innere Verbindung zu sich selbst hat. Vielmehr wird sie zu ihrer eigenen Simulation.
Was folgt daraus? Funk weist auf die Grenzen des entgrenzten Menschen hin und vergleicht diese mit dem Doping im Sport.
"Werden etwa Ängste oder Selbstzweifel vom Selbsterleben ausgeblendet, dann vermag man sein Selbst kraftvoll und selbstbewusst erleben und kann andere damit beeindrucken. Und doch ist ein solches Doping der Persönlichkeit wie das Doping im Sport nicht ohne Folgen. Beeinträchtigen Dopingmittel die körperliche Gesundheit noch nach Jahren, so hat auch das Ausblenden von bestimmten Persönlichkeitsaspekten Effekte, die der seelischen Gesundheit abträglich sind und deshalb Grenzen des entgrenzten Menschen sichtbar werden lassen. Mit den ausgeblendeten Selbstzweifeln wird auch die Fähigkeit ausgeblendet, sich noch selbstkritisch sehen zu können. Es kommt zu einer narzisstischen Verletzlichkeit. Umgeht man bestimmte Ängste und gibt man sich stattdessen ganz furchtlos, dann entwickeln sich nur zu oft irrationale Ängste."
Entgrenzte Menschen, so beschreibt Funk, verlieren innere Strukturen und suchen deshalb nach Feindbildern und haben eine zunehmende Unfähigkeit, Leidvolles und Anstrengendes noch aushalten zu können. Erkrankungen wie Bulimie, Magersucht oder Abhängigkeit von Alkohol und Drogen sind oft die Folgen.
Grenzen, so zeigt dieses Buch, sind eben nicht nur Begrenzungen, sondern vor allem ein inneres Gerüst, das uns hält. Grenzen geben Orientierung. Dabei geht es nicht darum, nie Grenzen zu überschreiten, Abenteuer einzugehen. Aber es geht darum, Grenzen als solche wahrzunehmen, sie zu verstehen und bisweilen auch sehr wohl anerkennen zu können.
Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Veränderung des Menschen im digitalen Zeitalter, in dem immer schneller mehr möglich zu sein scheint: das Leben als Spin. Sprachlich mutet es hingegen wie ein Werk aus einer anderen Zeit an. Oft ist der Satzbau umständlich, teilweise redundant. Das Buch ist leider nicht so stringent geschrieben, wie sein Thema aktuell ist.
Rainer Funk: Der entgrenzte Mensch. Warum ein Leben ohne Grenzen nicht frei, sondern abhängig macht
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011
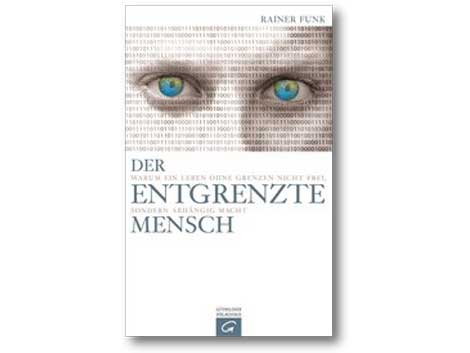
Cover: "Der entgrenzte Mensch" von Rainer Funk© Gütersloher Verlagshaus
