Handreichung an den Kreationismus
Dawkins erzählt uns die Geschichte der Evolution so bild- und detailfreudig, dass man fast vergisst, dass es sich auch bei diesem Buch um eine Beweisschrift für die Triftigkeit der darwinschen Evolutionslehre handelt.
Statt erneut unter Niveau zu gehen und den Darwinismus als aufklärerisches Dogma gegen jedwedes theologische oder auch nur metaphysische Denken in Stellung zu bringen, lässt uns Richard Dawkins jetzt, je zwangloser desto überzeugender, an dem Charme jenes zugleich Wundersamen wie Bezwingenden teilhaben, den der Evolutionsgedanke auf seinen Erfinder Charles Darwin ausgeübt haben muss.
Die unschuldige Liebe des Biologen zur variationsreichen Welt der Kohlköpfe, Wildrosen und Jagdhunde ist in den Nachfolgezeiten zunehmend überblendet worden von der Vision eines auf uns Menschen anwendbaren Züchtungs- und Auslesegedankens. Dass wir meinen, aus dem Wissen um das Evolutionsgeschehen aktiv in dieses eingreifen zu können, stellt ein folgenschweres Missverständnis des Züchtungs- und Auslesegedankens dar. Es ist allem voran dieses Missverständnis, das die Vulgärformen des Darwinismus kennzeichnet: den Sozialdarwinismus und die Eugenik.
"Darwins große Erkenntnis lautete: Man braucht überhaupt keinen Züchter. Diese Rolle kann die Natur übernehmen – das schiere Überleben oder der unterschiedliche Fortpflanzungserfolg. Dagegen war Hitlers »Sozialdarwinismus« - sein Glaube an einen Kampf zwischen den Menschenrassen – in Wirklichkeit sehr undarwinistisch. Für Darwin spielte sich der Kampf ums Dasein zwischen den Individuen einer Spezies ab, aber nicht zwischen verschiedenen biologischen Arten, Rassen oder anderen Gruppen."
Richard Dawkins verfolgt demgegenüber das Konzept des "Genpools". Am Beispiel der Kanarienzucht zeigt er, wie sehr noch die Züchtung artifiziell anmutender Gesangsqualitäten von Kanarienvögeln auf deren gattungsspezifisch vorhandenes genetisches Reservoir zurückgreift. Die mit geschlossenem Schnabel trällernden "Roller", die glucksenden "Wasserschläger" oder die kastagnettengleich klappernden "Timbrados" singen vielleicht auf markantere Weise als ihre Vorfahren auf der freien Wildbahn, aber nie auf gänzlich neue Art. Vielmehr haben die menschlichen Züchter immer schon auf Zuchtanstrengungen der Natur zurückgreifen können. Wilde Vogelweibchen haben sich unwillkürlich Männchen mit herausragenden Gesangsfähigkeiten herangezüchtet, indem sie sich nur mit denjenigen paarten, deren Gesang besonders ausgefallen war.
Nichts anderes sagt denn auch der Schöpfungsgedanke: Wir sind keine Schöpfer, sondern allenfalls Nachschaffende. Geschöpfe, die wir selber sind, verfügen wir zu keiner Zeit über die erste Initiative. Wir finden uns und die Welt bereits vor. Wir erschaffen nichts, was es nicht schon gäbe, auch wenn wir in die Welt eingreifen und unser Leben in unsere eigenen Hände nehmen. Wir wissen einigermaßen Bescheid über die Geschichte des Lebens, aber wir kennen nicht ihren Anfang. Charles Darwin hat sich für Entwicklungsgesetze des Lebens interessiert, ausdrücklich aber nicht für deren Ursprung.
Nur nach infantilem theologischen Verständnis gibt der Schöpfungsgedanke Auskunft über die Entstehung der Welt. Eher schon ist es gerade umgekehrt die Unaufhellbarkeit des Anfangs, die uns das Leben um uns herum als Schöpfung verehren lässt. Den Schöpfungsgedanken zu denken, heißt, sich über den einfachen Tatbestand von Leben und Welt in Verwunderung versetzen zu lassen. Aus dieser Verwunderung heraus fällt uns überhaupt erst ein, nach dem Sinn des Lebens im Allgemeinen und unseres eigenen im Besonderen zu fragen. Eben dies ist denn auch der Grund, warum sich in uns natürlicherweise etwas gegen den Evolutionsgedanken sträubt.
Der deutsch-amerikanische Biologe Ernst Mayr hat die These aufgestellt, wonach der Platonismus in unserem Denken die Hauptblockade gegen den Evolutionsgedanken darstellt. Irgendwie können wir die Idee einer totalen Veränderlichkeit von allem und jedem nur schwer ertragen. Als Sterbliche sind wir darauf angewiesen, Dinge und Lebewesen als solche wiederzuerkennen und mit ihnen uns selbst. Wir tragen Bilder von Dingen und Lebewesen in uns, an denen wir zeitlebens auch zukünftige Dinge und Lebewesen messen werden.
Richard Dawkins rehabilitiert sogar diesen unseren gleichsam eingeborenen anti-evolutionären Affekt. Mehr noch: Er überrascht uns mit einer Handreichung an den Kreationismus, wohlgemerkt in dessen theologisch reflektierter Form – die Naturwissenschaft und Theologie seit je miteinander koexistieren lässt.
"[...] selbst wenn sich letztlich herausstellen sollte, dass eine göttliche Intelligenz für die Gestaltung so komplexen Lebens verantwortlich ist, so ist jedenfalls eines klar: Er formt die Lebewesen nicht so ähnlich, wie beispielsweise Keramikkünstler ihre Produkte formen, oder auch Zimmerleute, Töpfer, Schneider oder Autohersteller. [...] Gott hat in seinem ganzen ewigen Leben nie einen winzigen Flügel gemacht. Wenn er etwas gemacht hat [...], dann war es ein embryologisches Rezept, eine Art Computerprogramm zur Steuerung der Embryonalentwicklung eines winzigen Flügels (und auch vieler anderer Dinge)."
Richard Dawkins:"Die Schöpfungslüge. Warum Darwin Recht hat"
Ullstein Verlag, Berlin/2010
Die unschuldige Liebe des Biologen zur variationsreichen Welt der Kohlköpfe, Wildrosen und Jagdhunde ist in den Nachfolgezeiten zunehmend überblendet worden von der Vision eines auf uns Menschen anwendbaren Züchtungs- und Auslesegedankens. Dass wir meinen, aus dem Wissen um das Evolutionsgeschehen aktiv in dieses eingreifen zu können, stellt ein folgenschweres Missverständnis des Züchtungs- und Auslesegedankens dar. Es ist allem voran dieses Missverständnis, das die Vulgärformen des Darwinismus kennzeichnet: den Sozialdarwinismus und die Eugenik.
"Darwins große Erkenntnis lautete: Man braucht überhaupt keinen Züchter. Diese Rolle kann die Natur übernehmen – das schiere Überleben oder der unterschiedliche Fortpflanzungserfolg. Dagegen war Hitlers »Sozialdarwinismus« - sein Glaube an einen Kampf zwischen den Menschenrassen – in Wirklichkeit sehr undarwinistisch. Für Darwin spielte sich der Kampf ums Dasein zwischen den Individuen einer Spezies ab, aber nicht zwischen verschiedenen biologischen Arten, Rassen oder anderen Gruppen."
Richard Dawkins verfolgt demgegenüber das Konzept des "Genpools". Am Beispiel der Kanarienzucht zeigt er, wie sehr noch die Züchtung artifiziell anmutender Gesangsqualitäten von Kanarienvögeln auf deren gattungsspezifisch vorhandenes genetisches Reservoir zurückgreift. Die mit geschlossenem Schnabel trällernden "Roller", die glucksenden "Wasserschläger" oder die kastagnettengleich klappernden "Timbrados" singen vielleicht auf markantere Weise als ihre Vorfahren auf der freien Wildbahn, aber nie auf gänzlich neue Art. Vielmehr haben die menschlichen Züchter immer schon auf Zuchtanstrengungen der Natur zurückgreifen können. Wilde Vogelweibchen haben sich unwillkürlich Männchen mit herausragenden Gesangsfähigkeiten herangezüchtet, indem sie sich nur mit denjenigen paarten, deren Gesang besonders ausgefallen war.
Nichts anderes sagt denn auch der Schöpfungsgedanke: Wir sind keine Schöpfer, sondern allenfalls Nachschaffende. Geschöpfe, die wir selber sind, verfügen wir zu keiner Zeit über die erste Initiative. Wir finden uns und die Welt bereits vor. Wir erschaffen nichts, was es nicht schon gäbe, auch wenn wir in die Welt eingreifen und unser Leben in unsere eigenen Hände nehmen. Wir wissen einigermaßen Bescheid über die Geschichte des Lebens, aber wir kennen nicht ihren Anfang. Charles Darwin hat sich für Entwicklungsgesetze des Lebens interessiert, ausdrücklich aber nicht für deren Ursprung.
Nur nach infantilem theologischen Verständnis gibt der Schöpfungsgedanke Auskunft über die Entstehung der Welt. Eher schon ist es gerade umgekehrt die Unaufhellbarkeit des Anfangs, die uns das Leben um uns herum als Schöpfung verehren lässt. Den Schöpfungsgedanken zu denken, heißt, sich über den einfachen Tatbestand von Leben und Welt in Verwunderung versetzen zu lassen. Aus dieser Verwunderung heraus fällt uns überhaupt erst ein, nach dem Sinn des Lebens im Allgemeinen und unseres eigenen im Besonderen zu fragen. Eben dies ist denn auch der Grund, warum sich in uns natürlicherweise etwas gegen den Evolutionsgedanken sträubt.
Der deutsch-amerikanische Biologe Ernst Mayr hat die These aufgestellt, wonach der Platonismus in unserem Denken die Hauptblockade gegen den Evolutionsgedanken darstellt. Irgendwie können wir die Idee einer totalen Veränderlichkeit von allem und jedem nur schwer ertragen. Als Sterbliche sind wir darauf angewiesen, Dinge und Lebewesen als solche wiederzuerkennen und mit ihnen uns selbst. Wir tragen Bilder von Dingen und Lebewesen in uns, an denen wir zeitlebens auch zukünftige Dinge und Lebewesen messen werden.
Richard Dawkins rehabilitiert sogar diesen unseren gleichsam eingeborenen anti-evolutionären Affekt. Mehr noch: Er überrascht uns mit einer Handreichung an den Kreationismus, wohlgemerkt in dessen theologisch reflektierter Form – die Naturwissenschaft und Theologie seit je miteinander koexistieren lässt.
"[...] selbst wenn sich letztlich herausstellen sollte, dass eine göttliche Intelligenz für die Gestaltung so komplexen Lebens verantwortlich ist, so ist jedenfalls eines klar: Er formt die Lebewesen nicht so ähnlich, wie beispielsweise Keramikkünstler ihre Produkte formen, oder auch Zimmerleute, Töpfer, Schneider oder Autohersteller. [...] Gott hat in seinem ganzen ewigen Leben nie einen winzigen Flügel gemacht. Wenn er etwas gemacht hat [...], dann war es ein embryologisches Rezept, eine Art Computerprogramm zur Steuerung der Embryonalentwicklung eines winzigen Flügels (und auch vieler anderer Dinge)."
Richard Dawkins:"Die Schöpfungslüge. Warum Darwin Recht hat"
Ullstein Verlag, Berlin/2010
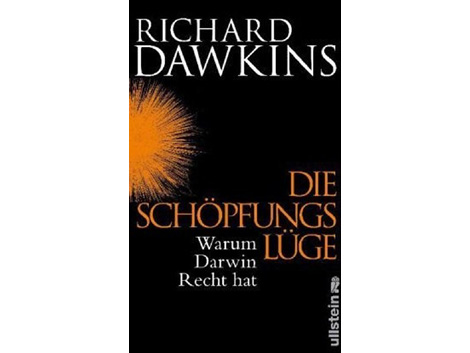
Richard Dawkins: "Die Schöpfungslüge. Warum Darwin Recht hat“.© Ullstein Verlag


