Hannah Arendt: Nach Auschwitz. Essays & Kommentare 1
Aus dem Englischen von Eike Geisel
Edition Tiamat, Berlin 2014
176 Seiten, 13 Euro
Eine kühle Analyse des Massenmordes

Strenge, Zynismus, Verharmlosung - Hannah Arendts Aufarbeitung der Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten provozierte heftigen Widerspruch. Ihr sachlich und kühl verfasster Bericht "Eichmann in Jerusalem" stieß vor 50 Jahren auf Unverständnis.
Als Hannah Arendts Berichte vom Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961 zunächst in der Zeitschrift "The New Yorker" und 1964 gesammelt in Buchform erschienen, sah sie sich vor allem zwei Vorwürfen ausgesetzt.
Zum einen warfen ihr viele jüdische Funktionäre, darunter auch enge Freunde, vor, über die mit den Nazis kollabierenden "Judenräte" zu streng geurteilt zu haben. Insbesondere ihre Beurteilung der Rolle Leo Baecks als "Präsident der Reichsvertretung der Deutschen Juden" erntete viel Widerspruch.
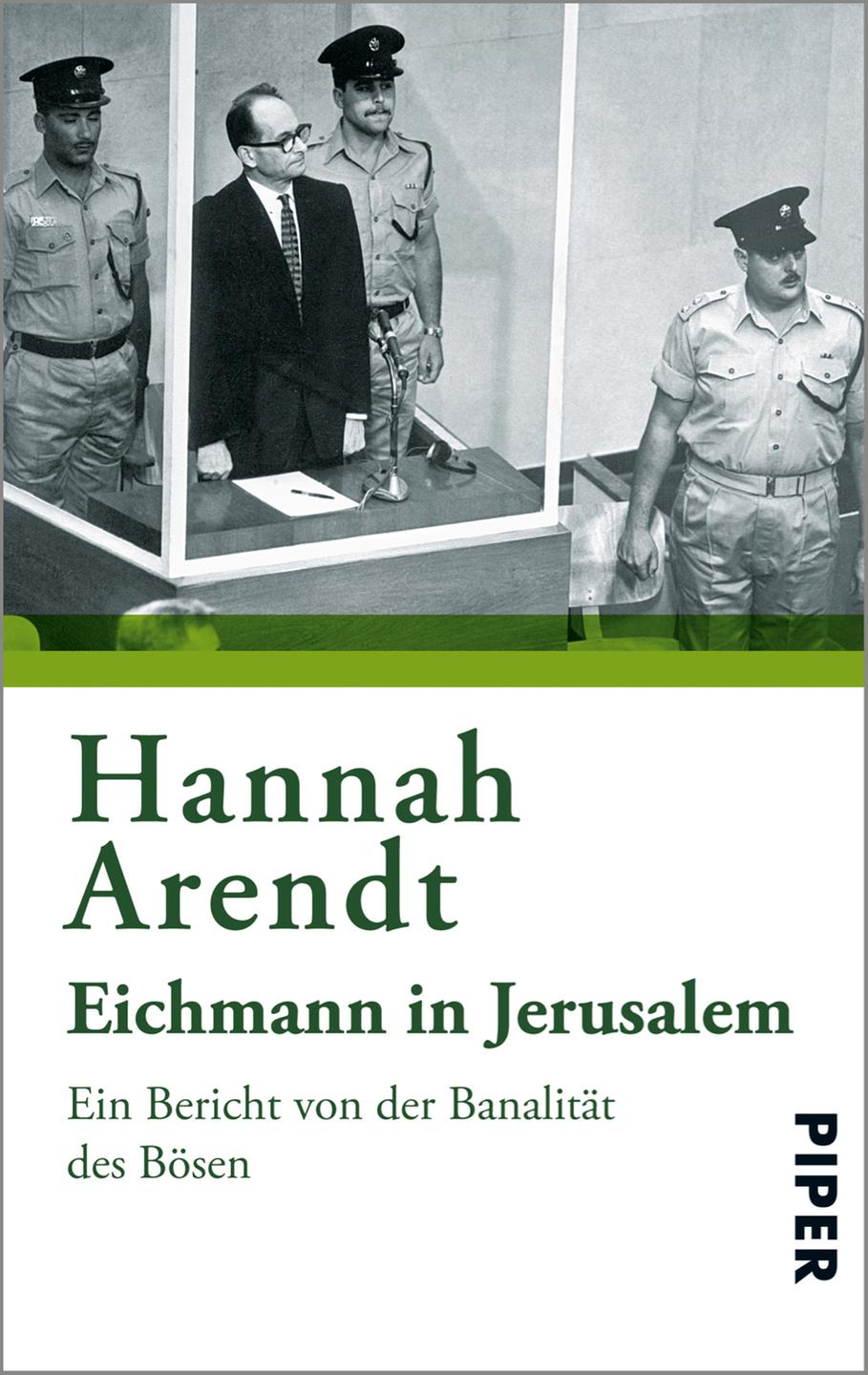
Cover: "Eichmann in Jerusalem" von Hannah Arendt© Piper
Heute, mehr als 50 Jahre nach Erscheinen des Buches und ausgestattet mit neuen historischen und sozialpsychologischen Erkenntnissen, kann man für die damalige Kritik an Arendt Verständnis aufbringen. In ihrem Entsetzen darüber, wie widerstandslos sich die Juden wie die Lämmer zur Schlachtbank führen ließen, ist sie wohl über das Ziel hinaus geschossen.
Der Vorwurf der Verharmlosung, der zweite, der damals gegen Arendts Analyse erhoben wurde, erscheint hingegen heute ungerechtfertigt. Ihr Wort von der "Banalität des Bösen" relativiert die Verbrechen der Deutschen an den Juden nicht. Mit der Formulierung sollte ja nicht ausgedrückt werden, dass das Böse banal ist.
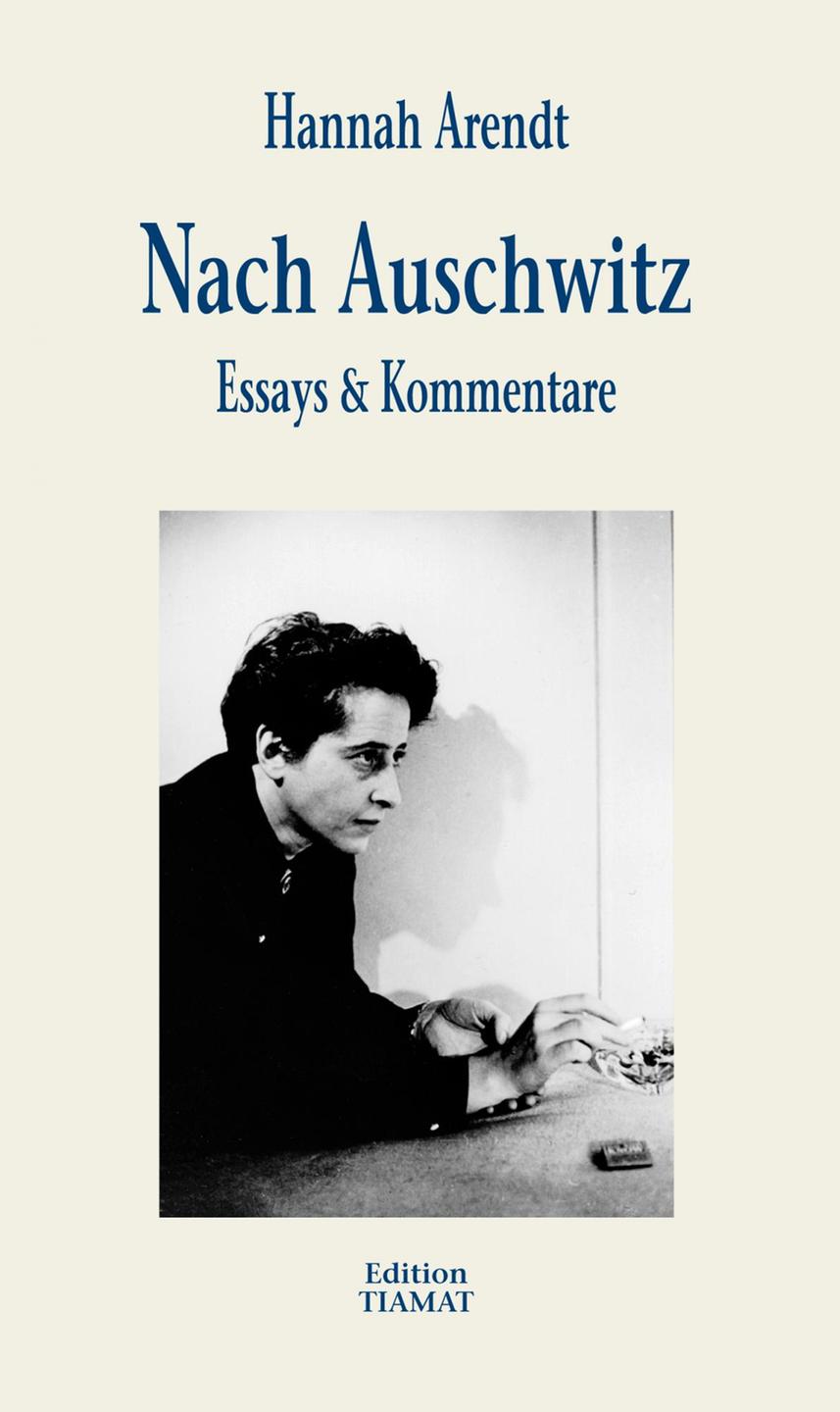
Cover: "Nach Auschwitz. Essays & Kommentare" von Hannah Arendt© Edition Tiamat
Ein "Hanswurst" als Exekutor
Vielmehr ging es ihr darum, zu erklären, wie ein unscheinbarer "Hanswurst" wie Adolf Eichmann zum Exekutor eines "Verbrechens an der Menschheit" werden konnte. Die Antwort auf diese Frage sollte zugleich helfen, eine andere Frage zu beantworten, die sich viele deutsche Juden gestellt hatten: Wie konnte es passieren, dass ein zivilisiertes Volk wie die Deutschen einen so gewissenlosen Massenmord beging?
Indem die Nazis die Vernichtung der Juden zu einem scheinbar zivilisierten Verwaltungsakt umdeuteten, erkannte Arendt. Schon 1950 in einem Aufsatz mit dem Titel "Die vollendete Sinnlosigkeit" hatte sie beschrieben, wie das Nazi-Regime den Massenmord bürokratisierte:
"Die frühere Grausamkeit der SA-Einheiten, die sich austoben und nach Belieben töten konnten, wurde nun ersetzt durch eine regulierte Todesrate und eine präzise organisierte Folter, bei der es nicht so sehr darauf ankam, den Tod sofort herbeizuführen, als das Opfer in einem permanenten Zustand des Sterbens zu versetzen."
Deshalb benötigten die Nationalsozialisten an den führenden Positionen ihres Verbrechenssystems keine Sadisten, sondern Biedermänner wie Adolf Eichmann.
Kühl und auf die Fakten konzentriert
Arendts kühler, auf die Fakten konzentrierter, manchmal sogar ironischer Ton, in dem sie diese These in "Eichmann in Jerusalem" vertritt, wurde ihr als Zynismus ausgelegt. In einem Briefwechsel wirft ihr der Religionshistoriker Gershom Scholem 1963 vor, ihr mangele es an "Ahavath Israel", an Liebe zu den Juden.
Das sei richtig, antwortet Arendt, sie liebe die Juden nicht, "sondern gehöre nur natürlicher- und faktischerweise zu diesem Volk". Heute, nach einer erneuten Lektüre von "Eichmann in Jerusalem", mag man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Hannah Arendts distanzierte Sprache und Analyse ihre Form der Trauerbewältigung war.
Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen
Mit einem einleitenden Essay und einem Nachwort zur aktuellen Ausgabe von Hans Mommsen
Piper Verlag, München 2011
448 Seiten, 12,99 Euro, auch als E-Book


