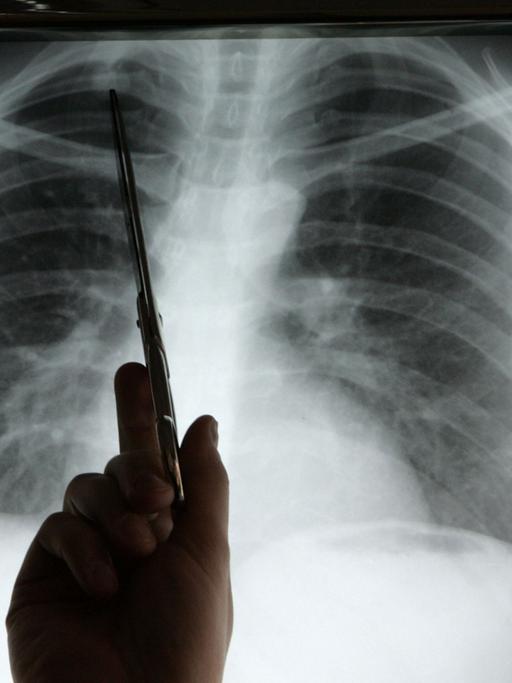Bewegung auf Rezept

Körperlich aktive Brustkrebs-Patientinnen können ein Wiederauftreten von Tumoren hinauszögern, das haben Studien gezeigt. Auch Depressive profitieren vom Sport. Die Wissenschaft sucht nun nach Beweisen für die Heilkraft der Bewegung.
"Wir spielen jetzt bisschen Sitzvolleyball, die meisten kennen's ja schon, rechts immer die Angabe, das heißt, wer rechts sitzt, macht die Angabe, ansonsten beim Wechsel wird immer nach rechts gewechselt, das kommt im Laufe des Spiels, los geht's."
In einer kleinen Turnhalle pritschen sechs Frauen und Männer einen Volleyball hin und her. Sie sitzen auf Bodenmatten. Der Ball muss über eine Schnur, die auf einer Höhe von etwa einem Meter gespannt ist. Die Frauen und Männer gehen das Ballspiel entspannt und locker an. Sie sind Patientinnen und Patienten der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Jena.
"Aktuell ist es die Sportgruppe aus der Ambulanz, die treffen sich bei mir zweimal die Woche, Montag und Donnerstag für eine Stunde zum Sport."
Tobias Mühlhaus, 28 Jahre alt, ist der Sporttherapeut der Gruppe.
"Wir machen jetzt im Winter mehr so Spiele drinne, bisschen Kraft, Ausdauer, an den Geräten oder halt im Raum. Und ansonsten findet auch viel draußen statt, ob's nun leichtes Walken ist, Joggen ist, viel freudbetonte Sachen sind ganz wichtig."

Die Krankenkassen fördern Bewegungs- und Entspannungskurse. © imago/Westend61
Eine Gruppe mit ambulant betreuten psychisch Erkrankten – zwischen 25 und 65 Jahre alt, mit den Krankheitsbildern Depression, Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie. Einige von ihnen waren stationär in der Uniklinik untergebracht. Sie werden nun wie alle anderen in der psychiatrischen Ambulanz versorgt. Ihre Ärzte haben die Patientinnen und Patienten zum Sport geschickt. Ein hagerer Mann im Trainingsanzug ist von diesem Angebot sehr angetan:
"Ich freu mich immer schon auf den Sonntag, wenn Montag wieder Sport ist, genauso auf den Mittwoch, wenn Donnerstag wieder Sport ist."
Der Mann ist 65, der Älteste in dieser Gruppe. Von allen Angeboten, erzählt er freundlich, kam für ihn nur Sport in Frage. Das habe ihm gefehlt.
"Diese manisch-depressive Erkrankung, die ich habe, die äußert sich nicht in einem Berg und nicht in einem Tal – Berg als manisch, Tal als depressiv – sondern ist ne leichte Wellenlänge. Manchmal geht's zur einen Richtung, manchmal zur anderen Richtung."
Mit Sport, sagt der Patient, fühlt er sich nun wohl. Es geht ihm besser.
"Freude. Positive Stimmung. Aber ohne dass es gleich wieder überschwappt. Sondern immer sich im Niveau behält. Dieses so genannte Ausdauertraining, dass nach ner Minute Liegestütze gemacht werden, wie viel man grade schafft. Und dann kommt die nächste Übung, dann kommt die Kniebeuge."
"Wenn alle sitzen, geht's los..."
Es geht darum, Passivität zu überwinden
Heute spielt Tobias Mühlhaus mit den psychisch kranken Patientinnen und Patienten weiter Sitzvolleyball. Er übt sonst auch mit ihnen auf der Weichbodenmatte Gleichgewicht und Koordination. Oder er trainiert mit ihnen Kraft und Ausdauer – an der Sprossenwand, auf dem Trampolin und beim Aerobic. Mühlhaus, ein Sportwissenschaftler und Personal Trainer, hat die Sporttherapie an der Uniklinik Jena mit aufgebaut. Auf sieben Stationen und in der Ambulanz wird sie nun durchgeführt.
"Ja auch die Inhalte haben sich entwickelt. Man hat gemerkt, dass man mit den Patienten viel machen kann. Nicht überlasten, dass man viel über freudbetonte Spiele mit reinbringt, viel Entspannungsübungen auch mit reinnimmt. Und Patienten einfach auch rauskommen, an die frische Luft, mit anderen zusammen sind, soziale Kontakte haben."
Das Ziel: Passivität zu überwinden. Wieder Antrieb zu bekommen. Leichter in den Tag zu starten – so erlebt auch der ältere Patient das Training.
"Diese ganzen Übungen, die wirken sich positiv auf meine Stimmung aus. Diese Gemeinschaft auch. Wenn einer den Ball verliert, da wird auch nicht gelacht. Es ist ein gutes Team."
Die Motivation an die kranken Menschen zu bringen – um auch selber wieder Motivation fürs Leben zu haben, für Belastungen im Leben. Und das ist eigentlich so die große Aufgabe als Sporttherapeut in der Psychiatrie. Es ist eigentlich der Türöffner, find ich oftmals. Natürlich das Gesamtkonzept aus Gesprächstherapie, aus Medikation, also verschiedene Therapien, die integriert werden in ein ganzes Konzept – aber Sporttherapie kann bei manchen Patienten auch der Türöffner sein. So hab ich's erfahren.
Körperliches Training, Gleichgewichtsübungen, Teamerfahrung und Freude am Spiel – für psychisch kranke Patientinnen und Patienten. Sie profitieren davon. Das steht außer Frage, unterstreicht Professor Karl-Jürgen Bär. Bär ist stellvertretender Leiter der Uniklinik Jena. Er sieht jedoch auch einen Mangel: Sport als Therapie gibt es in der Psychiatrie seit fünfzehn Jahren,
"das Problem aus meiner Sicht ist, dass wir Therapie anbieten, die aber ganz wenig wissenschaftlich untersucht ist."
Wie belastet ist der Körper wirklich?
Je nach Krankheitsbild liegen unterschiedliche Ergebnisse vor. Bei der Depression etwa können Studien und Langzeitanalysen bereits heute deutlich nachweisen: Mit Sport lassen sich leichte bis mittlere positive Effekte erzielen. Laufen steigert die Konzentration von Endorphinen im Blut, sie sind als Glückshormone bekannt. Bewegung regt auch die Ausschüttung der Botenstoffe Serotonin und Dopamin im Gehirn an, und diese so genannten Stimmungsmacher können Stress und Ängste abbauen. Ausdauertraining entlastet Patienten mit Panikstörungen, Anstrengung kann auch den Blutdruck senken und auf diese Weise Angstgefühle lindern. Durch Sport können depressive Patienten im besten Fall vorübergehend ihre Medikamente absetzen. All dies zeigen einzelne Untersuchungen und persönliche Erfahrungen. Doch lassen sich die vielen Erkenntnisse noch nicht verallgemeinern. Warum und auf welche Weise eine körperliche Aktivität bestimmte biochemische Vorgänge auslöst und wie diese wiederum auf spezielle Krankheitsbilder wirken – dies muss noch weiter erforscht werden. Daneben, sagt der Sportmediziner Professor Klaus-Jürgen Bär, gehe es in der Psychiatrie schon jetzt aber auch um eine andere Frage:
Wie erfährt der Patient die Bewegung? Den Sport? Was kann ein depressiver Patient wirklich empfinden und was hilft ihm? Und das ist eine hochindividuelle Sache.
In einem Labor der Uniklinik tritt ein gesunder Mann in die Pedale eines Ergometers.
"Hier ist jetzt ein Proband auf dem Fahrrad-Ergometer belastet worden und hat sich immer mehr gesteigert, bis er subjektiv gesagt hat, es ging nicht mehr. Und bis ich hier anhand bestimmter Daten auch gesehen hab, dass nicht mehr wirklich viel geht."
Der Sportwissenschaftler Marco Herbstleb. Auch psychisch Kranke werden hier auf diese Weise getestet. Herbstleb vergleicht das subjektive Empfinden einer so genannten "Ausbelastung" also den Satz "Ich kann nicht mehr" mit objektiven Ausbelastungskriterien: mit der Herzfrequenz oder der eingeatmeten Sauerstoffmenge.
"Wir wollen wissen: Sind sie wirklich körperlich schlechter drauf als seelisch Gesunde oder potentiell gesunde Menschen?"
Und wie empfindet das ein Patient? Ist sein Körper denn wirklich ausbelastet, wenn er sagt, es geht nicht mehr? Die Forscher beobachten dann, wie sich die Daten der Patienten unter Anstrengung verändern. Denn vielleicht lässt sich ja ihre körperliche Belastung wiederum gezielt zum Schutz einsetzen. Etwa bei der Schizophrenie
"Patienten mit Schizophrenie haben ein sehr hohes kardiales Risiko, an Herzinfarkt oder solchen Ereignissen zu versterben. Wie verändert also die Erkrankung die Regulation – von Herz, Blutdruck – während sportlicher Übung? Weil natürlich Sport eine Möglichkeit wäre, kardioprotektiv zu wirken."
Sport kann solche Risiken senken. – Bei psychisch Erkrankten, sagt Karl-Jürgen Bär, spielt dabei die subjektive Wahrnehmung des Sports eine besonders große Rolle. Ein Suchtpatient etwa sollte nicht das Gefühl haben, ganz ausbelastet zu sein. Sonst besteht die Gefahr, dass er die Sucht auf den Sport überträgt. Oder Angstpatienten können mit intensivem Sport sogar ungewollt neue Angstattacken provozieren.
"Unsere Idealvorstellung wäre: Ein Patient hat auf seiner Station, in seinem ambulanten Setting Sporttherapie, er erlebt hierbei bestimmte Veränderungen, bestimmte Dinge, und kann das in der Psychotherapie oder im Gespräch mit dem Arzt wieder reflektieren, und kann dabei etwas über sich, über den Sport lernen – und geht dann wieder erneut zur Sporttherapie. Also als integraler Bestandteil eines großen Behandlungsplanes."
Körperliches Training kann gegen Depressionen helfen
Allein durch Sport lässt sich eine psychische Erkrankung wie eine Depression also nicht komplett lindern, jedenfalls nicht allgemeingültig. Ein körperliches Training beeinflusst jedoch in jedem Fall diejenige Person, die es betreibt. Ab wann und in welchem Fall diese Wirkung genügt, um Sport statt Pillen zu verschreiben, muss sich noch zeigen. Der Münchner Sportmediziner und Kardiologe Professor Martin Halle spricht trotzdem schon von einem Paradigmenwechsel.
"Die Medizin muss umdenken, dass es eben wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass man ein körperliches Training wie ein Therapeutikum einsetzen kann, additiv zu Medikamenten einsetzen kann. Weil es andere Wege im Körper anspricht, so dass es eine Synergie gibt zwischen Medikamenten und dem körperlichen Training."
Das Beispiel Diabetes Typ2, der sogenannte Altersdiabetes, den vor allem Übergewichtige entwickeln.
"Wenn Insulin ausreichend da ist, geht die Tür auf in der Muskelfaser, und Zucker kann in diese Zelle eindringen. Wenn dieses Scharnier der Tür, wenn das nun eingerostet ist und die Tür nicht mehr ausreichend aufgeht, muss ich mit viel mehr Druck den Zucker in die Zelle hinein ja -bringen, -drücken. Deswegen brauche ich mehr Insulin. Aber das Urproblem, die Scharniere eben wieder auch gängig zu machen, das kann nur durch körperliches Training bewirkt werden, und das tut es auch. Denn diese Glukosetransporter funktionieren auch ohne Insulin, wenn sie durch körperliches Training angesprochen sind."
Das bedeutet: Es ist durchaus möglich, dass Diabetes-Patienten irgendwann einmal auf Insulinspritzen oder Medikamente verzichten können. Vorausgesetzt, sie beginnen rechtzeitig abzunehmen und sich regelmäßig zu bewegen. Der Sportmediziner Halle kritisiert, dass dies bereits seit über zehn Jahren in der Wissenschaft bekannt ist. In der Praxis würde aber selten verordnet, den Lebensstil frühzeitig gezielt zu ändern.
"Und nichts schlimmer ist, als den Patienten in einer Ungewissheit zu lassen und zu sagen: Ja, gehen Sie mal jeden Tag irgendwie spazieren. Oder melden sie sich in der Nordic Walking Gruppe Ihres Vereins an. Oder machen Sie drei mal die Woche Sport, indem Sie joggen. Alle drei Empfehlungen sind falsch!"
Der übergewichtige Typ2-Diabetiker, 30 Jahre alt, der in seinem ganzen Leben nie sportlich aktiv war, muss anders beraten und begleitet werden als der eher schlankere ältere Diabetes-Patient, der eine Herzerkrankung hat.
"Diese Empfehlung muss eine Ärztin oder ein Arzt geben! Punkt. Ein Rezept mit Medikamenten auf der einen Seite und ein Rezept zur Bewegung auf der anderen Seite, wenn das nicht nebeneinander an den Patienten weiter gegeben wird. Dann ist der erste Schritt schon verpasst."
Krebs haben und trotzdem laufen
Kranke Menschen zu aktivieren, ist ein langwieriger Prozess. Schon vor Jahrzehnten haben die Mediziner vor allem Herzpatienten statt einer Schonung mehr Bewegung sprichwörtlich ans Herz gelegt: Wer seinen Kalorienverbrauch steigert, senkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass seine Herzkranzgefäße verkalken. Sport hält die Arterien gesund und verhindert auf diese Weise Schlaganfälle und Infarkte. Bewegung stärkt aber auch die Knochensubstanz und vermindert das Risiko, im Alter an Osteoporose zu erkranken, dem Verlust an Knochendichte und -stabilität. Soviel ist mittlerweile klar.
Das körperliche Training gibt zusätzlichen Schutz vor einer ganzen Reihe von Erkrankungen. Nichtstun ist aber auch nach Krankheitsausbruch oftmals nicht förderlich. Es verschlechtert sich sogar meist die Lebensqualität. Dies gilt, so weiß man heute, auch für Krebspatienten. Gerade hier aber hat setzt sich das Bewusstsein jetzt erst durch.
Das körperliche Training gibt zusätzlichen Schutz vor einer ganzen Reihe von Erkrankungen. Nichtstun ist aber auch nach Krankheitsausbruch oftmals nicht förderlich. Es verschlechtert sich sogar meist die Lebensqualität. Dies gilt, so weiß man heute, auch für Krebspatienten. Gerade hier aber hat setzt sich das Bewusstsein jetzt erst durch.
Die Berlinerin Annette Hinrichsen ist im Jahr 2003 erkrankt. Die aktive Läuferin stieß damals auf viel Unverständnis.
"Da war meine erste Frage: Kann ich weiterlaufen? Und da haben mir auch viele Ärzte gesagt: Was? Laufen? Jetzt setzen Sie sich erstmal in die Ecke und warten ab, was mit Ihnen passiert. Wenn diese Chemo da über Sie kommt."
Damit wollte sich die Brustkrebspatientin nicht zufrieden geben – und fand dann doch eine Medizinerin, die sie ärztlich und wissenschaftlich beim Laufen begleitete. Seit elf Jahren betreut Annette Hinrichsen nun über den Verein Krebssportgemeinschaft Berlin e.V. eine Laufgruppe mit brustkrebskranken Frauen. Die Gruppenleiterin ist selbst Sportlehrerin, Krankengymnastin und Lauftherapeutin.
Zweimal pro Woche treffen sich die Frauen in den Abendstunden, bei Sonne, Regen und Sturm. Die jüngste unter ihnen ist Mitte Vierzig, die älteste 71 Jahre alt.
"Ich hab während der Chemo angefangen, und musste dann nochmal zum Schluss unterbrechen. Und das war aber gut. Weil die Schmerzen und all das waren nicht so schlimm. Und so lange ich laufen konnte, dachte ich, dann wird's wohl gehen."
"Man wird auch innerlich so ärgerlich auf den eigenen Körper. Und ich hatte die Hoffnung, dass das Laufen mich wieder so ein bisschen versöhnt mit mir, sieht, dass da noch so gewisse Reste an Leistungsfähigkeit sind, die aktiviert werden können und natürlich habe ich mich auch einfach auf die Gruppe gefreut."
"Ich hab bei Null angefangen. Und das ist doch ne starke Säule gewesen. Ich war fitter als vorher, und seelisch, psychisch ist das natürlich unschätzbar. Der Geist ist klarer und frischer, man hat mehr Zuversicht, und man ist einfach besser drauf, also es macht ganz viel mit einem."
"Man wird auch innerlich so ärgerlich auf den eigenen Körper. Und ich hatte die Hoffnung, dass das Laufen mich wieder so ein bisschen versöhnt mit mir, sieht, dass da noch so gewisse Reste an Leistungsfähigkeit sind, die aktiviert werden können und natürlich habe ich mich auch einfach auf die Gruppe gefreut."
"Ich hab bei Null angefangen. Und das ist doch ne starke Säule gewesen. Ich war fitter als vorher, und seelisch, psychisch ist das natürlich unschätzbar. Der Geist ist klarer und frischer, man hat mehr Zuversicht, und man ist einfach besser drauf, also es macht ganz viel mit einem."
45 Minuten Laufen oder schnelles Gehen, 45 Minuten ergänzende gymnastische Übungen. Annette Hinrichsen bittet am Anfang jede Frau, sich an ihrer Pulsfrequenz zu orientieren. Der Puls sollte mindestens bei 100 liegen, das Sprechen miteinander nicht zu kurzatmig werden. Was zu viel und was zu wenig ist, sollen die Frauen selbst merken.
"Das richtige Einpendeln auf den richtigen Trainingspuls, das eben nachspüren, wie sich das anfühlt. Dass man's im Gespür hat. Die Zeit ist wichtig. Wir wollen immer länger laufen. Das wirkt sich eben auch auf das allgemeine Leistungsvermögen im Alltag und überall wirkt sich das aus. Das längere durchhalten können oder sich auch etwas vornehmen. Dieses Anfang setzen, Ziel erreichen, das ist ein ganz wichtiger Punkt."
Eine Therapie für die Psyche, aber nicht nur
Dann geht es raus auf die Stadionbahn, neben die Fußball trainierende Jugend. Zu Beginn vor elf Jahren, erzählt Annette Hinrichsen, war das Interesse an ihrer Gruppe noch sehr gering. Inzwischen aber stehen fünfzehn Krebspatientinnen auf ihrer Liste.
"Tut euch zusammen, Frauke, Jutta, Helga, Barbara, und du bist auch Alleinkämpferin heute, Sabine? Ich komm zu jedem dann dazu. Wir drehen hier unsere Runden."
Die Krankenkassen unterstützen das Selbsthilfetraining der Berliner Frauen. Auch die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft veröffentlichen seit einigen Jahren Empfehlungen zu Bewegung und Sport für Krebspatienten. Sie verweisen auf eigene Gruppen, die Landessportbünde und Behindertensportverbände. Das Interesse nimmt zu – die Zahl der tatsächlich Aktiven ist daneben immer noch erstaunlich klein.
Eine Brustkrebspatientin ist auf dem Campus der Technischen Hochschule in München auf dem Weg zur Sporttherapie-Beratung im Zentrum für Prävention und Sportmedizin. Hierher kommen mittlerweile rund 10.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr.
Die Frau mittleren Alters möchte anonym bleiben. Professor Martin Halle holt sie an der Anmeldung ab.
"Sie kommen zur Untersuchung? – Patientin ist das erste Mal bei uns. – Kann ich sie gleicht mitnehmen? Wunderbar. Dann haben wir hier die Akte, also dann gehen wir mal hier lang."
Die Patientin erzählt, ihre Gynäkologin habe sie zur Sporttherapie überwiesen. Sie selbst sei noch im Schock. Während der Krebsbehandlung mit Operation, Bestrahlung und Chemotherapie jetzt auch noch Sport zu treiben, könne sie sich überhaupt nicht vorstellen. Aber sie will es versuchen.
"Bevor Chemotherapie und Strahlentherapie beginnen, machen wir das täglich, ich will Sie gerne jetzt hier noch etwas aufbauen. Wenn die Chemotherapie dann mal kommt, dann machen wir es definitiv an den Chemotherapietagen nicht. Und passen das von einer Woche auf die nächste an, und wenn es gut geht, geht's weiter. Wenn's nicht gut geht, sehen wir uns und hören wir uns."
Laufen ist möglich, Ergometertraining oder auch Rudern mit dem Thera-Band als Kraftübung. – Im Fitnesscenter des Zentrums, bei einem Physiotherapeuten, zu Hause. Der Mediziner bestärkt die Frau: Körperlich aktive Brustkrebspatientinnen können ein Wiederauftreten von Tumoren hinauszögern, das haben Studien gezeigt. Martin Halle warnt jedoch auch davor, die Hoffnungen nun darauf zu reduzieren.
"Es ist eine unterstützende Therapie für die Psyche, und es ist eine unterstützende Therapie, um die Chemo- und Strahlentherapie besser zu tolerieren – und damit, ja das zeigen wirklich die Erkenntnisse schon, damit auch die Prognose zu verbessern."
Die Erwartungen sind hoch. Martin Halle nennt das Beispiel Darmkrebs, die häufigste Krebserkrankung bei Männern und Frauen in Deutschland: Hier gibt es Hinweise, dass körperliches Training einen Botenstoff in den Muskelfasern ausschüttet, der die Polypenbildung im Darm hemmt. Polypen können zu bösartigen Tumoren entarten, dieser Botenstoff verhindert also die Vorstufen von Darmkrebs.
Auch die Sicht auf die Rolle der Muskulatur verändert sich: Sie wird zu einem Mitspieler im körperlichen Stoffaustausch. Der Bewegungsapparat beeinflusst die Vorgänge im Körperinneren also mit. Trotzdem muss noch weiter sortiert werden, was Bewegung als Heilmittel wirklich kann, um sie sinnvoll einzusetzen. Um vorzubeugen, zu schützen, aufzubauen, zu stärken. Körperlich wie psychisch. Gegen Niedergeschlagenheit oder gegen Antriebslosigkeit. Sporttherapie bleibt dabei immer individuell.
"Es kann nicht anders sein. Ansonsten würde ich Krankheiten auf wenige biochemische Prozesse reduzieren, und damit werden wir dem Mensch nicht gerecht. Weil im Gegensatz zur reinen Pharmakotherapie ist die Therapie mit Sport eine Möglichkeit, Patienten zu aktivieren und zu sagen: Hey, du musst selber was dafür tun, und dann merkst du auch, es wird dir etwas besser gehen. Und dann hat man viele viele Effekte, die allein dadurch mit zustande kommen."
Wichtig für die Heilung ist das richtige Maß
Auf viele der Effekte hat die Wissenschaft jedoch noch keine genauen Antworten. Wie auf die Frage, warum der Sport uns besser denken lässt. Wer rastet, der rostet auch im Gehirn. Wer sich bewegt, verbessert – zumindest für eine Weile – seine Konzentration. Diese Gewissheit gilt für Jung wie Alt. Und auch sie wird Stück für Stück erforscht. Die Neurologin Agnes Flöel, Professorin an der Berliner Charité, untersucht gerade, ob ein körperliches Training die Gedächtnisleistung von 50- bis 80-Jährigen verbessert. Sie sind gesund, die meisten haben aber einen leicht erhöhten Blutzuckerspiegel, und dadurch auch ein leichtes Risiko, an Demenz zu erkranken. Zum Start wurde das Blut der Probanden untersucht und das Zusammenspiel ihrer Hirnstrukturen abgebildet. Dann mussten sie eine Liste von fünfzehn Wörtern wiederholen. Unmittelbar nach Ansage – und 30 Minuten später.
"Das eine nennt man die Abrufleistung, das ist ein bisschen schwieriger, freier Abruf. Und das andere ist die Wiedererkennensleistung, das ist etwas einfacher."
Danach wurden die Frauen und Männer in zwei Sportgruppen aufgeteilt. Die einen trainierten gymnastische Übungen: Gleichgewicht halten auf Bällen zum Beispiel, erzählt Ursula Wolff, die dabei war:
"Auf diesem Gymnastikball sitzend, ohne die Hände zu benutzen, die Beine hoch zu heben, ein Bein und dann noch einen Namen zu schreiben in der Luft, also das ist schon sehr schwierig."
Die anderen trainierten auf dem Fahrrad-Ergometer und sollten sich dabei auch steigern.
"Und die Hypothese ist, dass insbesondere die Probanden, die diese kardiovaskuläre Übung durchführen über sechs Monate, dreimal pro Woche, dass die sich verbessern."
Ob das gezielte Herz-Kreislauf-Training die Merkfähigkeit der Probanden nun tatsächlich verbessert – die Auswertung wird es zeigen. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten vielleicht alle ein wenig vorbeugen.
"Wenn man in dieser Phase solche Trainingsprogramme durchführt, hofft man, dass man die tatsächliche Alzheimer-Krankheit zumindestens verschieben kann. Außerdem darf man nicht vergessen, dass durch das Training die Gefäße positiv sich entwickeln. Das heißt, dass die Gehirndurchblutung beispielsweise verbessert wird, und dass auch die Zahl der Schlaganfälle, eben auch so kleiner, abnimmt. Und man weiß inzwischen, dass grade diese kleinen Schlaganfälle diesen Alzheimerprozess nochmal besonders anheizen. Also es gibt wirklich mehrere positive Effekte, den der Sport haben kann."
"Wenn ich körperlich aktiv bin, wenn ich geistig aktiv bin, wenn ich rege bin, dann ist das auch für meinen Kopf – das ist mir eigentlich klar."
"Wenn ich körperlich aktiv bin, wenn ich geistig aktiv bin, wenn ich rege bin, dann ist das auch für meinen Kopf – das ist mir eigentlich klar."
Die einen profitieren mehr, die anderen weniger. Die Heilkraft des Sports ist in vielen Dingen noch ein Versprechen – doch auch dies kann motivieren. Denn Bewegung hilft in jedem Fall stets besser durch den Tag und durch das Leben. Das richtige Maß vorausgesetzt. Risiken und Nebenwirkungen hat auch dieses Mittel.