Helge-Ulrike Hyams: "Denk ich an Moria: Ein Winter auf Lesbos"
Berenberg Verlag, 2021
160 Seiten, 16 Euro
Die alltägliche Überforderung
07:23 Minuten
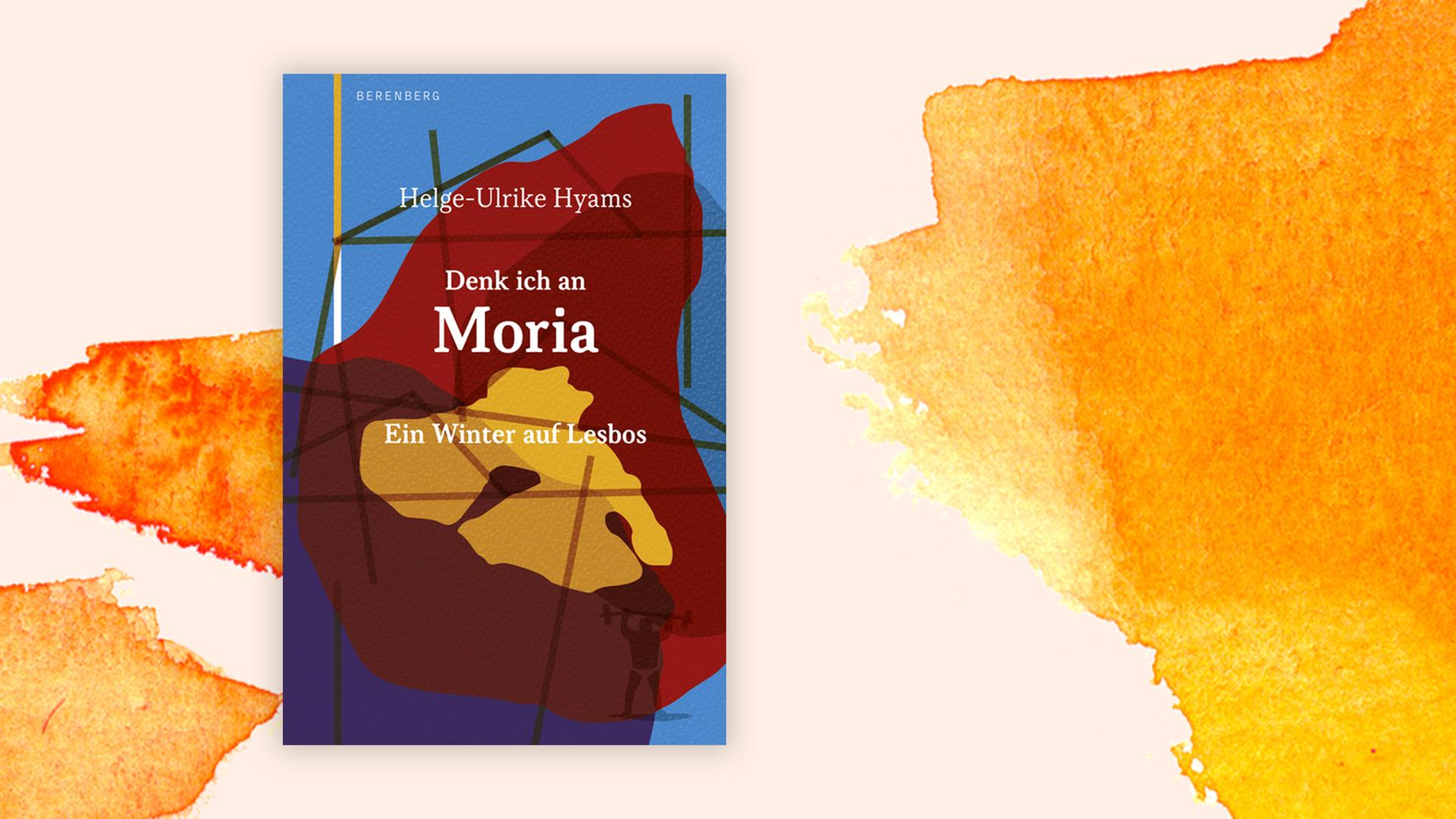
Was treibt freiwillige Helfer an, Flüchtlingen in der Not zu helfen? Wie gehen sie mit dem Druck und den Belastungen auf Körper und Seele um? Das beschreibt die 79-jährige Helferin Helge-Ulrike Hyams in ihrem Erfahrungsbericht "Denk ich an Moria".
Vor etwas mehr als einem halben Jahr brannte auf der Insel Lesbos das Flüchtlingslager Moria ab. Auch im neuen Lager Kara Tepe sind die Verhältnisse schlecht. Wasser- und Strommangel, Kälte und Hunger, Krankheiten und psychische Leiden mit Suizidgefahr sind an der Tagesordnung. Um einen kleinen Teil der Not zu lindern sind – trotz Pandemie – unverändert Dutzende Hilfs- und Freiwilligen-Organisationen auf Lesbos tätig.
Neben spezialisierten Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen mit ausgebildetem Personal sind es vor allem freiwillige Helfer, sogenannte Volunteers, die nach Lesbos reisen. Für viele eine Feuertaufe in Sachen Flüchtlingshilfe. Freiwillige Flüchtlingshelfer gelten vielen als Idealisten, die Lebenszeit opfern und Karrierebrüche in Kauf nehmen.
Zehn Monate auf Lesbos
Aber es gibt die andere Seite, wenn die Rückkehr in die Heimat zum Problem werden kann und sich das schwer vermitteln lässt, wie Helge-Ulrike Hyams gleich zu Beginn anmerkt: "Immer wieder erfuhr ich, dass die Zurückgekehrten Schwierigkeiten hatten, den Freunden und Familien das auf Lesbos Erlebte zu schildern. Wie erzählen von den abrupten Stimmungswechseln, denen man in Moria ausgesetzt war? Von den schlaflosen Nächten? Von der Dauerübermüdung? Von der Scham, abends in ein warmes Bett zu kriechen, im Wissen, dass die Migranten zur selben Zeit in ihren Zelten froren? Von der Wut über die eigene Ohnmacht, mit der man täglich konfrontiert war?"
Zehn Monate war Hyams auf Lesbos als Freiwillige. Ihre Erlebnisse versucht sie in kurze Kapitel zu ordnen, einzuordnen, fragmentarisches Zeugnis abzulegen. Denn wer einmal Fuß in dieses Konfliktgebiet ohne Waffen gesetzt hat, mitten in Europa, hat täglich mit Euphorie und Überforderung zu tun, mit Chaos und Selbstzweifeln. Ihr anfänglichen Eindrücke und Gefühle hat sie mir bei einer Begegnung auf Lesbos so beschrieben: "Die erste Woche, das ist man wie unter Drogen. So gefordert, reingeschleudert in das Geschehen. Wenn du 1000 Leute fütterst innerhalb von 20 Minuten, da bist du bis an die Grenzen gefordert. Jedenfalls ich von meinem Leben."
Eine Art heile Welt anbieten
Auf dem Gelände der Schweizer NGO One Happy Family herrschte bis zum zweiten Lockdown Ende 2020 reger Betrieb. Gesang, Sprachunterricht, Computerkurse. Hyams sagt in der Rückschau: "Bei uns sollte vom Anspruch her eine Art heile Welt sein. Wir wollten, dass sie die Qual vom Camp hinter sich lassen. Wir haben sie freundlich empfangen. Manche lächelten den ganzen Tag. Ich konnte das nicht immer. Aber strukturell freundlich zu sagen: Ruht euch aus. Hier kriegt ihr Kaffee und Tee. Es war quasi die Gegenwelt. Dass sie ein paar Stunden vom Lager sich befreien konnten. Das war, glaube ich, der Auftrag von One Happy Family."
In diesem Angebot lag und liegt, das macht die Helferin und Autorin deutlich, das Risiko einer Überforderung, kollektiv wie für den Einzelnen. Die Autorin notiert Lichtmomente, wie das gemeinsame Häkeln mit Flüchtlingen, das Spannungen löst und kurzzeitige Beziehungen schafft. Daneben beschäftigt sie immer wieder das Innenleben ihrer und anderer Hilfsorganisationen. Sie notiert eine unbewusste Abgrenzung der Helfer zur Wirklichkeit, die sie umgibt.
Missverständnisse und Gewalt im Insel-Alltag
Die griechische Bevölkerung etwa und der Alltag der Menschen auf der Insel seien für die meisten NGOs kaum ein Thema gewesen, meint die Autorin. Die Missverständnisse – hier das Gefühl, übergangen und dominiert zu werden; dort der Anspruch, möglichst konsequent die Ziele der NGO durchzusetzen – hätten sich während des Winters 2019/20 deutlich verschärft. Das Ergebnis ist bekannt: Im Frühjahr 2020 gipfelt die Entfremdung zwischen Griechen und ausländischen Helfern in Gewalt.
Hyams meint, der Umschwung gegen Flüchtlinge und NGOs sei nicht über Nacht gekommen. "Er schlich sich unbemerkt ein, in kleinen Szenen auf der Straße, in den Cafés, in den Bussen – überall. Er eskalierte in einem Ausmaß, das keiner je erwartet hatte – in Großdemonstrationen, Schlägereien und Brandstiftungen." Um den Konflikt zu verstehen, argumentiert Hyams, dürfe man die Folgen der lang anhaltenden Wirtschaftskrise nicht vergessen.
Seit Jahren sei der Touristenstrom rückläufig, längst legten keine Kreuzschiffe mehr in Mytilini an und auch die Charterflüge aus ganz Europas wurden weniger. Das gastfreundliche Lesbos bekam in westlichen Medien den Anstrich einer Insel mit ausländerfeindlichem Charakter. Ein Bild, das der Band ein ums andere Mal korrigiert.
Hyams selbst suchte früh den Kontakt zu Griechen auf Lesbos. Das gelang ihr. Ihr Buch erzählt von Hilfe und Beziehungen, die dankbar angenommen werden von Einheimischen und Flüchtlingen. Zugleich erzählt sie von wiederkehrenden Missverständnissen und kultureller Verwirrung zwischen Freiwilligen, Einheimischen und Flüchtlingen.
Das Dilemma der Freiwilligen
Hyams Bild von den Freiwilligen hat Diagnosecharakter: "Die Volunteers in Lesbos waren eine ganz eigene Spezies. Meist ausgeprägte Individualisten, unkonventionell und unangepasst. Sie identifizierten sich mit dem Leid der Lagerinsassen. Trotzdem empfanden sie sich selbst als Teil dieses Systems, als dessen Handlanger. Ein Dilemma, für das es keinen Ausweg gab. Was immer wir taten an täglicher Arbeit, es konnte nie richtig sein. Und dennoch war es notwendig."
Der Ausweg aus diesem Dilemma wäre ein Innehalten, ein Nachdenken. Dazu, so die Autorin im Rückblick, kommt es in den seltensten Fällen. "Mehr Selbstkritik – dazu ist kein Platz, dazu ist keine Zeit. Die Organisationen sind dermaßen mit sich selbst, mit dem Stress, mit dem täglichen Reagieren beschäftigt, dass sie sich nicht genügend Zeit für Selbstreflexion lassen."
Mit bald 80 Jahren ist Helge-Ulrike Hyams eine der ältesten Freiwilligen auf Lesbos. Gerade deshalb ist ihr Buch eine Schatztruhe für die junge Generation. Die davon träumt, sich nützlich zu machen, sich zu beweisen. Die Erkenntnis, die die studierte Psychoanalytikerin an die Jüngeren weitergibt, lautet: Achtet auf euch selbst, bevor ihr auszieht, um anderen grenzenlos zu helfen. "Ja, die jungen Volunteers sind ge- oder überfordert. Aber sie lassen den Schmerz nicht genügend an sich heran."
Und Moria? Über Stichworte wie Müll, Exkremente, Suizid, Kinder und Trauma gelangt die Autorin zur Frage, die eigentlich keine mehr ist: Warum Moria brannte. "Moria brannte nicht, weil ein paar junge Männer gezündelt haben. Moria brannte, weil das Leben der Lagerbewohner in eine Sackgasse geraten war, die symbolisch für die gesamte Flüchtlingspolitik steht. Und Corona hat die ausweglose Situation der Migranten nur forciert und verschlimmert. Moria war das Pulverfass, die Pandemie der Brandbeschleuniger."






