Herrschaft der Rechtsanwälte und Lobbyisten
Die westliche Welt steckt in der Krise, meint der britische Historiker Niall Ferguson - und Schuld daran ist der Verfall unserer Gesetze und Institutionen. Seine Antwort: weniger Staat, weniger Regulierung, weniger Bürokratie.
Den vielen Büchern über die Krise der westlichen Welt hat Niall Ferguson ein weiteres hinzugefügt. Er untersucht, inwieweit Wirtschaft und Politik für den Verfall verantwortlich sind.
Wohltuend ist, dass der renommierte Historiker weder den kurzen Blick der Soziologie, noch den ideologischen der Politologie, sondern den langen der Geschichtswissenschaft wählt, wenn er den aktuellen Zustand der Marktwirtschaft mit den Vorstellungen ihrer Theoretiker wie Adam Smith konfrontiert oder sie mit sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts vergleicht.
Hierbei konzentriert er sich auf die historische Entwicklung der Staatsschulden. Niall Ferguson versucht aus einer innovationsarmen Debatte auszuscheren:
"Dieses Buch handelt von den Ursachen unseres Stillstandes. Seine Hauptthese lautet, dass das, was zu Smiths Zeiten auf China zutraf, heute für große Teile der westlichen Welt gilt. Heute sind unsere Gesetze und Institutionen das Problem. Die große Rezession ist bloß ein Symptom einer tiefgreifenden Degeneration."
Der Ökonom Adam Smith hatte im ausgehenden 18. Jahrhundert China als eine große Zivilisation beschrieben, die sich um Reichtum und Fortschritt, Macht und Einfluss brachte, weil ihre Institutionen versagten, weil Rechtsbeugung, Bürokratie und Korruption das Riesenreich in die Knie zwangen. Nicht anders, so Niall Ferguson, ergeht es heute der westlichen Welt.
"Um das zu beweisen, dass die westlichen Institutionen tatsächlich heruntergekommen sind, werde ich einige vor langer Zeit versiegelte Blackboxes öffnen müssen."
Wohltuend ist, dass der renommierte Historiker weder den kurzen Blick der Soziologie, noch den ideologischen der Politologie, sondern den langen der Geschichtswissenschaft wählt, wenn er den aktuellen Zustand der Marktwirtschaft mit den Vorstellungen ihrer Theoretiker wie Adam Smith konfrontiert oder sie mit sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts vergleicht.
Hierbei konzentriert er sich auf die historische Entwicklung der Staatsschulden. Niall Ferguson versucht aus einer innovationsarmen Debatte auszuscheren:
"Dieses Buch handelt von den Ursachen unseres Stillstandes. Seine Hauptthese lautet, dass das, was zu Smiths Zeiten auf China zutraf, heute für große Teile der westlichen Welt gilt. Heute sind unsere Gesetze und Institutionen das Problem. Die große Rezession ist bloß ein Symptom einer tiefgreifenden Degeneration."
Der Ökonom Adam Smith hatte im ausgehenden 18. Jahrhundert China als eine große Zivilisation beschrieben, die sich um Reichtum und Fortschritt, Macht und Einfluss brachte, weil ihre Institutionen versagten, weil Rechtsbeugung, Bürokratie und Korruption das Riesenreich in die Knie zwangen. Nicht anders, so Niall Ferguson, ergeht es heute der westlichen Welt.
"Um das zu beweisen, dass die westlichen Institutionen tatsächlich heruntergekommen sind, werde ich einige vor langer Zeit versiegelte Blackboxes öffnen müssen."
Die wachsenden Staatsschulden sind die größte Gefahr
Ursache und Verlauf des Niederganges untersucht der Historiker am Beispiel von vier Themenfeldern, die er Blackboxes nennt: Demokratie, Kapitalismus, Rechtsstaat und Zivilgesellschaft. Was allerdings an diesen oft diskutierten Themen geheimnisvoll und versiegelt sein soll, erschließt sich dem Leser nicht.
Die größte Gefährdung der Demokratie sieht der Autor in den wachsenden Staatsschulden, die den Gesellschaftsvertrag zwischen den Generationen auflösen. Gleichzeitig hält er es für eine Illusion zu glauben, die Marktwirtschaft mit Hilfe von komplexen Gesetzen steuern und so Krisen verhindern zu können.
"Der Rechtsstaat hat viele Feinde, aber zu den gefährlichsten gehören die Verfasser langer, umfangreicher Gesetzestexte."
Dabei glaubt Ferguson durchaus an die Herrschaft des Rechts. Sie sei Voraussetzung für Demokratie und Kapitalismus. Doch dürfe sie nicht zur Herrschaft der Rechtsanwälte verkommen.
Recht werde beispielsweise gefährdet, wenn bürgerliche Freiheit aus Gründen der nationalen Sicherheit eingeschränkt würde. Er dürfte sich durch das bestätigt sehen, was Edward Snowden jüngst über die Abhörpraxis des amerikanischen Geheimdienstes NSA enthüllt hat.
Auch der Einfluss der Lobbyisten auf Regierung und Parlament ist ihm ein Dorn im Auge. Er verweist auf eine Studie, nach der all jene Vorschriften, für die sich Verbands- und Firmenvertreter erfolgreich eingesetzt hätten, zu jährlichen Folgekosten von 1,75 Billionen Dollar führen würden. Und bringt es mit den Worten der Ökonomen David Kennedy und Joseph Stieglitz auf den Punkt.
"Gesetze, die es gestatten, räuberische Kreditgeschäfte zu betreiben, haben zusammen mit einem neuen Insolvenzrecht eine neue Schicht von teilweise in Schuldknechtschaft lebenden Menschen geschaffen."
Die größte Gefährdung der Demokratie sieht der Autor in den wachsenden Staatsschulden, die den Gesellschaftsvertrag zwischen den Generationen auflösen. Gleichzeitig hält er es für eine Illusion zu glauben, die Marktwirtschaft mit Hilfe von komplexen Gesetzen steuern und so Krisen verhindern zu können.
"Der Rechtsstaat hat viele Feinde, aber zu den gefährlichsten gehören die Verfasser langer, umfangreicher Gesetzestexte."
Dabei glaubt Ferguson durchaus an die Herrschaft des Rechts. Sie sei Voraussetzung für Demokratie und Kapitalismus. Doch dürfe sie nicht zur Herrschaft der Rechtsanwälte verkommen.
Recht werde beispielsweise gefährdet, wenn bürgerliche Freiheit aus Gründen der nationalen Sicherheit eingeschränkt würde. Er dürfte sich durch das bestätigt sehen, was Edward Snowden jüngst über die Abhörpraxis des amerikanischen Geheimdienstes NSA enthüllt hat.
Auch der Einfluss der Lobbyisten auf Regierung und Parlament ist ihm ein Dorn im Auge. Er verweist auf eine Studie, nach der all jene Vorschriften, für die sich Verbands- und Firmenvertreter erfolgreich eingesetzt hätten, zu jährlichen Folgekosten von 1,75 Billionen Dollar führen würden. Und bringt es mit den Worten der Ökonomen David Kennedy und Joseph Stieglitz auf den Punkt.
"Gesetze, die es gestatten, räuberische Kreditgeschäfte zu betreiben, haben zusammen mit einem neuen Insolvenzrecht eine neue Schicht von teilweise in Schuldknechtschaft lebenden Menschen geschaffen."
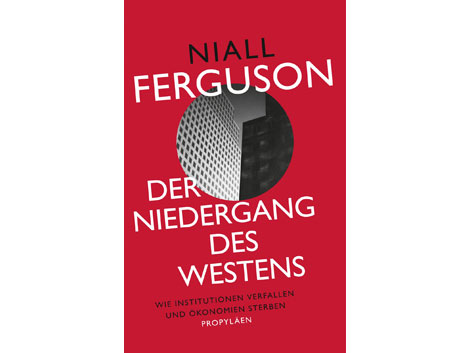
Lesart - Niall Ferguson: "Der Niedergang des Westens"© Promo
Niall Ferguson will die Zivilgesellschaft stärken
Seine Antwort auf den Niedergang des Westens, auf den Verfall der Institutionen, ist die alte liberale: weniger Staat, weniger Regulierung, weniger Bürokratie. Niall Ferguson will die Zivilgesellschaft stärken. Sie soll mehr Aufgaben in die eigene Hand nehmen – mit ihren Vereinen und Wohltätigkeitorganisationen, mit ihren Initiativen, beispielsweise private Schulen zu unterhalten. Das ist nicht neu und originell ist es auch nicht.
Statt in die Tiefe zu gehen, verwickelt er sich in Widersprüche. Denn einerseits macht er die Regierung für die Exzesse der Finanzindustrie verantwortlich, tadelt sie aber zugleich dafür, dass sie der Branche neue Regeln vorschreibt.
Gräbt man aber tiefer, stößt man darauf, wie Banken und Hedgefonds mit der Politik zusammenarbeiten, ja wie deren Experten die Gesetze, die Rahmenbedingungen für die Finanzmärkte entwerfen, also der Politik das Heft aus der Hand nehmen, die Demokratie hintergehen – mit komplizierten Regeln für komplexe Sachverhalte, die kein Laie durchschaut.
Der Freidemokrat Guido Westerwelle hatte ja Recht, als er über die spätrömische Dekadenz raisonierte. Nur hätte er damit nicht die Sozialsysteme, sondern die politischen Klasse anprangern sollen. So begann für den römischen Schriftsteller und Politiker Tacitus die römische Dekadenz, als die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft wurde und der Bürger nicht mehr für sein Gemeinwesen einstehen musste.
Niall Ferguson ist ein Optimist, er glaubt an den verantwortlich handelnden Bürger – hierin folge ich ihm. Und sein Buch lädt, abseits von Ideologien, zur Diskussion ein. Doch verlässt ihn unterwegs die eigene Courage. Am Ende denkt er nicht wirklich radikal. So stellt er nicht einmal die Frage, ob das stete Streben nach Wachstum überhaupt noch tragfähig ist.
"Einer der Nachteile des unbeschränkten Wachstums,..., besteht darin, dass es letztlich im Zusammenbruch mündet."
… lässt er den Physiker Geoffrey West sagen, ohne für sich daraus Konsequenzen zu ziehen. Stattdessen preist er saubere Kraftwerke – ob von Kohle oder Atom angetrieben - und spottet über die grüne Umwelttechnologie.
Die westliche Welt befindet sich in einer tiefen Krise. Literatur dazu existiert jede Menge. Was fehlt, sind wirklich neue, so innovative wie realistische Lösungen. Hier hätte ich mir von einem originellen Denker wie Niall Ferguson mehr erhofft. Die Krise der westlichen Welt ist auch eine Krise des westlichen Denkens.
Statt in die Tiefe zu gehen, verwickelt er sich in Widersprüche. Denn einerseits macht er die Regierung für die Exzesse der Finanzindustrie verantwortlich, tadelt sie aber zugleich dafür, dass sie der Branche neue Regeln vorschreibt.
Gräbt man aber tiefer, stößt man darauf, wie Banken und Hedgefonds mit der Politik zusammenarbeiten, ja wie deren Experten die Gesetze, die Rahmenbedingungen für die Finanzmärkte entwerfen, also der Politik das Heft aus der Hand nehmen, die Demokratie hintergehen – mit komplizierten Regeln für komplexe Sachverhalte, die kein Laie durchschaut.
Der Freidemokrat Guido Westerwelle hatte ja Recht, als er über die spätrömische Dekadenz raisonierte. Nur hätte er damit nicht die Sozialsysteme, sondern die politischen Klasse anprangern sollen. So begann für den römischen Schriftsteller und Politiker Tacitus die römische Dekadenz, als die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft wurde und der Bürger nicht mehr für sein Gemeinwesen einstehen musste.
Niall Ferguson ist ein Optimist, er glaubt an den verantwortlich handelnden Bürger – hierin folge ich ihm. Und sein Buch lädt, abseits von Ideologien, zur Diskussion ein. Doch verlässt ihn unterwegs die eigene Courage. Am Ende denkt er nicht wirklich radikal. So stellt er nicht einmal die Frage, ob das stete Streben nach Wachstum überhaupt noch tragfähig ist.
"Einer der Nachteile des unbeschränkten Wachstums,..., besteht darin, dass es letztlich im Zusammenbruch mündet."
… lässt er den Physiker Geoffrey West sagen, ohne für sich daraus Konsequenzen zu ziehen. Stattdessen preist er saubere Kraftwerke – ob von Kohle oder Atom angetrieben - und spottet über die grüne Umwelttechnologie.
Die westliche Welt befindet sich in einer tiefen Krise. Literatur dazu existiert jede Menge. Was fehlt, sind wirklich neue, so innovative wie realistische Lösungen. Hier hätte ich mir von einem originellen Denker wie Niall Ferguson mehr erhofft. Die Krise der westlichen Welt ist auch eine Krise des westlichen Denkens.
Niall Ferguson: Der Niedergang des Westens
Wie Institutionen verfallen und Ökonomien sterben
Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt
Propyläen Verlag Berlin 2013
208 Seiten, 18 Euro, auch als ebook erhältlich
Wie Institutionen verfallen und Ökonomien sterben
Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt
Propyläen Verlag Berlin 2013
208 Seiten, 18 Euro, auch als ebook erhältlich
