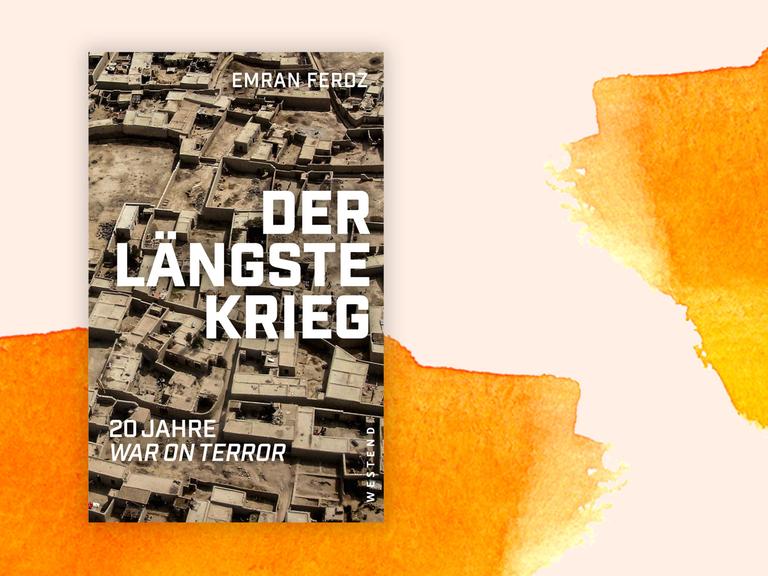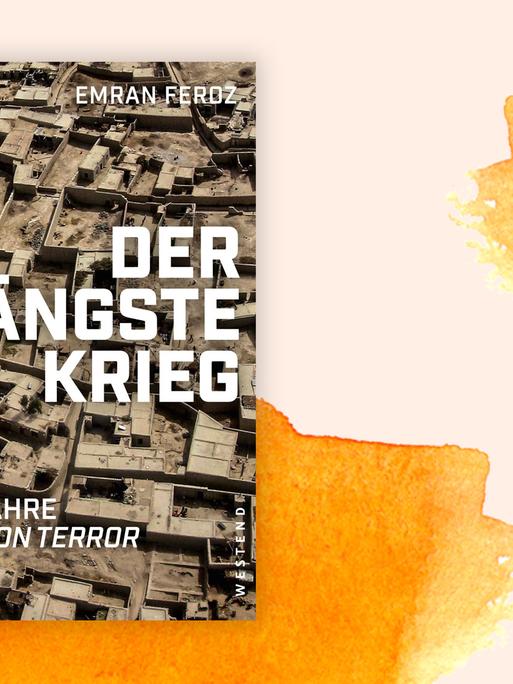Prof. Dr. Bernd Greiner, Jahrgang 1952, ist Gründungsdirektor und Mitarbeiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Er lehrte außereuropäische Geschichte an der Universität Hamburg und leitete bis 2014 den Arbeitsbereich "Theorie und Geschichte der Gewalt" am Hamburger Institut für Sozialforschung.
Historiker zur Ordnungsmacht USA

Die USA unterliegen dem Denkfehler, politische Probleme militärisch lösen zu wollen, sagt Bernd Greiner. © picture alliance / CHROMORANGE / Karl-Heinz Spremberg
Für eine Schubumkehr in der internationalen Politik
29:17 Minuten

Spätestens als die USA ihre Truppen abzogen, war der internationale Afghanistaneinsatz gescheitert. Ein Versagen der Ordnungsmacht USA? Ja, sagt der Historiker und Amerikakenner Bernd Greiner. Und nicht das erste. Zeit für eine andere Weltordnung?
Die Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan war ein Debakel mit Ansage, sagt der Historiker und Amerikanist Bernd Greiner. Den "Löwenanteil" daran hätten die USA als Führungsmacht der internationalen Koalition, die Afghanistan Frieden und Demokratie bringen sollte.
Die USA hätten zu wenig auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Afghanistan geachtet. Washington sei es vielmehr um eine Demonstration militärischer Stärke gegangen, nachdem die Weltmacht bei den Anschlägen des 11. September 2001 von "Verbrechern mit Teppichmessern" gedemütigt worden sei.
Grundsätzlicher Denkfehler der USA
Dahinter stehe der "grundsätzliche Denkfehler, ein politisches Problem mit militärischen Mitteln lösen zu wollen". Diesen Fehler begingen die USA trotz der schlechten Erfahrungen in Vietnam immer wieder, führt Greiner auch in seinem gerade erschienenen Buch "Made in Washington" aus.
Die USA seien seit dem Zweiten Weltkrieg international "rabiater als andere Länder aufgetreten", meint Greiner. Er verweist dabei auf die vielen militärischen und geheimdienstlichen Interventionen Washingtons in Asien, Lateinamerika und anderen Teilen der Welt.
Auf diese "Schattenseite" US-amerikanischer Vormacht wolle er aufmerksam machen. Denn die gegenwärtigen globalen Herausforderungen wie der Klimawandel erforderten eine "Neujustierung von außenpolitischen Grundlinien" - eine "Schubumkehr".
Das Konzept einer hegemonialen Ordnungsmacht, die die Leitlinien der internationalen Politik bestimmt, sei überholt, betont Greiner. Vor allem wenn diese Ordnungsmacht derartig einseitig auf militärische Macht setze wie die USA. Wodurch diese zum "Turbolader einer weltweiten Aufrüstung" geworden seien.
Denn mit seiner militärischen Machtentfaltung habe Washington andere Länder wie Russland und vor allem China dazu gebracht, "gleiches mit gleichem zu vergelten", meint Greiner, wobei er chinesisches Vormachtstreben aber nicht verniedlichen wolle.
Grammatik des Vertrauens statt Sprache der Gewalt
Um eine Neuauflage des Kalten Krieges zu vermeiden, brauche es daher eine Politik, die an Ideen der Entspannungspolitik von Willy Brandt und anderen in den 70er-Jahren anknüpfe: das Anstreben von gemeinsamer Sicherheit statt Konfrontation, eine "Grammatik des Vertrauens" statt der Sprache der Gewalt.
Das bedeute nicht nur den Primat der Diplomatie und des internationalen Rechts, so Greiner, sondern auch Abrüstung. Globale Konflikte zu lösen sei zwar ohne die USA nicht möglich, aber unter US-Führung seien sie erst recht nicht zu lösen.
Darum müsse der Impuls zu einer neuen, regelbasierten Weltordnung von Europa kommen. Denn der alte Kontinent habe Erfahrung mit der Eindämmung von Nationalismus, mit Gewaltverzicht und mit der Notwendigkeit von Kompromissen.
(pag)