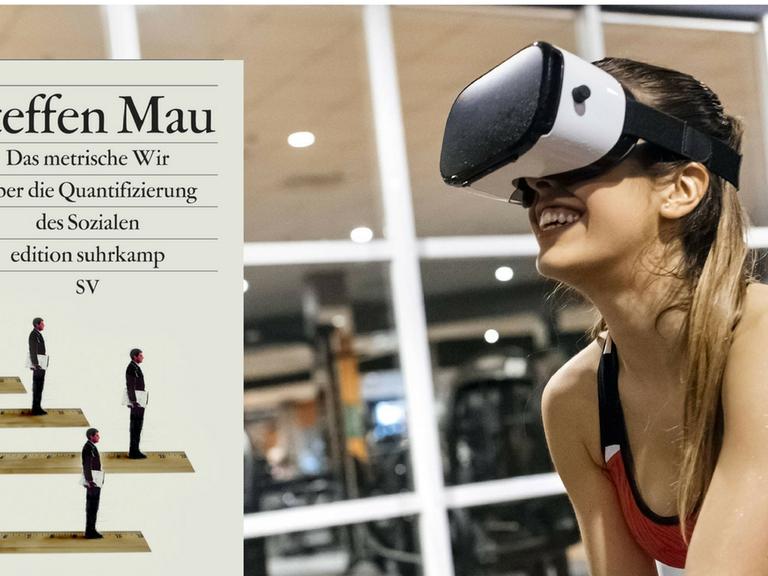"Die Freiheit der Wissenschaft ist das oberste Ziel"

Der Vorsitzende des Hochschulausschusses der Kultusministerkonferenz, Michael Mihatsch, hat in der Debatte um die Wissenschaftskultur die Freiheit der Forschung betont. Er widersprach der Einschätzung, dass Drittmittel eine zu große Rolle spielten.
Der Vorsitzende des Hochschulausschusses der Kultusministerkonferenz, Michael Mihatsch, hat früheren Äußerungen des Medienwissenschaftlers Bernhard Pörksen im Deutschlandfunk Kultur widersprochen, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften von Drittmittelförderung und Publikationsdruck zu abhängig seien. Mihatsch sagte, die Bundesrepublik habe immer noch eine ganz überwiegend von der Öffentlichen Hand finanzierte Hochschullandschaft. Er beonte außerdem die Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit.
Das Interview im Wortlaut:
Stephan Karkowsky: Wir wollen in dieser Woche eine Debatte fortführen über die Wissenschaftskultur an unseren Hochschulen. Angestoßen hat sie der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Der kritisierte die Abhängigkeit der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer von Drittmittelförderung und dem Publikationsdruck, bei dem scheinbar die Anzahl der Fachaufsätze mehr zählt als die Qualität. Der Psychologe Volker Linneweber verteidigte anschließend die Universitäten gegen diesen Vorwurf der Simulation, aber er sieht ebenfalls ein Problem in der Quantifizierung von Inhalten.
Und deshalb wollen wir heute noch eine Stimme dazu hören, nämlich den Vorsitzenden des Hochschulausschusses der Kultusministerkonferenz, Doktor Michael Mihatsch. Er leitet im bayerischen Wissenschaftsministerium die Abteilung für Universitäten und Hochschulmedizin. Herr Mihatsch!

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen © Bild: Peter-Andreas Hassiepen
Michael Mihatsch: Guten Morgen, Herr Karkowsky!
Karkowsky: Es gibt ja nun mittlerweile mehr als 2,8 Millionen Studenten an deutschen Hochschulen. Sollten Bund und Länder sich angesichts dieser Zahlen finanziell stärker engagieren, auch um den Drittmitteldruck mal rauszunehmen aus den Hochschulen?
Mihatsch: Dass sich Bund und Länder stärker engagieren sollen, ist eine Forderung, die man immer erheben kann, denn es wird nie genügend Geld für den Hochschulbereich geben. Hochschulen sind per se unersättlich, und das dürfen sie auch sein und sollen sie auch sein angesichts ihrer Relevanz für die Gesellschaft. Nur, der Eindruck, der vermittelt wird, auch in den Beiträgen der beiden Wissenschaftler, die Sie gerade eingespielt haben, dass sozusagen ein ganz erheblicher oder gar überwiegender Teil der Hochschulfinanzierung inzwischen drittmittelbasiert und damit von Markteinflüssen abhängig wäre, der trifft so nicht zu.
Wir haben in der Bundesrepublik immer noch den ganz überwiegenden Anteil der Hochschulfinanzierung in der Öffentlichen Hand, mit etwa Dreivierteln der Hochschulhaushalte, die über eine Grundfinanzierung institutionell finanziert werden, und der Drittmittelanteil ist etwa das verbleibende Viertel, wobei man auch noch mal unterscheiden muss zwischen öffentlichen und privaten Drittmitteln. In diesem Viertel stecken auch die Mittel etwa aus der Exzellenzinitiative oder der DFG drin, also von öffentlichen Einrichtungen, die nach strengen wissenschaftsgeleiteten Kriterien ihre Mittel vergeben. Und der Markt, sozusagen die Wirtschaft, die Unternehmen, spielen da nur eine nachrangige Rolle.

Einführungsveranstaltung der Universität Bremen © picture-alliance / dpa / Carmen Jaspersen
Politik deckt Pflichtprogramm ab
Karkowsky: Das war gut, noch mal die Zahlen zu hören. Aber Sie werden nicht bestreiten, dass an den Unis mittlerweile als bester Kollege gilt, wer mit aufwendigen Anträgen am meisten Drittmittel einwirbt, und nicht der, der sich am stärksten konzentriert, pur auf seine Forschung. Ist das gut so?
Mihatsch: Wir haben sicher eine relativ fokussierte Sichtweise, was die Qualitätsbewertung von universitären oder hochschulischen Leistungen anbetrifft, mit Blick auf die Forschung. Und andere Leistungsdimensionen der Hochschule, insbesondere die Lehre, werden da in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit oder auch bei Rankings etwa nicht hinreichend wahrgenommen.
Das ist aber eine Frage, an der die Politik sagen wir mal wenig ändern kann. Die Politik fördert, wie gesagt, die Universität, die Hochschule insgesamt in all ihren Leistungsdimensionen, mit dieser Grundausstattung. Das Pflichtprogramm, wenn Sie so wollen, wird dadurch abgedeckt. Und wenn in der Forschung ergänzende Fragestellungen auftauchen, für die besondere ergänzende zusätzliche Mittel dann benötigt und beantragt werden, dann ist das an sich eine gute Sache. Dann muss man nur gucken, dass diese Mittel nach wissenschaftsgerechten, wissenschaftsgeleiteten Kriterien vergeben werden. Nicht durch politische Setzung, sondern durch ein begutachtetes Verfahren, in dem die Wissenschaftler die maßgebliche Rolle spielen.
Karkowsky: Nun ist ja die Quantifizierung etwas, was alle Bereiche der Forschung durchzieht. Hat eigentlich der Bologna-Prozess damit was zu tun, also auch die Vergleichbarkeit von Forschungsergebnissen über Universitäten europaweit hinweg?
Mihatsch: Der Bologna-Prozess betrifft insbesondere die Lehre und die Mobilität in der Lehre, also die Mobilität von Lehrenden wie Lernenden, insbesondere auch der Studierenden, die Vergleichbarkeit von Abschlüssen, von Curricula. Wir haben gerade vor wenigen Tagen in Brüssel eine Diskussion zum Thema europäische Universitätsnetzwerke gehabt, eine Idee von Präsident Macron. Also eine stärkere Mobilität, auch eine stärkere Verlässlichkeit in der Anerkennung von Studienleistungen und Abschlüssen quer durch Europa. Das ist aber ein Thema, das nicht in erster Linie die Forschung betrifft.
Gebot der Wissensfreiheit
Karkowsky: Nun haben ja Professor Pörksen und Professor Linneweber beide gesagt, die Publikationen von Geistes- und Sozialwissenschaftler sollten nicht allein quantitativ bewertet werden, sondern vor allen Dingen nach ihrer gesellschaftlichen Relevanz und Innovationskraft. Stimmen Sie zu?
Mihatsch: Zunächst mal, der Staat hält sich bei der Bewertung von wissenschaftlichen Leistungen vollständig raus. Das ist ein Gebot der Wissenschaftsfreiheit, die im Grundgesetz gottlob verankert ist und die wir alle sehr ernst nehmen und beachten. Das heißt, die Wissenschaftler selbst, die Fachgesellschaften, darauf haben ja auch die beiden Wissenschaftler in ihren Beiträgen hingewiesen, sind selbst aufgerufen, die Kriterien zu definieren, nach denen wissenschaftliche Leistung bemessen wird. Sie werden nie von einem Vertreter der Politik oder der Verwaltung eine Aussage dazu bekommen, ob jetzt das Opus Magnum das richtige Instrument der Leistungsmessung ist oder Zeitschriftenaufsatz in quantitativer Hinsicht.
Karkowsky: Aber Sie merken natürlich, ich versuche Sie natürlich zu einer Aussage zu drängen gegen die Quantifizierung. Da ist ja auch die Frage, wie oft ein Wissenschaftler zitiert wird, eine, die seinen Status erhöht. Darüber hat der Berliner Soziologe Stefan Mau unlängst erst ein Buch geschrieben. Er kritisiert diese Fixierung auf Zahlen. In "Das metrische Wir. Über die Quantifizierung des Sozialen". Würden Sie sagen, dieser Eindruck stimmt, dass durch die Digitalisierung die Quantifizierung zunimmt, weil es sie erleichtert, wohingegen die Digitalisierung noch keinen Weg gefunden hat, Qualität zu erkennen?
Mihatsch: Ihr Drängen ist legitim. Das ist für einen Journalisten Tagesgeschäft und Aufgabe. Aber Sie werden mich da nicht zu einer Aussage bewegen, weil, noch einmal: Von Staats wegen und auch von Verwaltungs wegen halten wir uns raus bei der Frage, wie wissenschaftliche Leistungen, wie Forschungsleistungen bemessen werden.
Das müssen die Wissenschaftler – Gott sei Dank ist das bei uns so geregelt, dass sich der Staat da völlig raushält – selbst beurteilen. Und ob da quantitative Fragen eine größere oder kleinere Rolle spielen – Sie werden sicher immer eine Rolle spielen, aber in welchem Umfang die eingehen und wie die Gewichtung verschiedener Parameter und Faktoren bei dieser Leistungsmessung und -begutachtung stattfindet, das ist tatsächlich keine Frage von staatlichen Vorgaben oder Setzungen oder Wünschen, sondern das ist ein wissenschaftsimmanenter Prozess.
Da halten wir uns, wie gesagt, vollständig raus. Die Beobachtung, die Sie rein faktisch wahrnehmen, die nehme ich auch wahr. Aber uns steht da, wenn Sie so wollen, kein Urteil zu, und wir haben auch keine Steuerungsmöglichkeiten. Das müssen die wissenschaftlichen Peers selbst organisieren.

Zwei Studenten lernen für die Prüfungen © imago / Artur Cupak
Differenz zum Mainstream der EU
Karkowsky: Einig waren sich Ihre Vorredner auch darin, die Forschung runter zu holen vom Elfenbeinturm und Ergebnisse schneller und besser verfügbar zu machen für diejenigen, die es bezahlen, die Steuerzahler zum Beispiel. Haben Sie denn auch da den Eindruck, es schlummert zu viel Wissen in exklusiven Fachzeitschriften, von denen der Steuerzahler leider nie etwas erfährt?
Mihatsch: Ehrlich gesagt habe ich da fast eher den gegenteiligen Eindruck. Wir haben eine Tendenz, Forschung stärker als bisher ergebnisorientiert und anwendungsorientiert zu betreiben. Das ist eine Tendenz, die insbesondere aus Europa kommt. Die großen europäischen Forschungsförderungsprogramme, im Moment etwa Horizon 2020, legen einen ganz starken Wert auf die Anwendungsorientierung und auf die gesellschaftliche Relevanz von Forschungsthemen, die dann auch in konkrete Anwendungen überführt werden sollen.
Was dabei auf der Strecke bleibt, ist der ganze Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, bei denen diese gesellschaftliche unmittelbare Anwendung oder Produktnähe, wenn Sie so wollen, in der Regel schwerer konstruierbar ist als in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Und deswegen wundert es mich etwas, dass gerade zwei aus dem Bereich der Geisteswissenschaften stammenden Wissenschaftler hier eine stärkere Orientierung der Forschungsförderung an der gesellschaftlichen Relevanz anmahnen.
Im Gegenteil, die Politik legt da großen Wert drauf, zumindest in Deutschland, da sind wir auch zum Teil in einer Differenz mit dem Mainstream in der EU, dass wir die vollkommene Freiheit der Wissenschaft als oberstes Ziel hochhalten. Wissenschaft muss selbst wissen, woran sie forscht und soll sich natürlich an gesellschaftlichen Belangen orientieren, aber das darf nicht der erste und alleinige Maßstab sein.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.