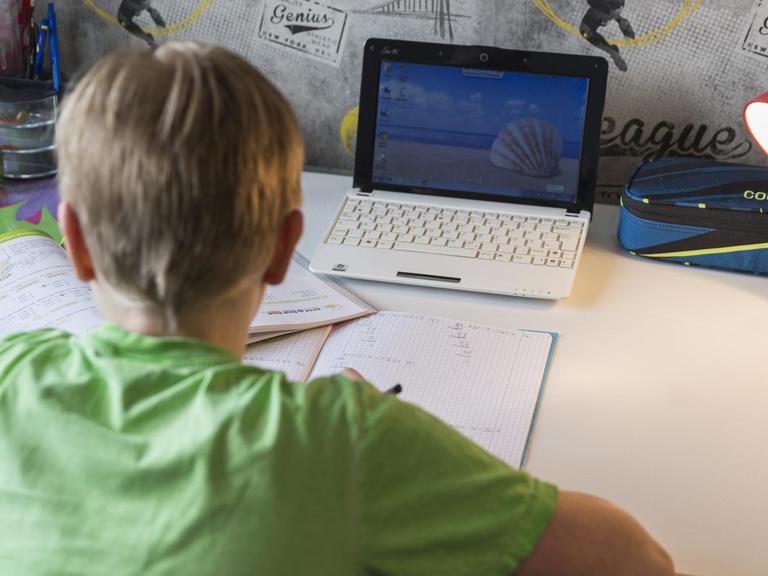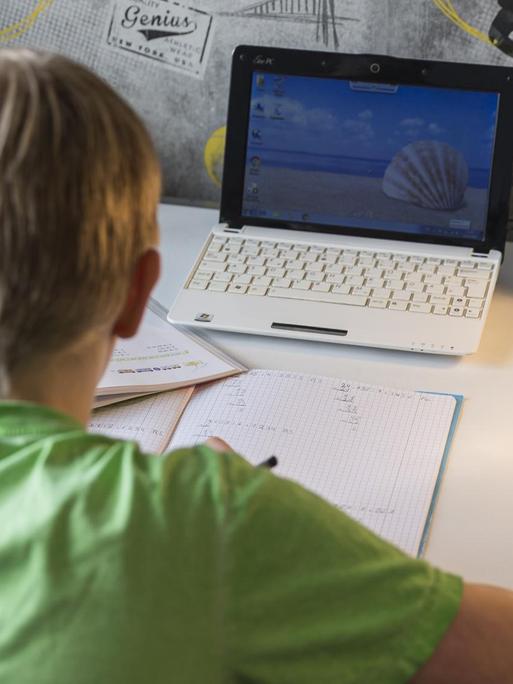Wie Schulen das digitale Lernen verbessern können
21:35 Minuten

Pandemiebedingt müssen die meisten Schulen gerade geschlossen bleiben, gelehrt wird trotzdem. Doch dabei zeigt sich: Das virtuelle Lernen steckt an deutschen Schulen noch in den Kinderschuhen. Experten mahnen, es müsse jetzt stringent gehandelt werden.
Die Schule wird digital! Aber nicht, weil in Deutschland ein Innovationsboom ausgebrochen ist, sondern wegen der Coronakrise. Denn um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, ist der Schulbetrieb vor Ort weitgehend eingestellt worden. Was liegt also näher, als digitale Plattformen, Werkzeuge und Kommunikationsmittel für den Unterricht zu Hause zu benutzen?
Doch so einfach, wie es scheint, ist es in der Realität nicht. Zumindest, wenn man sich das bisherige Fazit von Johanna Börgermann, Vorstandsmitglied der Landesschüler*innenvertretung Nordrhein-Westfalen, anhört. Sie sagt, dass die Ungleichheit durch die Verlagerung ins Digitale noch weiter wachsen würde. "Schüler, die digital gut ausgestattet sind, haben natürlich einen leichteren Zugang zu ihrer Bildung, als Schülerinnen und Schüler, die nicht aus einem digitalen Zuhause stammen."
Kein einheitliches Konzept
Bestehende soziale Unterschiede werden durch Homeschooling und den Einsatz digitaler Mittel also verstärkt: Man muss die Endgeräte zu Hause haben und benötigt Eltern, die Zeit, Energie und auch Wissen zur Unterstützung ihrer Kinder mitbringen können. Dazu kommt die Situation, dass es auch an den Schulen keinen einheitlichen Umgang mit dieser Umstellung gibt.
Miriam Weber aus dem Landesvorstand der Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz beschreibt die Lage so: "Jede Schule und eigentlich auch jede Lehrkraft hat ihr eigenes individuelles Konzept. Es ist eigentlich den Lehrkräften immer individuell überlassen, wie sie in Kontakt mit den Schülern treten." Es würden ganz unterschiedliche Lernplattformen genutzt, manche machten Video-Unterricht, manche nicht. "Die Lehrkräfte an meiner Schule sind komplett mit dem Internet oder mit Computern an sich überfordert haben sowas teilweise gar nicht zu Hause."
"Modernisierungsstau von zwei Jahrhunderten"
Dieser Aufholbedarf in Sachen Digitalisierung bei den Lehrkräften macht es dann auch schwer, über die genutzten Plattformen an sich zu sprechen, da es bei den Grundlagen schon hapert. Und nicht nur die Schülerinnen und Schüler sehen diese Probleme. Auch Myrle Dziak-Mahler vom Zentrum für LehrerInnenbildung an der Uni Köln beschreibt die Lage so: "Der Modernisierungsstau von zwei Jahrhunderten ist schon gigantisch, und der fällt uns gerade auf die Füße."
Sie sagt, dass es dem System Schulen an einem agilen Prozess fehlt, aus dem man lernt und Schlüsse ziehen kann, die dann in Zukunft angewendet werden können. Nun könnte man meinen, dass die Coronakrise dazu führt, dass ein Umdenken an den Schulen stattfinden wird und Chance bietet, zumindest etwas von diesem Modernisierungsstau aufzuholen.
Der Schweizer Lehrer Philippe Wampfler, der auf Youtube die Videoreihe "Digi-Fernunterricht" produziert, glaubt zwar ebenfalls, das sich aus der derzeitigen Situation etwas Neues entwickeln könnte – aber nur, wenn die Schulen weiter geschlossen bleiben.
Schulöffnung problematisch für Weiterentwicklung
Laut Wampfler haben die Schulen in den vergangenen Wochen vor allem versucht, die Technik zu verstehen und die fehlende Präsenz vor Ort aufzufangen. Wenn jetzt die Schulen wieder geöffnet würden, hätten die Lehrkräfte keine Motivation mehr, weitere Schritte zu verfolgen, um neue digitale Lernformen zu entwickeln. Vor allem auch, weil sie sich dann mit anderen Problemen auseinandersetzen müssen, wie zum Beispiel dem Einhalten von Hygieneregeln.
"Wenn man jetzt wüsste, okay, wir machen das jetzt noch bis nächstes Frühjahr, dann würde man ganz anders an die Situation herangehen." Doch jetzt werde es wie eine Notlösung behandelt. "Und das wird auch so bleiben - und dadurch ist jetzt so ein bisschen die Energie raus bei vielen Leuten."
Jetzt Dinge ausprobieren und evaluieren
Wampfler wünscht sich, die Lehrkräfte würden jetzt nicht darauf warten, dass alles zum Alten zurückkehrt, oder auf große, fertig geschliffene Produkte, sondern dass sie bestehende Technologien wie Etherpad, eine Software zur kollaborativen Dokumenterstellung, einfach mal ausprobieren. So ließen sich sehr wirksame Lernprozesse initiieren.
Myrle Dziak-Mahler sagt, dass es wichtig sei, jetzt sofort mit der konzeptuellen Arbeit anzufangen: "Wenn wir jetzt nicht anfangen, die Dinge auch genauestens anzugucken und zu begleiten, dann werden wir das auch nicht nach der Krise tun." Schließlich müsste auch dann ein konkreter Zeitpunkt zur Evaluation festgelegt werden, was eher unwahrscheinlich ist. Stattdessen sollte man konstant Dinge probieren und währenddessen evaluieren.
Und wenn das tatsächlich passiert, dann könnten wir vielleicht wirklich an einen Punkt kommen, an dem wir das starre Schulgerüst und die Präsenzkultur hinterfragen – eine Parallele zum aktuellen Zustand in der Arbeitswelt mit dem Schwenk Richtung Homeoffice. So könnte diese Krise eben auch eine Chance sein.
(hte)