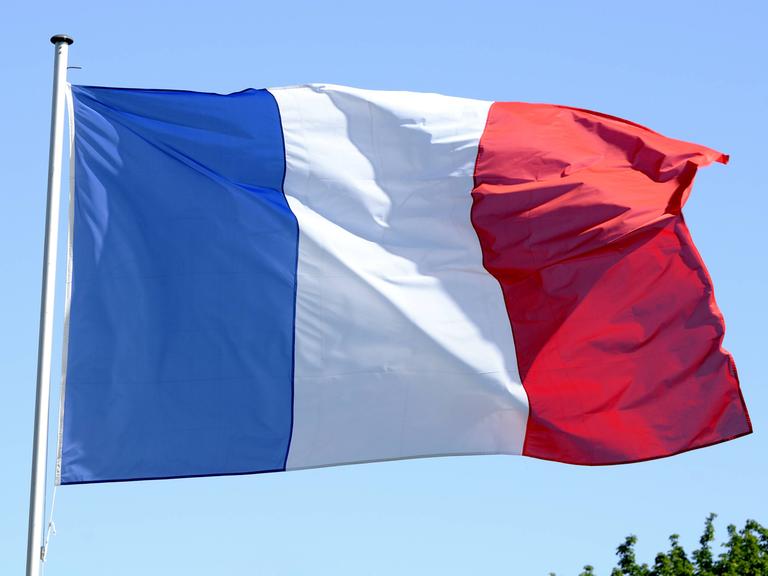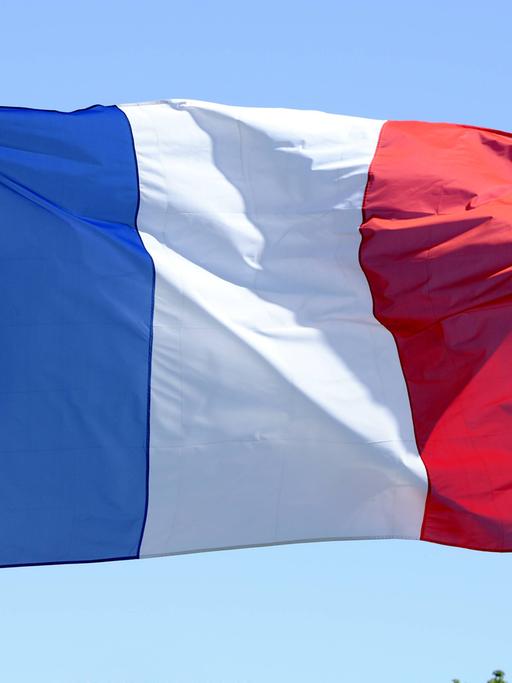Eugène Dabit: Hôtel du Nord
Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Julia Schoch
Schöffling Verlag, Frankfurt am Main 2015
224 Seiten, gebunden, 19,95 Euro
Das Paris der kleinen Leute

Das Hôtel du Nord liegt jenseits der schillernden Boulevards von Paris, in den 1920er-Jahren kaufen die Eltern des Autoren Eugène Dabit das schäbige Haus und beherbergten lauter skurrile Gäste. In seinem Roman schreibt Dabit von den dort gestrandeten Figuren.
Marcel Carnés Hôtel du Nord von 1938 ist ein Klassiker des französischen Kinos, und die großartige Arletty in der Rolle der Prostituierten Madame Raymonde genauso unvergessen wie als Garance in den Kindern des Olymp. Dennoch wirft die Kritik dem Film einen gewissen Sentimentalismus vor - nicht zu Unrecht, was besonders deutlich wird, wenn man den gleichnamigen Roman Eugène Dabits liest, der Carné als Inspirationsquelle diente.
Während der Regisseur das Pariser Wohnhotel am Kanal Saint-Martin im Norden von Paris vor allem als Kulisse für drei miteinander verwobene Liebesgeschichten verwendet, haben die Eltern des Autors das reale Hôtel du Nord geführt. Dabit hat also selbst in diesem Zufluchtsort für Menschen am unteren Rand der sozialen Skala gelebt, für Menschen, die kein Geld für eine Wohnung und eigene Möbel hatten und gegen einen geringen Mietzins dauerhaft in einem der Zimmer des Hotels lebten, kochten und teilweise sogar arbeiteten.
Gäste kommen und gehen
Den Rahmen des Romans bildet die Geschichte des Ehepaars Lecouvreur, das das Hotel samt Wirtschaft im Erdgeschoss pachtet und mit unermüdlichem Fleiß führt, Emile als unumstrittener Herrscher über den Tresen, Louise als gute Seele. In nicht weniger als 35 kurzen Kapiteln lernen wir viele ihrer Mieter kennen: Renée, die schwanger sitzengelassen wird; Charles, der als Knecht die Pferde des Fuhrkutschers misshandelt; Ginette, ihren Mann Prosper und den Zimmernachbar Kenel, die bald zu einer Ménage-à-trois zusammenfinden; zwei Schwestern, alte Jungfern, die sich ein Zimmer teilen und von Näharbeiten leben; den Schauspieler Raoul Fargues mit Familie; den alten Deborger, den Kommunisten Bénitaud, den homosexuelle Adrien.
Diese Figuren kommen und gehen, als feste Konstanten der Handlung bleiben die Besitzer. Vor allem Louise, die Renée als Dienstmädchen einstellt und gewissermaßen in die Familie aufnimmt, die Adrien hilft, sich zum Karneval als Carmen zu verkleiden oder Deborger jede Woche bekocht, nachdem er, zu schwach zum Arbeiten, im Armenhaus gelandet ist. Ihr Mann geht dazwischen, wenn Prosper und Kenel sich prügeln, oder er gestattet Raoul Fargues, einen Ball zum Nationalfeiertag zu veranstalten, um aus den Einnahmen seine Mietschulden zu begleichen.
Es wird geliebt, gestorben, gefeiert
Im Hôtel du Nord wird gelebt, geliebt, gestorben und auch gefeiert - vor allem eine weitgehend intakte Solidargemeinschaft, ein Mikrokosmos verschiedenster Charaktere, denen Dabit einzelne Miniaturen widmet. So ist das Buch, das 1931 mit dem Prix du Roman populiste ausgezeichnet wurde, weniger Roman, als vielmehr ein Kaleidoskop, das uns das Paris der kleinen Leute in den nicht nur golden 20er-Jahren vorführt. Kapitalismuskritisch, zeigt Dabit, wie es die Lecouvreurs, anders als ihre Mieter, zu einem bescheidenen Wohlstand bringen können und dabei stets eine große Menschlichkeit an den Tag legen; doch schließlich werden Spekulanten diesen Zufluchtsort zerstören, das Hotel abreißen, um auf dem Grund lukrativere Immobilien zu bauen.
In der Realität steht das Gebäude aber noch heute am Quai de Jemmapes. Es beherbergt ein Restaurant der gehobenen Preisklasse.