Simone Schmollack, geboren 1964 in Berlin, ist Journalistin und Autorin zahlreicher Bücher, darunter "Und er wird es wieder tun. Gewalt in der Partnerschaft" und "Deutsch-deutsche Beziehungen. Liebe zwischen Ost und West". Simone Schmollack war Redakteurin der Tageszeitung "taz" und Chefredakteurin bei der Wochenzeitung "Der Freitag". Sie beschäftigt sich vor allem mit Themen an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Privatheit.
Sprechverbote von der Gender-Polizei
04:22 Minuten
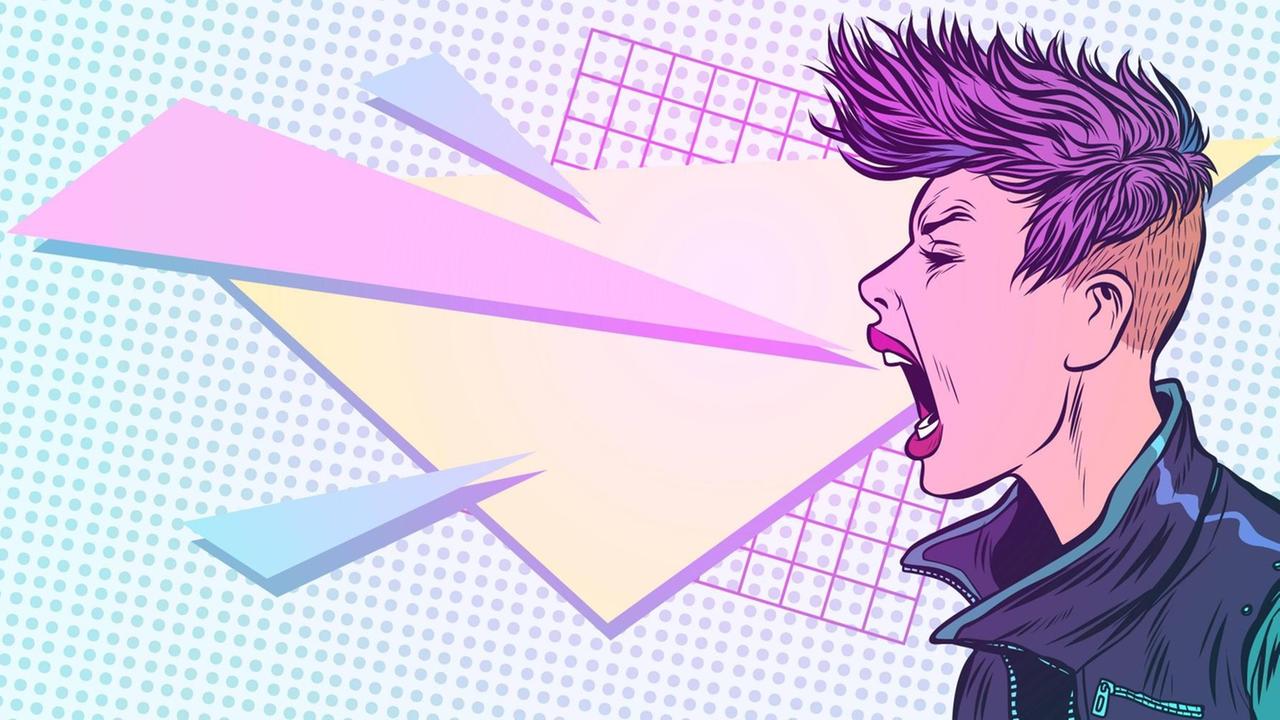
Verständnis schaffen, Minderheiten schützen - Identitätspolitik ist wichtig, sagt die Journalistin Simone Schmollack. Doch die Debatte ist längst vergiftet: Aggression und Rechthaberei bestimmen den Ton im Kampf gegen die Ausgrenzung.
Nie war es so leicht wie heute, eine Frau, eine Migrantin oder eine Transperson zu sein. Denn noch nie lebten die Menschen in Deutschland so gleichberechtigt nebeneinander wie in unserer Gegenwart. Gleichzeitig haben es jene schwer, die all das nicht sind: weiß, heterosexuell, männlich, nicht behindert.
Das ist nicht grundsätzlich falsch, viel zu lange haben weiße Männer Politik vor allem für weiße Männer gemacht. Aber jetzt wird ihnen per se unterstellt, sämtliche Privilegien für sich zu vereinnahmen, von Diskriminierung keine Ahnung zu haben und andere auszubeuten – um es mal zugespitzt zu formulieren.
Die Grenzen der Identitätspolitik
Grund für dieses simple Schwarz-Weiß-Raster ist unter anderem die Identitätspolitik.
Um es vorweg zu sagen: Identitätspolitik ist richtig und wichtig, sie ergreift Partei für jene, die bislang kaum oder gar nicht zu Wort gekommen sind, und die Jahrtausende lang unterprivilegiert, ausgebeutet, missachtet waren. Das soll endlich auch mal die Mehrheitsgesellschaft begreifen.
Aber Identitätspolitik gerät derzeit an ihre Grenzen, besser gesagt die aktuell in den Medien geführte Debatte darum gerät an ihre Grenzen.
Ein Schlagabtausch in der "Zeit"
Kürzlich erst lieferte die Wochenzeitung "Die Zeit" dafür ein exemplarisches Beispiel. Da kritisiert die "Zeit"-Redakteurin Mariam Lau Identitätspolitik als ein "beängstigendes Fuchteln mit Maßregelungen, Kränkungen, Schuldzuweisungen".
Allein die Frage "Woher kommst du?" sei "vermintes Gelände". Damit meint die Autorin, dass die Antwort nicht etwa lauten könnte: aus Hannover, Teheran oder Madrid. Sondern: "Warum fragst du mich das?" Denn die Frage sei rassistisch konnotiert: Wer nicht klassisch deutsch aussieht, werde sofort klischeehaft als migrantisch eingestuft. Und das sei ein Übergriff.
Das irritiert, denn die Frage "Woher kommst du?" zeigt zunächst einmal Interesse an der anderen Person. Denn Herkunft kann durchaus Schlussfolgerungen auf die Identität zulassen – egal, ob jemand aus Paris, Kapstadt oder Stuttgart stammt.
Prompt reagiert die Soziologin und Geschlechterforscherin Sabine Hark. Sie kritisiert Laus Text als zu kurzsichtig und zu wenig kenntnisreich. Identitäten bestimmten, wer verliert und wer gewinnt, meint Hark. Und: Identitäten seien das Ergebnis von Erzählungen – um am Ende zu fordern: Lasst uns reden.
Die Szenen zerfleischen sich
Eine gute Idee. Nur wird sie mitnichten umgesetzt: Statt miteinander zu reden, wird gegeneinander gekämpft. Nach dem Motto: Ich habe recht. Nein, ich habe recht. Wovon hast du denn schon Ahnung?
Das ist fatal. Und lässt manche, die sich der feministischen und queeren Community verbunden fühlen, ratlos zurück. Warum zerfleischen die sich so?
Das bekommen mitunter sogar Menschen zu spüren, die selbst der queeren Szene angehören. Der schwule taz-Autor Jan Feddersen zum Beispiel.
Vor kurzem wurde er auf Twitter als "transfeindlich" beschimpft. Er hatte es gewagt, in einem Essay Sätze wie diesen schreiben: "Über meine Identität möchte ich nicht verhandeln, weder mit mir, schon gar nicht mit anderen." Da wagt also ein queerer Mann Kritik an der Identitätsdebatte, und schon wird er zum Feind erklärt.
Nun war Solidarität noch nie eine Stärke von feministischen und queeren Szenen. Zusammenhalt wurde allenfalls proklamiert, gelebt wurde er kaum. Und nun stecken die Szenen in einem weiteren Streit fest.
Ohne offene Kommunikation geht es nicht
Es ist verrückt: Diejenigen, die einst forderten, nicht mehr ausgegrenzt zu werden, grenzen jetzt selbst aus. Wer früher gegen Sprechverbote vorgegangen ist, erteilt jetzt selbst welche.
Aber dort, wo keine offene Kommunikation mehr stattfindet, stagniert jede weitere Entwicklung. Und bringt möglicherweise jene gegen sich auf, an die diese Debatte vor allem gerichtet ist: die Mehrheitsgesellschaft.




