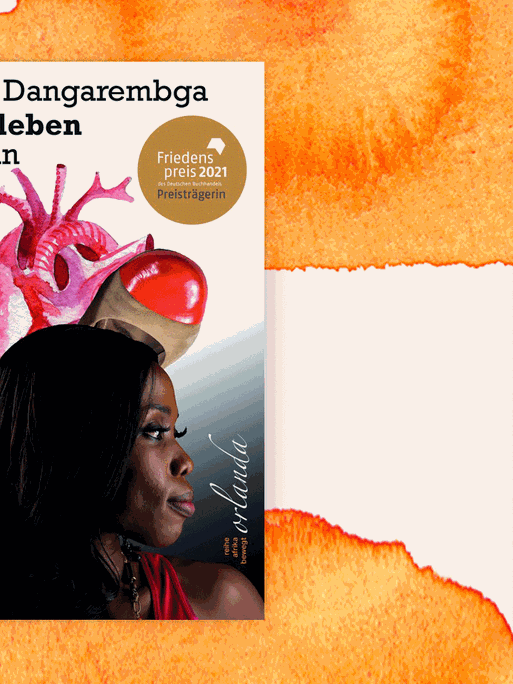Imbolo Mbue: "Wie schön wir waren"
Aus dem amerikanischen Englisch von Maria Hummitzsch
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021
443 Seiten, 23 Euro
Ein afrikanisches Dorf wehrt sich
06:04 Minuten

Der Erdölabbau hat die Lebensgrundlage eines afrikanischen Dorfes zerstört. Nun begehren die Bewohner auf. Die kamerunisch-amerikanische Autorin Imbolo Mbue kritisiert in dem Roman "Wie schön wir waren" eindringlich den Umgang mit Afrikas Ressourcen.
"Wie schön wir waren" könnte auch der Titel eines gefühligen Erinnerungsbuchs sein. Und ein Erinnerungsbuch ist Imbolo Mbues zweiter Roman tatsächlich. Doch gefühlig ist darin nichts. Im Gegenteil. "Wie schön wir waren" erweist sich als ein verstörendes Buch – verstörend wie die programmatische Vergangenheitsform seines Titels.
Zerstörter Lebensraum
Denn wenn der Roman beginnt, ist das Ende des namenlosen afrikanischen Dorfes, das den Schauplatz und den Gegenstand des Romans bildet, bereits gekommen. Wir sind im Jahr 1980: Seit mehreren Generationen schon leidet dieses Dorf unter einer amerikanischen Ölkompanie namens Pexton, die vor Ort nach dem schwarzen Gold sucht. Längst ist alles Ackerland und der Fluss vergiftet, sind Böden unfruchtbar geworden, Fische ausgestorben. Hunger und Arbeitslosigkeit haben sich stattdessen ausgebreitet, ganz zu schweigen von rätselhaften Krankheiten, an denen immer mehr Menschen, vor allem Kinder, sterben.
All das hat das Dorf bis dato stoisch ertragen – im Glauben an die fortgesetzten Versprechen der Firma, es werde Wohlstand und Besserung geben, man würde sich kümmern. Doch nun, an einem Oktobertag im Jahr 1980, wendet sich das Blatt: Auf Anraten ausgerechnet des Dorfnarren proben die Einheimischen den Aufstand. Es ist der Auftakt zu einem langen Kampf, der bis ins Jahr 2020 hineinreichen wird.
Dokumentation und Parabel
Mbue, die in Kamerun zur Welt kam und bestens vertraut ist mit dem schwierigen Ringen Afrikas um seinen Platz in der Welt, erzählt diesen 40 Jahre währenden Kampf aus einer zwischen den Zeiten hin und her springenden Rückschau – und mit einer Vielzahl von Stimmen. Wie ein griechischer Chor orchestrieren diese machtvoll das Eröffnungskapitel, gruppieren sich dann aber nach und nach um eine Handvoll Kinder, die in einem Mädchen namens Thula Nangi – die heimliche Protagonistin des Romans – ihre Anführerin finden.
Das ist formal, einschließlich der bestechenden Musikalität dieses Romans, so gekonnt wie auch die inhaltliche Balance, die Mbue gelingt: Denn "Wie schön wir waren" vereint die Geste des Dokumentarischen mit der einer übergreifenden Parabel.
Kein Klagelied
Der Roman lebt vom Atem einer Erzählerin, die einerseits das Leben in einem afrikanischen Dorf samt gänzlich anders gewobener Zeitmuster plastisch evoziert – ohne es je zu beschönigen: Chauvinismus, Korruption, Repression sind nur einige der ‚Krankheiten‘, die Mbue benennt. Ungeschönt aber – samt dem ambivalenten weißen Gutmenschentum – zeigt sie auch die hässliche Fratze des Neokolonialismus, mit der sich der Westen noch immer an den Ressourcen Afrikas vergeht. Thula wird mithilfe der Gelder, mit denen Pexton das Dorf zu besänftigen sucht, ausgerechnet in Amerika studieren. Sie aber wird sich dort auch radikalisieren.
"Wie schön wir waren", von Maria Hummitzsch in ein kraftvolles Deutsch übertragen, ist deshalb zu keiner Zeit ein Klagegesang. Imbolo Mbue zollt mit ihrem eindringlichen Roman vielmehr all jenen Respekt, die den Kampf bis heute führen: für ein Afrika, das sich, wie einst auch dieses namenlose Dorf, eines kommenden Tages wieder selbst gehört.