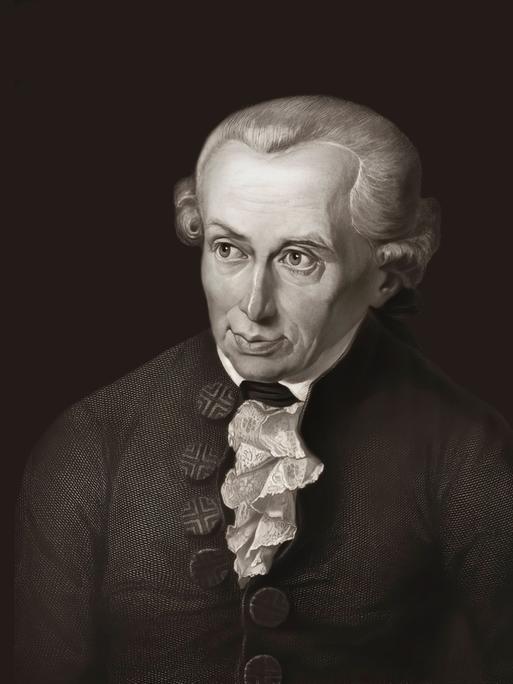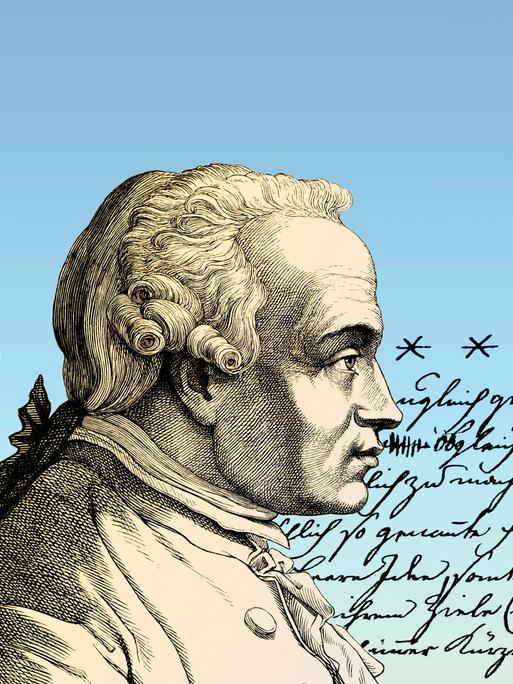Kommentar zu Immanuel Kant
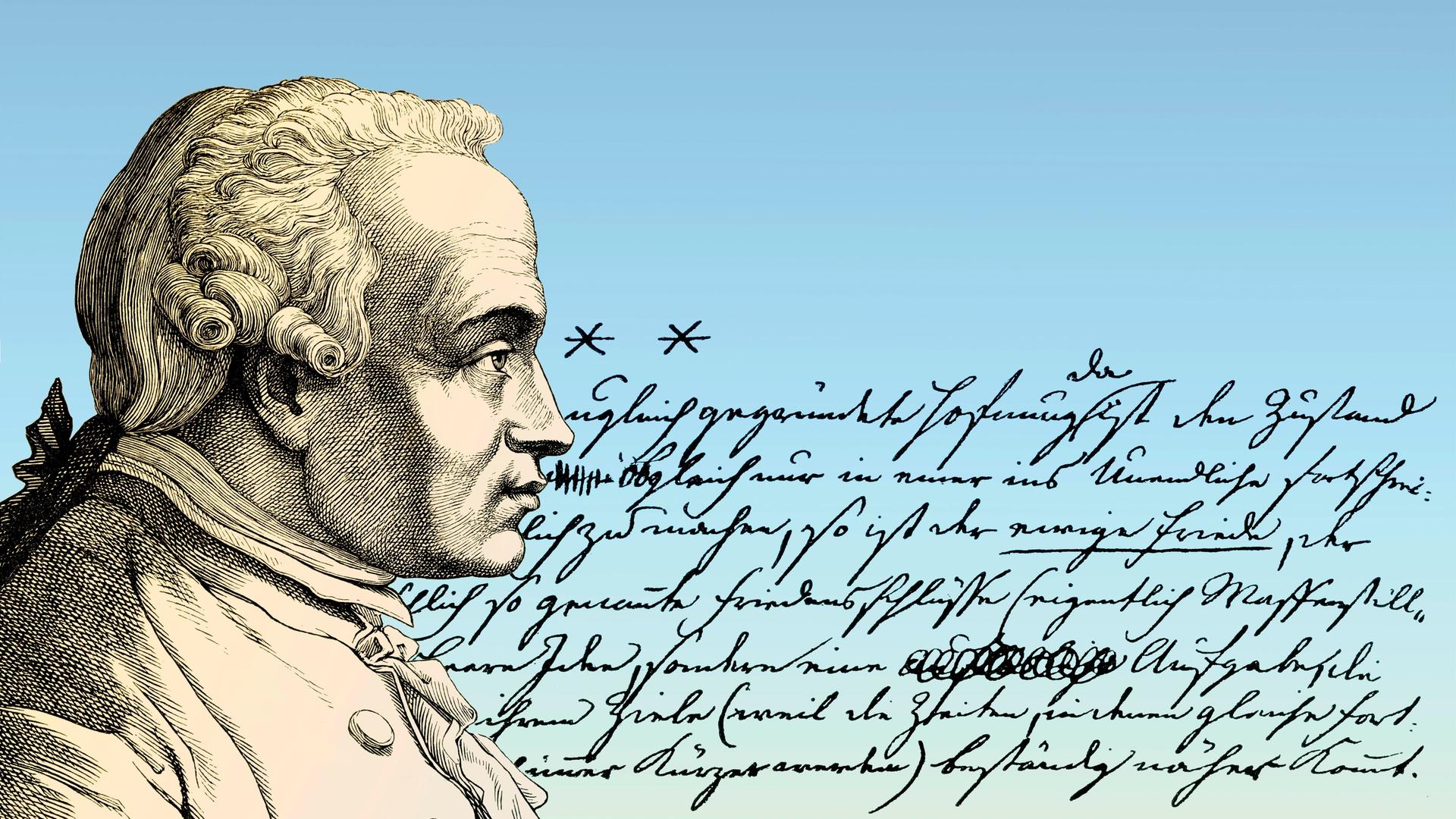
Porträt von Immanuel Kant © picture alliance / imagebroker / Heinz-Dieter Falkenstein
Wege zum Frieden in kriegerischen Zeiten
05:06 Minuten
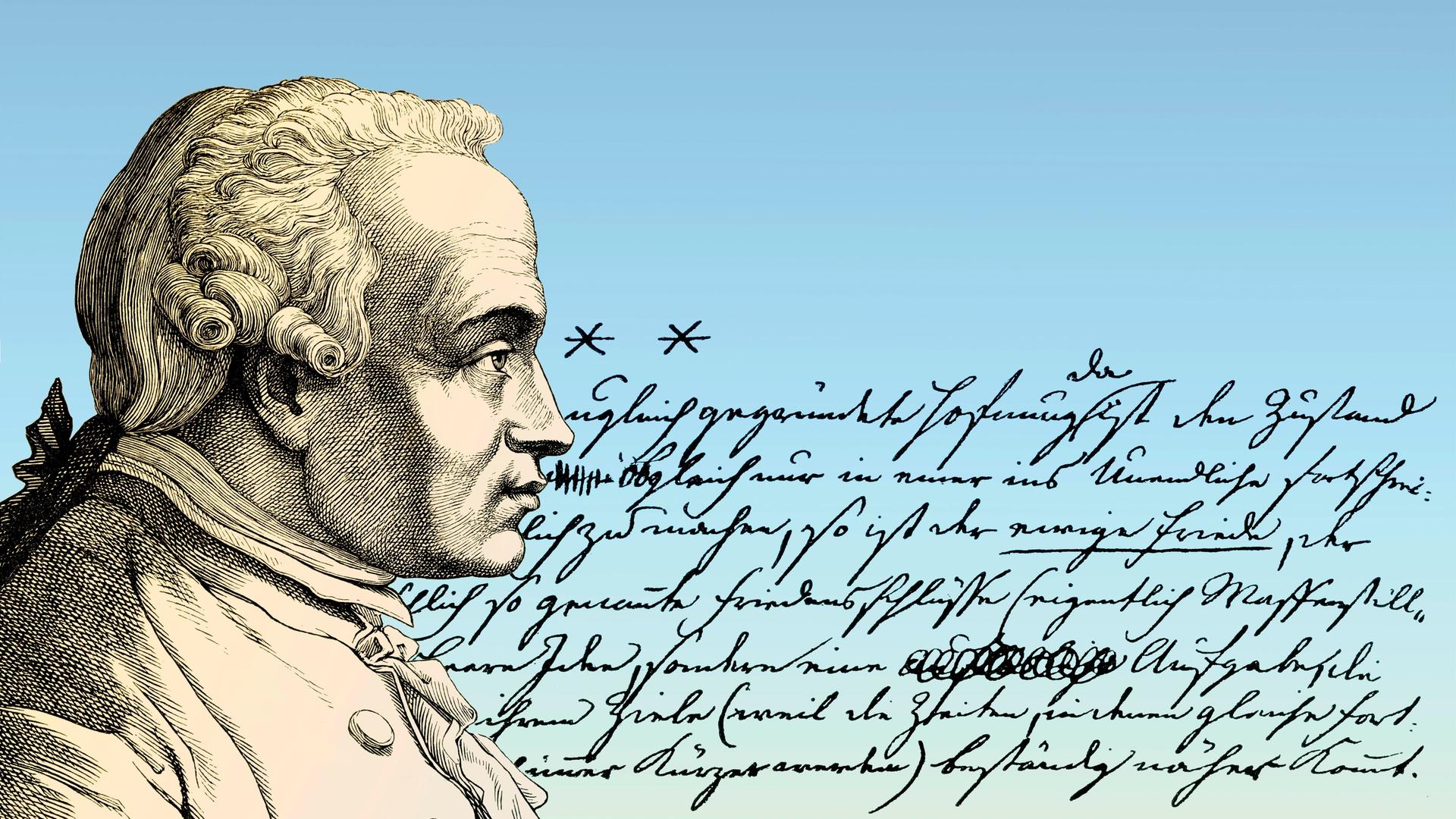
"Zum ewigen Frieden" ist eine der berühmtesten Schriften von Immanuel Kant. Dass sie realpolitisch gemeint war, wird heute aber meistens übersehen. Dabei sollten wir den Text heute als handlungsanleitend verstehen, meint der Philosoph Daniel Loick.
Das aktuelle Weltgeschehen kann den entmutigenden Eindruck erwecken, dass wir uns in einer Art ewigem Krieg befinden: Es entstehen immer neue grausame Konfliktherde.
Umso radikaler mutet heute eine der bekanntesten Schriften Kants an: sein 1795 verfasster Traktat „Zum Ewigen Frieden“. Kant erkennt im Krieg eine der größten Geißeln der Menschheit: Ihm fallen nicht nur Abertausende von Menschenleben zum Opfer, er führt auch zur nationalistischen Aufstachelung der Bevölkerungen gegeneinander.
Gegen diesen zwischenstaatlichen Naturzustand, der die Menschheit mit Gewaltmitteln in verfeindete Völker trennt, setzt Kant das kosmopolitische Ideal einer Föderation republikanischer Staaten, die durch eine geteilte internationale Rechtsordnung gebunden sind.
Die Vernunft verpflichtet zur Abrüstung
Damit eine solche Friedensordnung jemals erreicht werden kann, gelten für die Staaten auch schon jetzt einige zwingende Regeln. Dazu zählt, dass kein Friedensschluss unter dem heimlichen Vorbehalt eines künftigen Angriffes erfolgen darf, dass keine Kriegshandlung das Vertrauen der Kriegsparteien so untergraben darf, dass ein späterer Frieden verunmöglicht ist und vor allem: dass Staaten keine stehenden Armeen unterhalten sollen, weil dies von anderen Ländern als eine konstante Bedrohung verstanden werden muss. Es ist die von der Vernunft diktierte Pflicht eines jeden Staates, abzurüsten.
Kant wäre also zweifelsohne ebenso gegen die Lieferung von Kampfjets an autoritäre Regime wie gegen die massive Aufrüstung der Bundeswehr durch gigantische „Sondervermögen“ gewesen.
Kant hat den „ewigen Frieden“ nicht als Utopie entworfen, sondern als realpolitische Intervention. Er wusste genau, dass das Hauptproblem für das Erreichen von Frieden in der Tendenz von Politikern liegt, die jeweils aktuelle Situation zur Ausnahme zu erklären: Man ist immer gegen Krieg, außer den jetzigen. Kants Moralphilosophie lässt solche Ausreden bekanntlich nicht gelten: Der „kategorische Imperativ“ gilt eben kategorisch.
Kant belässt es aber nicht beim Postulieren eines Ideals, nach dem sich die Praxis richten soll, sondern fragt sich auch, wie die Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden verbessert werden können. Er setzt hier auf den Fortschritt der Rechtsordnung und der politischen Institutionen: Bürgerliche Staaten, so nimmt Kant an, sind weniger geneigt, Krieg zu führen, weil sie ihre Bürger erst überzeugen müssen.
Liberale Demokratien intervenieren häufig
Hier hat sich Kant offensichtlich geirrt: Einige der mächtigsten Militärmächte sind heute liberale Demokratien, und sie intervenieren in globale Konflikte häufig und häufig fatal. Richtig ist jedoch Kants Punkt, dass wir nicht einfach auf die Zunahme von Friedensliebe hoffen sollten, sondern die gesellschaftlichen Voraussetzungen herstellen müssen, die real Frieden stiften können.
Hier lässt sich an zahlreiche Maßnahmen denken, die Kant zwar nicht erwähnt, die aber in seinem Geiste formuliert werden können. Dazu zählen die Stärkung zivilgesellschaftlicher Kräfte gegen Militarisierung, die umfangreiche Ermöglichung von Desertation und die Garantie eines robusten Rechts auf Asyl.
Ein zentraler praktischer Punkt ist nicht nur die Einschränkung von Rüstungsexporten, sondern ein Ausstieg schon aus der Produktion von Waffen. Waffen werden hergestellt, um eingesetzt zu werden. Militärische Macht ermöglicht Aggressionen gegen andere und Unterdrückung der eigenen Bevölkerung, gefährdet langfristige Sicherheit, erodiert demokratische Werte und politische Öffentlichkeiten, eskaliert Konflikte und entzieht der sozialen Infrastruktur wichtige Ressourcen. Wer Frieden stiften will, kann beim Verbot von Rheinmetall und Thyssen-Krupp anfangen.
Nicht nur die Sachzwänge sehen
Nicht auf alle aktuellen Fragen bietet uns ein vor 300 Jahren geborener Philosoph eine überzeugende Antwort. Aber vom Realpolitiker Kant können wir lernen, den Blick nicht nur auf kurzfristige scheinbare militärische Sachzwänge, sondern auch auf die langfristigen Konsequenzen staatlichen Handelns zu richten – und auf die praktischen Anforderungen an eine Politik, die sich jener Losung verpflichtet fühlt, die für ihn den Endzweck jeden Rechts ausmacht: "Es soll kein Krieg sein."
Daniel Loick ist Associate Professor für Politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Universität Amsterdam. Demnächst erscheint von ihm im Suhrkamp Verlag „Die Überlegenheit der Unterlegenen. Eine Theorie der Gegengemeinschaften“.