In der Teilung miteinander verbunden

Dass trotz der 40-jährigen Teilung Deutschland 1990 die Kraft zur Wiedervereinigung besaß, ist nach Ansicht von Peter Bender dem Umstand geschuldet, dass die beiden Teilstaaten stets aufeinander bezogen waren. In seinem Buch "Deutschlands Wiederkehr" legt der Historiker dar, wie "gerade die Zeiten der schlimmsten Feindschaft erkennen ließen, dass hier eine Nation mit sich selbst kämpfte".
Die deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1990 ist oft beschrieben worden, in einzelnen Aspekten oder in größeren Zusammenhängen, so vor allem in Heinrich August Winklers bravourösen Werk über Deutschlands langen Weg nach Westen. Wer sich heute diesem Zeitabschnitt zuwendet, wird kaum noch umwerfend Neues finden. Er kann Bekanntes neu besehen und neu deuten. Genau dies hat Peter Bender getan.
Es geht um die Frage, wieso der deutsche Nationalstaat, bei Adolf Hitlers schmählichem Abgang 1945 kein Dreivierteljahrhundert alt, nach mehr als vierzig Jahren Besatzung, Demütigung, Teilung und politischer Fremdbestimmung durch zwei einander feindliche Weltsysteme, das Vermögen und die Entschlossenheit besaß, sich wiederherzustellen. Benders Antwort: Die zwei deutschen Teilstaaten blieben stets aufeinander bezogen, manchmal bis zur Spiegelbildlichkeit - auch dann noch, wenn sie sich weit voneinander entfernten.
Der Althistoriker Bender zitiert den Althistoriker Dahlheim über die Nachwirkung des alten Rom:
"Man kann von einem Erbe zehren, ohne viel davon zu wissen ... Menschen handeln, denken und fühlen, geleitet von einem Bewusstsein, dessen Wurzeln ihnen nur selten deutlich sind."
Bender konkretisiert:
"Die vierzigjährige Existenz zweier deutscher Staaten hat die Existenz Deutschlands mehr und mehr in Frage gestellt, aber nicht aufgehoben. Bundesrepublik und DDR blieben, solange sie bestanden, aufeinander bezogen. Gerade die Zeiten der schlimmsten Feindschaft ließen erkennen, dass hier eine Nation mit sich selbst kämpfte: So böse streitet man nur mit dem Bruder. Keiner konnte vom anderen absehen, auch wenn er es wollte. Jeder folgte seinen eigenen Grundsätzen und Erfordernissen, aber meist mit einem Blick auf den Konkurrenzstaat. Keiner durfte sich eine Blöße geben, jeder wollte – möglichst überall – der bessere sein."
Unter diesem Aspekt wird deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1990 erzählt. Die Erbschaften der Vergangenheit und ihre unterschiedliche Bewältigung in den zwei Staaten werden durchdekliniert: Verlust der Ostgebiete, Umsiedlung, Antifaschismus. Dass die Bundesrepublik größer und erfolgreicher war, ist hinlänglich bekannt; bei Bender liest es sich so, dass der Erfolg unter anderem auf der Westintegration, auf der Hinwendung zu Europa beruhte, was dann auch der gesamtdeutschen Zukunft dienlich war und das nationale Problem dadurch nicht verraten, sondern im Hegelschen Sinne aufgehoben wurde.
Den Ereignissen nach 1970, dem Vier-Mächte-Abkommen samt Transitregelung für die Westberliner, dem Passierscheinverkehr, dem kleinen Grenzverkehr und dem Austausch quasi-diplomatischer Beziehungen zwischen Bundesrepublik und DDR gibt das Buch den meisten Raum:
"... es begann eine andere Zeit, aber niemand wusste, was sie bringen werde. Die Meinungen teilten sich. Viele im Ausland hofften und viele in der CDU und CSU fürchteten, die Anerkennung der Teilung werde die Teilung zur Gewohnheit machen und am Ende zur Lösung der deutschen Frage werden lassen. Andere im Ausland fürchteten und die Anhänger von SPD und FDP hofften, die ersten Brücken über die Teilung würden sich verbreitern und vermehren und das Bewusstsein wieder erwecken und verstärken, dass die Nation noch lebte und dass es Deutschland noch gab... Die meisten Ostdeutschen hofften das gleiche noch viel stärker."
Andere Geschehnisse deutsch-deutscher Geschichte kommen bei Bender nicht vor, weder die Erschütterungen durch Studentenrevolte und RAF noch, auf der anderen Seite, die verschiedenen Konvulsionen der SED-Kulturpolitik. Einflüsse auf den jeweils anderen Staat hatten dies alles immer auch. Irgendwie. Dafür wird an Dinge erinnert, die heute nahezu vergessen sind. Wer kennt noch den Namen Kurt Birrenbach? So hieß ein Bundestagsabgeordneter der CDU, der bei seiner Partei in heillosen Misskredit geriet, da er die Ostpolitik der Brandt-Regierung zu befürworten wagte, während die Mehrheit der von Rainer Barzel geführten Opposition das Ziel hatte, eben dieser Politik wegen Willy Brandt zu stürzen.
Das Buch schließt mit dem Ende der DDR und den Hypotheken der geschehenen Vereinigung. Die Verhandlungen zwischen der Regierung Kohl und der Regierung de Maizière, also zwischen den Beauftragten Schäuble und Krause, werden mehr als gnädig bedacht: Es habe, sagt Bender, hierfür kein geschichtliches Modell und keine Vorbereitung gegeben. Als hätten die gesamtdeutschen Institutionen zu Bonn nicht Jahre- und Jahrzehntelang immer wieder Programme und Szenarien für den Zeitpunkt der Wiedervereinigung ersonnen; dann, als es so weit war, wurden sie entweder nicht nachgefragt oder erwiesen sich als Makulatur. Auch über offensichtlichen Fehler des Einigungsprozesses, vom Geldumtauschkurs bis zu den Restitutionsbestimmungen, beides hat die Ökonomie auf dem Gebiet der DDR fast völlig vernichtet, geht Bender hinweg.
Noch sonst ließe sich das eine und andere aussetzen. Die Klage über die Immission von Anglizismen, in die Bender einstimmt, das so genannte Denglisch, ist zwar höchst populär, aber reichlich übertrieben. Lebendige Sprachen sind wie Organismen: anfällig für modische Krankheiten, doch robust genug, derlei zu überwinden, was dadurch geschieht, dass ein Teil der Wortimporte amalgamiert, die allermeisten wieder ausgeschieden wird. So geschah es im Zeitalter des Humanismus mit dem Lateinischen und im Zeitalter des Absolutismus mit dem Französischen. Wer genau hinschaut, kann sehen, dass sich die Konjunktur der Anglizismen soeben abzuflachen beginnt.
Peter Bender hält, darin folgend seinem Freund Sebastian Haffner, Walter Ulbricht für einen bemerkenswerten Staatsmann. Als einer, der diesen Politiker als Untertan erlebte, darf ich widersprechen. Der Mann war rundherum eine Katastrophe. Abgesehen von seiner unmöglichen Erscheinung und seiner entsetzlichen Sprechweise hat er fortwährend Pleiten produziert. Alle seine Programme, Versprechungen und Aktionen waren illusionär oder widersinnig, seine Personalpolitik war verheerend, nicht einmal den Bau der Berliner Mauer, die seinem Staat immerhin drei Jahrzehnte Existenz sicherte, hat er verwirklicht, dies überließ seinem späteren Nachfolger Honecker. Einzig erfolgreich blieb in seinem eigenen politischen Überleben. Beim Vergleich mit Parteiführern aus den östlichen Nachbarländern, ob sie Cyrankiewicz heißen, Gomułka oder Kádár, war er nichts als ein keifender Zwerg.
Es gab zwei kollektive Bewegungen, die für die bürgerlichen Staatenbildung im 19. und 20 Jahrhundert mitbestimmend waren: die nationale und die soziale Emanzipation. Die Nationwerdung der Deutschen gestaltete sich besonders umständlich. Zu einem einheitlichen Staat brachten sie es erst im Jahre 1871 und dies auch noch, kein gutes Zeichen, in der Folge eines gewonnenen Krieges und proklamiert ausgerechnet in dem nationalen Heiligtum des besiegten Gegners. Gleichwohl blieben die nationalen Kräfte stark genug, die Einheit vom 3. Oktober 1990 zu erreichen, und das Land, das daraus hervor ging, ist, nehmt alles nur in allem, sämtlichen existenten Verwerfungen und Problemen zum Trotz, ein vom Schicksal begünstigtes, ein glückliches Land.
Bender sagt es so:
"Am 3. Oktober 1990 hatte Deutschland die politischen und rechtlichen Folgen des Zweiten Weltkriegs überwunden... 1990 hob 1945 nicht auf. Die Vereinigung machte Deutschland größer, aber nicht groß. Es wurde souverän, aber nicht frei von den Rücksichten, die es vierzig Jahre lang üben musste und klugerweise geübt hatte. Die Niederlage behielt ihre historische Bedeutung. Sie war nicht wie 1918 eine zeitweilige Niederlage, nach der Kraft und Bereitschaft zu neuer Macht- oder Gewalt¬politik wieder wachsen konnten. 1945 war eine endgültige Niederlage, danach war Schluss mit allem Ehrgeiz, Herr Europas zu werden. Der 'Zusammenbruch' blieb das Schlüsselereignis, aus dem sich bis ins neue Jahrtausend die politischen Hauptlinien der deutschen Nachkriegsgeschichte ergaben."
Peter Bender: Deutschlands Wiederkehr
Eine ungeteilte Nachkriegszeit 1945 - 1990
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2007
Es geht um die Frage, wieso der deutsche Nationalstaat, bei Adolf Hitlers schmählichem Abgang 1945 kein Dreivierteljahrhundert alt, nach mehr als vierzig Jahren Besatzung, Demütigung, Teilung und politischer Fremdbestimmung durch zwei einander feindliche Weltsysteme, das Vermögen und die Entschlossenheit besaß, sich wiederherzustellen. Benders Antwort: Die zwei deutschen Teilstaaten blieben stets aufeinander bezogen, manchmal bis zur Spiegelbildlichkeit - auch dann noch, wenn sie sich weit voneinander entfernten.
Der Althistoriker Bender zitiert den Althistoriker Dahlheim über die Nachwirkung des alten Rom:
"Man kann von einem Erbe zehren, ohne viel davon zu wissen ... Menschen handeln, denken und fühlen, geleitet von einem Bewusstsein, dessen Wurzeln ihnen nur selten deutlich sind."
Bender konkretisiert:
"Die vierzigjährige Existenz zweier deutscher Staaten hat die Existenz Deutschlands mehr und mehr in Frage gestellt, aber nicht aufgehoben. Bundesrepublik und DDR blieben, solange sie bestanden, aufeinander bezogen. Gerade die Zeiten der schlimmsten Feindschaft ließen erkennen, dass hier eine Nation mit sich selbst kämpfte: So böse streitet man nur mit dem Bruder. Keiner konnte vom anderen absehen, auch wenn er es wollte. Jeder folgte seinen eigenen Grundsätzen und Erfordernissen, aber meist mit einem Blick auf den Konkurrenzstaat. Keiner durfte sich eine Blöße geben, jeder wollte – möglichst überall – der bessere sein."
Unter diesem Aspekt wird deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1990 erzählt. Die Erbschaften der Vergangenheit und ihre unterschiedliche Bewältigung in den zwei Staaten werden durchdekliniert: Verlust der Ostgebiete, Umsiedlung, Antifaschismus. Dass die Bundesrepublik größer und erfolgreicher war, ist hinlänglich bekannt; bei Bender liest es sich so, dass der Erfolg unter anderem auf der Westintegration, auf der Hinwendung zu Europa beruhte, was dann auch der gesamtdeutschen Zukunft dienlich war und das nationale Problem dadurch nicht verraten, sondern im Hegelschen Sinne aufgehoben wurde.
Den Ereignissen nach 1970, dem Vier-Mächte-Abkommen samt Transitregelung für die Westberliner, dem Passierscheinverkehr, dem kleinen Grenzverkehr und dem Austausch quasi-diplomatischer Beziehungen zwischen Bundesrepublik und DDR gibt das Buch den meisten Raum:
"... es begann eine andere Zeit, aber niemand wusste, was sie bringen werde. Die Meinungen teilten sich. Viele im Ausland hofften und viele in der CDU und CSU fürchteten, die Anerkennung der Teilung werde die Teilung zur Gewohnheit machen und am Ende zur Lösung der deutschen Frage werden lassen. Andere im Ausland fürchteten und die Anhänger von SPD und FDP hofften, die ersten Brücken über die Teilung würden sich verbreitern und vermehren und das Bewusstsein wieder erwecken und verstärken, dass die Nation noch lebte und dass es Deutschland noch gab... Die meisten Ostdeutschen hofften das gleiche noch viel stärker."
Andere Geschehnisse deutsch-deutscher Geschichte kommen bei Bender nicht vor, weder die Erschütterungen durch Studentenrevolte und RAF noch, auf der anderen Seite, die verschiedenen Konvulsionen der SED-Kulturpolitik. Einflüsse auf den jeweils anderen Staat hatten dies alles immer auch. Irgendwie. Dafür wird an Dinge erinnert, die heute nahezu vergessen sind. Wer kennt noch den Namen Kurt Birrenbach? So hieß ein Bundestagsabgeordneter der CDU, der bei seiner Partei in heillosen Misskredit geriet, da er die Ostpolitik der Brandt-Regierung zu befürworten wagte, während die Mehrheit der von Rainer Barzel geführten Opposition das Ziel hatte, eben dieser Politik wegen Willy Brandt zu stürzen.
Das Buch schließt mit dem Ende der DDR und den Hypotheken der geschehenen Vereinigung. Die Verhandlungen zwischen der Regierung Kohl und der Regierung de Maizière, also zwischen den Beauftragten Schäuble und Krause, werden mehr als gnädig bedacht: Es habe, sagt Bender, hierfür kein geschichtliches Modell und keine Vorbereitung gegeben. Als hätten die gesamtdeutschen Institutionen zu Bonn nicht Jahre- und Jahrzehntelang immer wieder Programme und Szenarien für den Zeitpunkt der Wiedervereinigung ersonnen; dann, als es so weit war, wurden sie entweder nicht nachgefragt oder erwiesen sich als Makulatur. Auch über offensichtlichen Fehler des Einigungsprozesses, vom Geldumtauschkurs bis zu den Restitutionsbestimmungen, beides hat die Ökonomie auf dem Gebiet der DDR fast völlig vernichtet, geht Bender hinweg.
Noch sonst ließe sich das eine und andere aussetzen. Die Klage über die Immission von Anglizismen, in die Bender einstimmt, das so genannte Denglisch, ist zwar höchst populär, aber reichlich übertrieben. Lebendige Sprachen sind wie Organismen: anfällig für modische Krankheiten, doch robust genug, derlei zu überwinden, was dadurch geschieht, dass ein Teil der Wortimporte amalgamiert, die allermeisten wieder ausgeschieden wird. So geschah es im Zeitalter des Humanismus mit dem Lateinischen und im Zeitalter des Absolutismus mit dem Französischen. Wer genau hinschaut, kann sehen, dass sich die Konjunktur der Anglizismen soeben abzuflachen beginnt.
Peter Bender hält, darin folgend seinem Freund Sebastian Haffner, Walter Ulbricht für einen bemerkenswerten Staatsmann. Als einer, der diesen Politiker als Untertan erlebte, darf ich widersprechen. Der Mann war rundherum eine Katastrophe. Abgesehen von seiner unmöglichen Erscheinung und seiner entsetzlichen Sprechweise hat er fortwährend Pleiten produziert. Alle seine Programme, Versprechungen und Aktionen waren illusionär oder widersinnig, seine Personalpolitik war verheerend, nicht einmal den Bau der Berliner Mauer, die seinem Staat immerhin drei Jahrzehnte Existenz sicherte, hat er verwirklicht, dies überließ seinem späteren Nachfolger Honecker. Einzig erfolgreich blieb in seinem eigenen politischen Überleben. Beim Vergleich mit Parteiführern aus den östlichen Nachbarländern, ob sie Cyrankiewicz heißen, Gomułka oder Kádár, war er nichts als ein keifender Zwerg.
Es gab zwei kollektive Bewegungen, die für die bürgerlichen Staatenbildung im 19. und 20 Jahrhundert mitbestimmend waren: die nationale und die soziale Emanzipation. Die Nationwerdung der Deutschen gestaltete sich besonders umständlich. Zu einem einheitlichen Staat brachten sie es erst im Jahre 1871 und dies auch noch, kein gutes Zeichen, in der Folge eines gewonnenen Krieges und proklamiert ausgerechnet in dem nationalen Heiligtum des besiegten Gegners. Gleichwohl blieben die nationalen Kräfte stark genug, die Einheit vom 3. Oktober 1990 zu erreichen, und das Land, das daraus hervor ging, ist, nehmt alles nur in allem, sämtlichen existenten Verwerfungen und Problemen zum Trotz, ein vom Schicksal begünstigtes, ein glückliches Land.
Bender sagt es so:
"Am 3. Oktober 1990 hatte Deutschland die politischen und rechtlichen Folgen des Zweiten Weltkriegs überwunden... 1990 hob 1945 nicht auf. Die Vereinigung machte Deutschland größer, aber nicht groß. Es wurde souverän, aber nicht frei von den Rücksichten, die es vierzig Jahre lang üben musste und klugerweise geübt hatte. Die Niederlage behielt ihre historische Bedeutung. Sie war nicht wie 1918 eine zeitweilige Niederlage, nach der Kraft und Bereitschaft zu neuer Macht- oder Gewalt¬politik wieder wachsen konnten. 1945 war eine endgültige Niederlage, danach war Schluss mit allem Ehrgeiz, Herr Europas zu werden. Der 'Zusammenbruch' blieb das Schlüsselereignis, aus dem sich bis ins neue Jahrtausend die politischen Hauptlinien der deutschen Nachkriegsgeschichte ergaben."
Peter Bender: Deutschlands Wiederkehr
Eine ungeteilte Nachkriegszeit 1945 - 1990
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2007
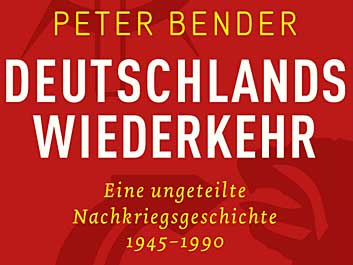
Peter Bender: Deutschlands Wiederkehr© Klett-Cotta Verlag