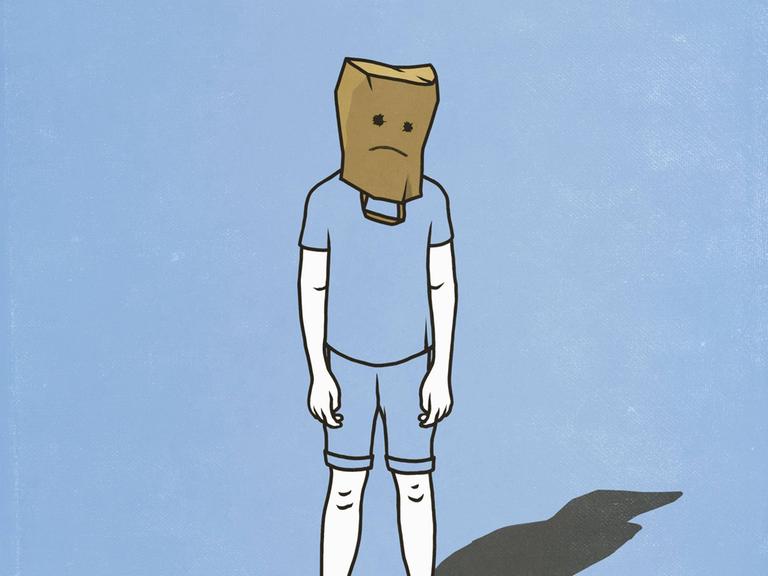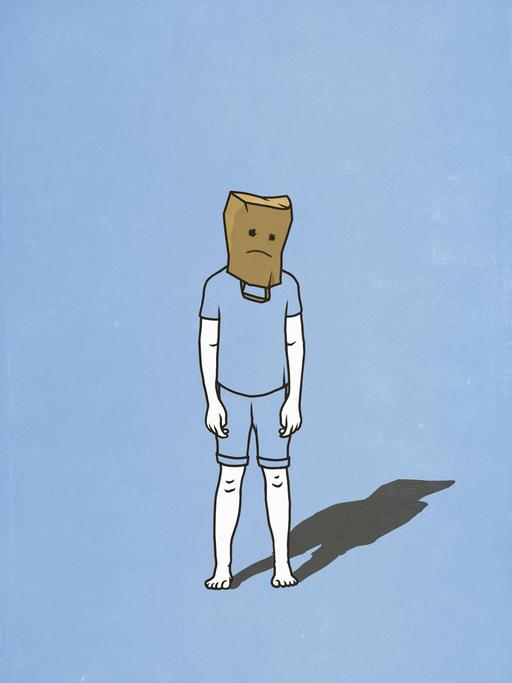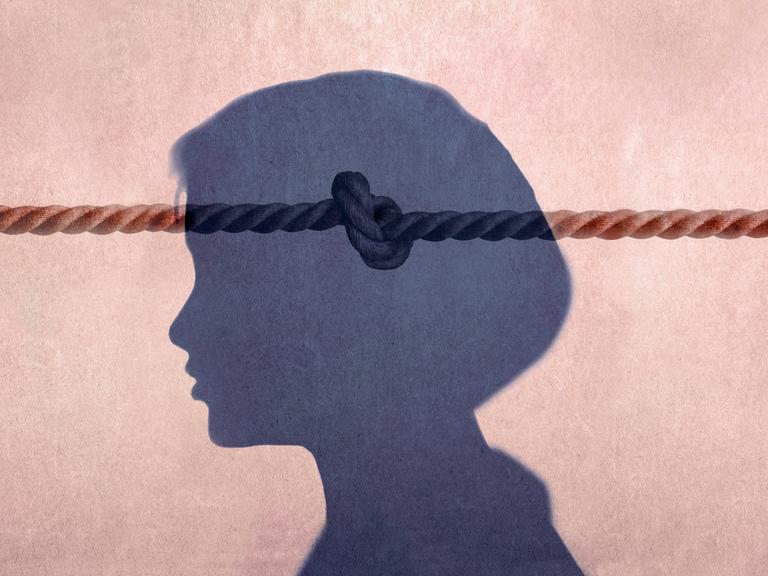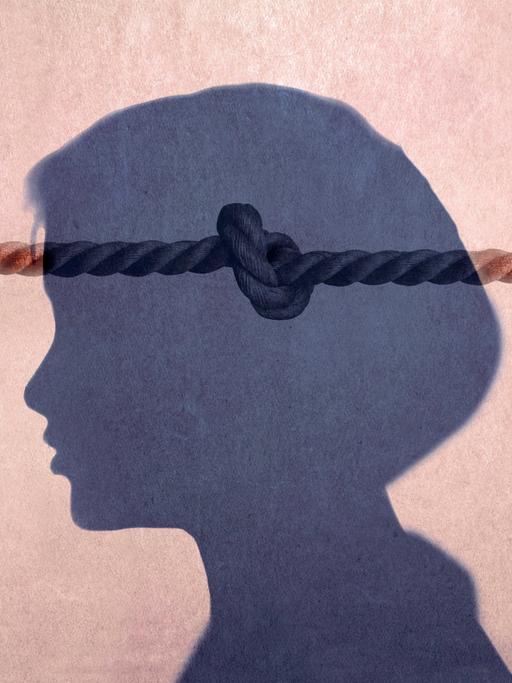Instagram Talk

In unserem neuen Instagram-Format “Treffen sich zwei mit...” bringen wir jeweils zwei neurodivergente Menschen zusammen, die mit derselben Diagnose durchs Leben gehen. © Deutschlandradio
Treffen sich zwei mit...

Wie fühlt es sich eigentlich an, depressiv zu sein? Können Menschen mit Borderline Beziehungen führen? Diesen Fragen gehen wir in unserem neuen Instagram-Format "Treffen sich zwei mit ..." nach.
An manchen Tagen komme sie gar nicht an ihrer Depression vorbei, sagt Shari. Da sei die Depression wie ein Türsteher, der sich vor ihr aufbaut und ihr den Weg versperrt zu ihrem wahren Ich.
Erfahrungen mit ADHS, Depression, Borderline
Wie fühlt es sich eigentlich wirklich an, depressiv zu sein? Verletzen sich wirklich alle Menschen mit Borderline selbst? Und warum sind ausgerechnet laute, feuchtfröhliche Abende in Bars die Momente, in denen Personen mit ADHS endlich einmal den Kopf frei kriegen?
In unserem neuen Instagram-Format "Treffen sich zwei mit..." bringen wir jeweils zwei Menschen zusammen, die mit derselben Diagnose durchs Leben gehen. Durch ihre ähnlichen Erfahrungen entsteht von Anfang an eine besondere Verbindung.
Zwei Menschen, eine Diagnose
Das Set ist gemütlich, die Atmosphäre ist intim, und was als Begegnung von zwei Fremden mit gleicher Diagnose beginnt, entwickelt sich schnell zu einem tiefen, vertrauten und berührenden Gespräch.
Darin ist sowohl Raum für kleine, vermeintlich banale Beobachtungen aus dem Alltag wie die besondere Art und Weise, auf die Jenny wegen ihrer ADHS Mandarinen schälen muss. Als auch für große und bewundernswert offene Momente voller Verletzlichkeit, wenn etwa Joelle mit Tränen in den Augen über ihren Selbsthass spricht.
Der Reiz des Dabeiseins
Die Idee des Formats ist es, aus diesen langen und intensiven Gesprächen starke Momente und kürzere, thematisch in sich geschlossene Abschnitte herauszulösen, die als Clips auf Instagram für sich allein stehen können.
Joelle und Laura tauschen ihre Borderline-Erfahrungen aus. Dabei diskutieren sie zum Beispiel, wie man in Liebesbeziehungen konstruktiv mit der Diagnose umgehen kann - einem weitverbreiteten Vorurteil zum Trotz. Und sie erzählen einander, was sie ihrem jüngeren Ich damals gern gesagt hätten, als beide das Gefühl quälte, als einzige "nicht normal" zu sein.
Rabia und Shari sprechen über das Thema Depression. Sie erinnern sich daran, wie es ihnen zunächst schwerfiel, sich mit dem Begriff zu identifizieren, weil so viele Klischees darüber kursieren.
Andererseits habe sie die Diagnose auch als große Entlastung empfunden, sagt Shari. Und Rabia verrät, weshalb ihre Heilung für sie im Moment erste Priorität hat und sie sich ohne ein stabiles Selbstwertgefühl niemals auf ein Date einlassen würde: "Das ist wie mit leerem Magen einkaufen zu gehen, man schnappt nämlich alles."
Fanny und Jenny erzählen aus dem Alltag mit einer ADHS-Diagnose. Dabei kommen sie auf ihren Umgang mit Zeit und auf Strategien beim Aufräumen ebenso zu sprechen wie auf Erwartungen von "neurotypischen" Menschen, die ihnen Schwierigkeiten machen.
So seien Workflows meist an den Fähigkeiten und Bedürfnissen einer breiten Masse orientiert, weshalb Personen mit ADHS, die Aufgaben auf andere Weise lösen, oft auf Unverständnis stießen.
Einschneidende Erfahrungen haben Fanny und Jenny auch mit der Wirkung von Medikamenten gemacht. Das Gefühl, im Trubel eines Cafés oder beim Wochenendeinkauf in einem vollen Supermarkt zum ersten Mal nicht von Reizen überflutet, abgelenkt und völlig überfordert zu sein, kann beinahe zu Tränen rühren: "Ach, so ist das für die meisten anderen Menschen! Die kommen nach dem Einkaufen raus und können noch einen Tag bewerkstelligen."
Einblicke ins Leben von Betroffenen
Ziel des Talk-Formats ist es, einen Einblick in das Leben von Betroffenen zu geben, es greifbarer zu machen, auch wenn man vielleicht selbst noch keine ähnlichen Erfahrungen gemacht hat.
Dabei geht es uns um zwei Kerndynamiken, die Social Media besonders reizvoll machen: den sogenannten "Schlüssellocheffekt", also das Dabeisein, ohne dabei zu sein, und die Erfahrung, sich im Gesagten wiederzuerkennen.
"Treffen sich zwei mit..." schafft Verständnis für die Perspektiven von Menschen, die für ihre mentale Gesundheit kämpfen müssen. Und gleichzeitig macht das Format ihre Perspektiven sichtbar und bestärkt sie darin, nicht allein zu sein.