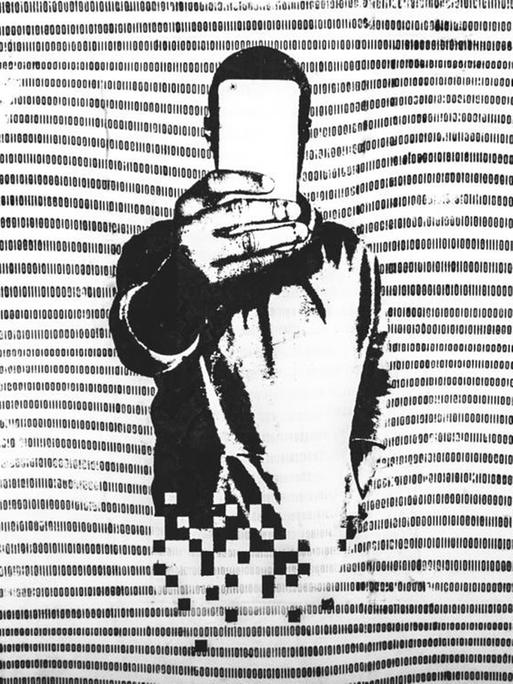Die Erstausstrahlung des Features war am 9. Juni 2022.
Internetsucht bei Erwachsenen

Etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland gab 2021 an, regelmäßig Computer zu spielen. Doch ab wann wird das zur Sucht? (Symbolbild) © Unsplash / Alexander Andrews
Der will doch nur spielen!
29:39 Minuten

Die Digital Natives werden erwachsen – und mit ihnen auch die Internet- und Computerspielsüchtigen. Die sogenannte "Gaming Disorder" gibt es seit 2019 auch als Diagnose. Doch Kritiker mahnen vor Stigmatisierung und unnötiger Panikmache.
Dießen am Ammersee, ein sonniger April-Nachmittag. Der Löwenzahn blüht, die Bäume in jungem Grün. Oberhalb des Ortes ein kleines Gehöft. Zwei Hunde, Schafe, Esel. Im Eselstall eine Gruppe Frauen und Männer – sie striegeln die Tiere, unterhalten sich, scherzen. Tiertherapie der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen bei Markus Schnitzler und Nadja Thienelt.
„Der Esel, der sagt: Ich bin jetzt da. Und wenn Du jetzt Lust hast, kannst Du streicheln, musst aber nicht. Und auf einmal lösen sich da Dämme. Und der Esel macht nichts, was er nicht will“, sagt Markus Schnitzler.
„Zum Beispiel in der letzten Gruppe war ein sehr junger Patient, erst 18, der hat die Esel geführt, durch den Wald, den Berg hoch. Und er war so stolz, dass er bergauf mit dem Esel diese Strecke bewältigt hat. Es sind auch ein paar Tränen geflossen. Er hat seinen Körper gespürt, seine Muskeln gespürt. Er hat gespürt, dass der Esel freiwillig mitkommt, dass ihm jemand folgt“, erzählt Nadja Thienelt.
Licht und Luft, andere Lebewesen, der eigene Körper: Wer ins Kloster Dießen kommt – eine Spezial-Klinik unter anderem für Internet- oder Computerspielsucht – für die oder den ist das fremd geworden.
19 Stunden am Tag zocken
„Einer der ersten Patienten, die wir hier oben hatten, der hat wirklich 19 Stunden am Tag gezockt. Und der hat mir dann erzählt, seine größte Errungenschaft war ein Klo-Stuhl. Weil, da musste man dann gar nicht mehr aufstehen“, sagt Markus Schnitzler.
„Und da hat alles drunter gelitten: Er hat sich einfach nicht mehr umgezogen, Waschen und Essen war nebensächlich. Und hat sich da so zugemüllt und hat alle Kontakte nach draußen komplett abgebrochen. Der konnte auch nicht laufen. Wir sind dann so ein Stück über die Wiese gegangen und da hat er gesagt, er war schon jahrelang nicht mehr so weit im Gelände. Das war aber eine Strecke von keinen 500 Metern.“

Tiere leben im Hier und Jetzt: Manchen Spielsüchtigen hilft eine Eseltherapie. (Symbolbild)© AFP / Christina Quicler
Pubertierende Jungs in dunklen Zimmern. Da zocken sie, bei Pizza und Energydrinks, Tag und Nacht, vermutlich Ballerspiele. So das Klischee, wenn es um Gamer und Computerspiele geht. Es hält sich hartnäckig, der Verdacht der Sucht schwingt immer mit. Zu Unrecht. Und auch wieder nicht: Rund 60 Jahre nach der Entwicklung des ersten Computerspiels sind Konsolen-, Handy- und Online-Spiele fester Bestandteil von Alltag und Freizeit.
Viele Frauen unter den Social-Media-Süchtigen
Etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland gab 2021 an, regelmäßig Computer zu spielen, Männer und Frauen gleichermaßen, Durchschnittsalter: Mitte 30. Und: Ja! Für einige von ihnen ist das Spielen zum Problem geworden. Zur Sucht, die Fachleute unter „internetbezogene Störungen“ einordnen.
„Es gibt weltweit immer wieder Studien, die sich mit der Prävalenz von Internet- und Computerspielsucht beschäftigen. Die zeigen sehr klar, dass die Computerspielsucht am häufigsten ist, gerade auch, wenn es darum geht, Menschen zu behandeln. In den Studien an größeren Populationen findet man ganz viele Social-Media-Süchtige auch, das sind eher Frauen, vor allem junge Frauen. Die dritte Gruppe sind die Online-Sexsucht-Varianten.“
Bert te Wildt, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin und Gründer der Klinik Kloster Dießen. Er beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit den Folgen der Nutzung digitaler Medien.
„Insgesamt muss man sagen, ganz vorsichtig geschätzt, geht es um eine Zahl von ein bis zwei Prozent der Bevölkerung. Das sind über eine Million dann in Deutschland.“
Alter der Computerspielsüchtigen steigt

Unter den Social-Media-Süchtigen sind viele jüngere Frauen und Jugendliche. (Symbolbild)© pexels / Katerina Holmes
„Das heißt, die Internet- und Computerspielsüchtigen wachsen nach, nach wie vor. Die Computerspielsüchtigen werden zunehmend erwachsen.“
Tobias zum Beispiel, 27 Jahre, aus München. Er ist seit einigen Wochen Patient im Kloster Dießen.
„Ich bin hier primär wegen Computersucht, aber auch wegen Depressionen.“
Tobias heißt nicht Tobias – und auch der Gedanke, dass ihn jemand an der Stimme erkennen könnte, ist ihm unangenehm. Dabei scheint nichts an ihm auffällig: Er ist aufmerksam, antwortet freundlich, wirkt sportlich und aufgeräumt. Er hat nie die Schule geschwänzt – schon als Grundschüler allerdings spielt er viel. Erst Gameboy, später vor allem Online-Multiplayer. Oft vom frühen Nachmittag an bis weit nach Mitternacht, in den Ferien bis morgens um fünf oder sechs. Er macht Abitur. Dass etwas schiefläuft, deutet sich aber erst richtig an, als mit der Schule die klare Tagesstruktur wegbricht.
Der Computer füllt nicht das Leben
„Ich habe danach studiert, aber irgendwann, habe ich schon gemerkt: Mir fällt es extrem schwer. Ich könnte mehr machen. Aber der Computer hat einfach den Raum eingenommen. Und ich wollte ihn auch dem Computer überlassen, sage ich mal.“
Einen Bachelorabschluss in Informatik hat er trotzdem in der Tasche, derzeit macht er seinen Master.
„Das Problem ist, dass ich, ich sage mal, die Minimalanforderungen für ein Leben erfülle. Also ich habe eine Aussicht auf eine berufliche Zukunft. Aber es ist nichts, was dieses Leben füllt: kaum Freundschaften, keine Beziehung, keine Hobbys. Nichts, wo ich wirklich sagen würde: Das mache ich gerne. Der Computer füllt ja auch nicht das Leben. Der Computer macht mir zum Großteil der Zeit nicht mal mehr Spaß, weil ich nicht sage: Hey, ja – jetzt sitze ich gerne vor dem Computer. Sondern es ist mein Standardzustand fast schon“, sagt er.
„Der Moment, wo ich mir wirklich eingestanden habe, dass ich süchtig bin, war nach einem Urlaub. Mit Freunden tatsächlich, wo es mir eigentlich recht gut ging. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe zwei Wochen straight durchgezockt. Einfach nur straight durchgezockt. Und da ist mir dieser Unterschied klargeworden zwischen: ‚Okay, ich bin im Urlaub mit Freunden und es geht mir gerade recht gut‘. Und: ‚Ich sitze am Computer. Ich tue das, was theoretisch ja mein Hobby ist, und es geht mir richtig scheiße‘.“
Forschung seit Ende der 80er-Jahre
Ob – und wenn ja, wie – es möglich ist, von digitalen Medien abhängig zu werden, beschäftigt die Forschung etwa seit Ende der 1980er-Jahre. 1995 entsteht in den USA das erste Zentrum zur Behandlung von „Internetabhängigkeit“, 2013 gerät speziell die Computerspielsucht in den Fokus.
Neun Kriterien gelten inzwischen als gut erforscht: Wenn die Gedanken ständig ums Spielen kreisen etwa und mehr und mehr Zeit mit Spielen verbracht wird; wenn jemand unruhig und gereizt auf den Entzug von Spielen reagiert und Hobbys, Schule oder Arbeit übers Spielen vernachlässigt. Sind mindestens fünf Kriterien ein Jahr lang erfüllt, kann eine sogenannte „Gaming Disorder“ vorliegen. Seit 2019 steht die Diagnose offiziell im Krankheitsklassifikationskatalog ICD-11 der WHO.
„Es gab Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus den Sozialwissenschaften, aber auch Psychologen, die das schwierig fanden und sagten: Das ist eine Pathologisierung von Verhalten, von eigentlich auch normalem menschlichen Verhalten.“
Thorsten Quandt, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Münster, ist damals einer von 37 Wissenschaftlern, die sich in einer Fachzeitschrift kritisch zur Einführung der Diagnose „Gaming Disorder“ äußern.
„Es ist nicht so, dass jemand in Abrede stellen möchte, dass es Problemfälle gibt und auch Nutzerinnen und Nutzer, die sich im Spiel verlieren. Sondern der Gegenstand der Debatte war im Prinzip, dass die Daten nicht darauf hindeuteten, dass das langfristige Probleme waren. Und das passte nicht zu dieser Aussage: ‚Das ist eine Suchterkrankung und betrifft größere Teile der Bevölkerung‘. Es fehlen Differenzierungen. Im Prinzip wurde ja das Spielen quasi grosso modo als ein Problem definiert. Als würde man sagen: Ja, Fernsehen oder Lesen macht per se süchtig.“
Falsche Kausalitäten durch Diagnose?
Gibt es erst einmal eine Diagnose, eine Klassifikation exzessiven Computerspielens als Krankheit, so befürchteten Kritikerinnen und Kritiker, dann legt das eine Kausalität nahe, die auf eine falsche Fährte führen kann: Ein Medium wird zum Suchtmittel erklärt, dessen Nutzung immer begleitet ist von der Gefahr der Abhängigkeit. Und das aufgrund von Kriterien, die vor allem die Intensität der Nutzung erfassen und wie sehr diese von einem als normal definierten Alltag ablenkt.
„Wenn ich dieses Prinzip anlege, dann gibt es irgendwo den Punkt, wo ich fast alles pathologisieren kann, was Leute extrem machen. Also da ist es dann auch eine Frage der Bewertung: Wenn jemand ein Hobby hat, was besonders wertvoll ist, also er liest Bücher oder betätigt sich kreativ, scheint es niemanden zu stören, wenn diese Personen das für viele Stunden am Tag machen. Und wenn ich mit derselben Logik eigentlich rangehen würde und würde sagen: ‚Das hat ein hohes Zeitkontingent, wir haben eine Okkupation der Gedanken oder es gibt auch Konflikte mit Partnerinnen und Partnern‘ – wenn ich diese Kriterien ansetze, dann kann man viele Hobbys auch schon pathologisieren. Das finde ich sehr schwierig, da überhaupt eine Grenze zu ziehen.“
Spiele-Leidenschaft als Makel
Freitagabend. Ein Ort in der Nähe von Köln, ein großzügiges Einfamilienhaus. Hier wohnt Hanno mit Frau und zwei Kindern. Er ist Anfang 50, Berater für IT- und Digitalisierungsstrategien. Seit Jahren in Leitungspositionen, derzeit in einem großen deutschen Unternehmen.
In seinem Zimmer: zwei Schreibtische mit jeweils mehreren großen Monitoren, Headsets, Mikrofon, ergonomische Stühle. Ein Sideboard unter der Dachschräge
„Du siehst die ganzen Sachen, die ich hier stehen habe: ‚Dungeons and Dragons‘-Bücher, Terry Pratchett, ‚Warhammer 40k‘, die ganzen Spieleverpackungen und sonst irgendetwas... Das ist aber für viele Leute tatsächlich ein Makel, sowas zu machen. Mein Chef hat irgendwann, bei einer Videokonferenz – da hat dieses Hintergrund-Wegmachen nicht funktioniert – und dann sah er diese ganzen Bücher und meinte: 'Ist das Ihr Kinderzimmer?'“
Auch Hanno möchte, vielleicht deshalb, nicht mit seinem richtigen Namen auftauchen.
„World of Warships“ oder „World of Tanks“ spielt Hanno nahezu täglich, manchmal 15 Minuten, manchmal drei oder vier Stunden lang. Dazu aktuell „Startrek Fleet Command“ auf dem Handy, das neu gekaufte „Dune“ ist noch nicht ausprobiert. Computerspiele, erzählt Hanno, gehören zu seinem Leben, seit er sieben ist. Anfang der 1980er spielt er, zusammen mit drei Freunden aus dem Gymnasium, „jede mögliche freie Minute“.
In der Schule sind sie die Nerds.
„Ich kann mich noch supergut an ‚Elite‘ erinnern, du hast einfach ein Raumschiff und die Milchstraße. Und das hat uns so fasziniert, dass man da einfach fliegen konnte und Handel zwischen den Planeten treiben. Und ich weiß noch, wie wir in den Pausen dagesessen haben und uns aus den Stationen die Preise für die einzelnen Rohwaren aufgeschrieben haben und gesagt haben: ‚Okay, wie fliegen wir am besten, um genug Geld für das Upgrade des Raumschiffes XY oder so was zu bekommen?‘ Und dann haben wir uns nachmittags getroffen und sind das genauso abgeflogen.“
Spielen ist auch eine soziale Angelegenheit
Die Eltern? Freuen sich, dass der Junge so viel draußen ist.
„Also für die war ich immer unterwegs. Ein normaler Junge, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Dass ich aber bloß übers Feld gefahren bin und dann bei meinem Kumpel vorm Rechner gesessen habe… Wir waren jeden Tag bei einem anderen Kumpel, ne? Und haben da halt einfach gespielt.“
Spielen ist für den 51-Jährigen bis heute eine soziale Angelegenheit. Während er spielt, läuft immer ein Chat oder ein Stream, in dem er sich mit anderen Spielern über das Spiel austauscht. Oder verfolgt, was sie gerade spielen. Einige sind inzwischen gute Bekannte geworden. Man teilt Alltagssorgen, gratuliert sich zu Geburtstagen, schickt Geschenke zu Geburten. Im Prinzip nicht viel anders als bei Fußball-Fans, die zusammen kicken und zusammen Bundesliga-Spiele schauen.
„Ich nehme nochmal ‚Dungeons and Dragons‘, das war unser Corona-Ding: Wir hatten eine Familie, mit der haben wir uns regelmäßig getroffen. Wir waren also vier Personen am Tisch und ein weiterer Freund noch dabei, aber der war per Computer dazugeschaltet. So. Das war halt so ein In-Person-Rollenspiel, was wir gemacht haben. Wenn ich das Gleiche aber rein online mache, dann mach ich per Definition ein Computerspiel, tauche in eine Fantasiewelt ab – und das soll dann problematisch sein! Ich rede mit echten Menschen, die einfach sagen: Wir haben eine Verabredung und wir spielen etwas gemeinsam. Ich denke, das ist nichts, was man problematisieren kann.“
Forscher: Panikmache ist nicht angebracht
„Ja, mittlerweile wissen wir doch, dass es wesentlich entscheidender ist, genauer darauf zu schauen. Es gibt diesen wunderbaren Vergleich, dass ein Alkoholiker ja auch nicht von Flaschen abhängig ist, sondern es kommt auf den Inhalt an.“
Christian Montag, Professor für Molekulare Psychologie an der Universität Ulm.
„Tatsächlich bezieht sich diese Abhängigkeit als Begriff, der übrigens heftig diskutiert wird, auf bestimmte Kanäle. Wir wollen ja nicht Millionen Menschen, die gern Computerspiele machen, ein Suchtthema andichten. Sondern den Menschen, die Problemverhalten entwickeln, eine Hilfestellung anbieten. Jede Form der Panikmache ist überhaupt nicht angebracht.“
Computerspielen gehört zum Alltag – für rund drei Milliarden Menschen weltweit. 2021 betrugen die Umsätze mit Computerspielen allein in Deutschland etwa sechs Milliarden Euro: knapp das 17-fache des Kinomarkts und das 7-fache der Umsätze der Musikindustrie. Die Webseite Mobygames, die Computerspiele katalogisiert, verzeichnet inzwischen mehr als 100.000 Einträge in mehr als 50 Kategorien.
Parallel dazu verbringen immer mehr Menschen Zeit auf Social-Media-Plattformen und mit Streamingdiensten: knapp 73 Millionen Deutsche nutzen mittlerweile Twitter, Facebook und immer öfter TikTok, im Durchschnitt anderthalb Stunden täglich, vor allem per Tablet und Smartphone. Mit ihnen hat sich der Forschungsfokus erweitert: Was zieht uns in die virtuellen Welten und was hält uns dort? Wen besonders? Und: Woran liegt es, dass sich einige dort verlieren?
Drei Fragen, um Problemverhalten zu verstehen
„Wir müssen drei Fragen berücksichtigen um zu verstehen, warum manche Menschen – und zum Glück sind es ja nicht so viele – ein ausgeprägtes Problemverhalten entwickeln.“
Christian Montag forscht seit Jahren zur Frage, wie digitale Umgebungen unsere psychische Gesundheit beeinflussen.
„Das sind die Wer-, Wie- und Warum-Fragen. ‚Wer‘ heißt: Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigen, ‚Wie‘: Ist es eher eine aktive und passive Form der Nutzung? Und dann natürlich auch das Warum. Welche Motive sind dahinter?“
Eine ganze Reihe von Studien hat in den vergangenen Jahren darauf hingewiesen, dass Personen eher dann exzessiv spielen, wenn sie einen hohen Grad an Neurotizismus aufweisen – Menschen zum Beispiel, die eher ängstlich sind und zu depressiven Verstimmungen neigen. Zudem sind es häufiger Personen, die wenig gewissenhaft sind.
„Ich muss eigentlich die Hausarbeit machen und dann ist die Social-Media-Plattform eine ganz nette Ablenkung und dann klopft man sich so mental auf die Finger und sagt: ‚Nein, ich konzentriere mich jetzt und bleib bei der Sache‘. Und diese Form der Selbstregulation fällt weniger gewissenhaften Leuten schwerer. Allerdings darf man das bitte nicht als Suchtpersönlichkeit verstehen. Wir reden hier über Wahrscheinlichkeitszusammenhänge. Das heißt, es ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass Personen, die diese Persönlichkeitsausprägungen stärker zeigen, auch ein Problem entwickeln, aber das sind keine Eins-Null-Funktionen, die wir hier haben.“
Anerkennung für bestimmte Fertigkeiten
Menschen sind soziale Wesen. Sie interagieren, sie kommunizieren, sie spielen. So messen wir unsere Kräfte, stellen Stärken und Schwächen fest, erproben Rollen. So entwickeln wir Fantasie und Kreativität, schulen Sinne und soziale Kompetenzen. Je nach Kommunikation, je nach Spiel mehr oder weniger. Bewältigen wir eine Aufgabe, entwickeln eine Fertigkeit oder bekommen Anerkennung, sorgt das Gehirn über die Ausschüttung von Endorphinen, Oxytocin und Dopamin dafür, dass wir Lust und Freude empfinden. Und – dass wir Vorfreude entwickeln: Dass wir motiviert werden, die Dinge erneut zu tun, die uns Freude bereitet haben.
„Ego-Shooter für alte Leute“ nennt Hanno seine beiden Lieblingsspiele: das Spieletempo sei gemächlich, die Community nett und unterstützend. Nicht unbedingt die Regel.

Gehört zu den sogenannten Multiplayer-Online-Rollenspielen: das Computerspiel "World of Warcraft", das auch von Erwachsenen gespielt wird. (Symbolbild)© picture alliance / TT News Agency / Aftonbladet / Thomas Johansson
„Ein klassisches Beispiel ist eigentlich ‚League of Legends‘. Man denkt so: ‚Ach, schönes Spiel, ich probiere das jetzt auch mal‘. Aber wenn die anderen Spieler merken, dass Du Anfänger bist, dann wirst Du beleidigt. Und zwar nicht nett!“
Und noch etwas beobachtet er mit Unbehagen: Spielen macht vielen Spielern immer weniger Spaß
„Gibts ganz viel. Gerade bei MMORPGs, also Multiplayer-Online-Rollenspiele, so etwas wie ‚World of Warcraft‘‚Glaube 2011/12‘ haben sie dieses Achievement-System eingebaut. Und man konnte bestimmte Achievements nur zu bestimmten Zeiten erfüllen. Und wenn man das zu der Zeit nicht gemacht hat, dann hat man sie nie mehr bekommen. Und das spricht ganz schlimme Sachen beim Menschen an: ‚Oh mein Gott, ich habe nur noch heute die Möglichkeit, dieses digitale Ding zu erreichen und dann muss ich das jetzt weitermachen. Auch wenn ich keinen Bock mehr habe.‘ Das ist ein fieser psychologischer Druck, der aufgebaut wird und ich kenne Leute, die darüber irgendwann gesagt haben: ‚So, jetzt muss ich wirklich komplett aufhören. Ansonsten gehe ich darin kaputt.‘“
Manipulation durch Tech-Konzerne
„Manipulation ist, glaub ich, ein Begriff, der hier durchaus zutreffend ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Zeitalter des Überwachungskapitalismus leben, Tech-Konzerne verdienen ihr Geld damit, dass sie uns maximal ausspähen. Sie haben ein Interesse daran, möglichst viel Engagement auf unserer Seite zu erzeugen und das hat eben dazu geführt, dass diese Plattformen Elemente verbaut haben, die darauf abzielen, dass wir dort eben mehr Zeit verbringen als uns lieb ist.“
Dieser Punkt wird in der Debatte um Internetsucht oft vernachlässigt. Professor Christian Montag.
„Dass man mal gesagt hat: ‚Ja, jetzt bist du nicht so gewissenhaft, ändere dich doch jetzt mal! Ist doch dein Problem!‘ Nein! Damit vergessen wir eine entscheidende Seite, nämlich: Diejenigen, die diese Plattformen betreiben, die darauf abgezielt haben, immersive Umwelten zu schaffen, in denen wir Raum und Zeit verlieren.“
„Persuasive technology“, Überzeugungstechnologie, werden in der Tech-Welt Anwendungen oder Designs genannt, die das Nutzerverhalten in Richtung eines bestimmten Ziels beeinflussen wollen. Einer der ältesten dieser Mechanismen ist der Facebook-Like-Button, der eine Art soziale Währung geworden ist: Die Anzahl der Likes für Posts einer Person geben Auskunft über ihre Reichweite und ihr Ansehen im Netzwerk. Ab einem bestimmen Punkt greift das, was Verhaltensökonomen den „Besitztumseffekt“ nennen: Hat sich jemand auf diese Weise etabliert, bekommt – in diesem Fall – der Facebook-Account für diese Person einen Wert. Ein Effekt, der auch in vielen Spielen wirkt, macht Christian Montag deutlich.
„Sie sammeln jeden Tag ein paar Münzen und ihre kleine Welt wird immer größer. Sie haben dort Lebenszeit investiert. Das ist ihre kleine Welt. Und den Menschen fällt es unglaublich schwer, dann zu sagen: Ich lösche jetzt diese App, weil sie einfach meine Zeit im Alltag wegnimmt. Da greift dieser Besitztumseffekt. Was müsste man Ihnen jetzt geben, damit Sie diese App tatsächlich löschen?“
Medienabhängige: viel Kopf, wenig Körper
Zurück in die Klinik Kloster Dießen, zur Tiertherapie mit Nadja Thienelt. Ihre Patienten mit Medienabhängigkeit oder Gaming Disorder, so hat sie beobachtet, agieren tatsächlich oft anders als andere Patienten.
„Die Zocker – sage ich jetzt mal allgemein, also nicht bewertend – bevor sie anfangen, die Tiere zu treiben, sprechen sie sich erst einmal mindestens fünf Minuten ab und sagen: ‚Ja, wenn die Schafe dahin gehen, wer springt denn da ein oder wer geht von der Seite hin.‘ Die nicht medienabhängige Gruppe, die sagen: ‚Gut, wir gehen jetzt mal los und schauen mal dynamisch, was passiert denn.‘ Die medienabhängige Gruppe, die macht strategisch Plan A, Plan B, Plan C. Und oftmals verlieren sie sich dann im Diskutieren und beachten die Schafe gar nicht mehr und die sind dann weg.“
Viel Kopf, wenig Körper – das funktioniert nicht gut im Umgang mit Tieren.
„Beim Esel oder beim Schaf, da geht einfach nicht Plan B. Das spürt, wie du bist, im Hier und Jetzt, das spiegelt direkt deine Wirkung auf das Tier. Das Tier riecht deinen Schweiß, das riecht über deinen Schweiß die Hormone und gibt Informationen über deinen jetzigen Zustand.“
Will man mit anderen Lebewesen erfolgreich in Verbindung treten, direkt und unvermittelt, dann spielt die körperliche Präsenz eine Rolle, die eigene und die des Gegenübers. Körperliche, physische Reaktionen können unterstützend wirken oder einschüchtern, nervös machen oder beruhigen – je nach Situation, nach Tagesform – und müssen auch in gleichen Situationen nicht immer gleich sein.
„Das ist die direkte Interaktion und das ist der Unterschied zum Bildschirm, zu den Coins, zur Belohnung.“
Typische Begleiterkrankungen
Aufmerksamkeit aufzubringen für die Vielschichtigkeit, Unmittelbarkeit und Unvorhersehbarkeit im direkten Miteinander – das haben Menschen, bei denen vor allem Computerspielen zur Sucht geworden ist, scheinbar verlernt. Oder – sie hatten schon immer Schwierigkeiten damit.
„Was wir heute wissen, ist, dass eben Depressionen, Angsterkrankungen – vor allen Dingen soziale Phobie – und das Aufmerksamkeitshyperaktivitätssyndroms ADHS ganz typische Begleiterkrankungen sind, manchmal auch Vorerkrankungen“, sagt Bert te Wildt, Chefarzt der Klinik Kloster Dießen.
„Und wenn wir jetzt jemanden vor uns sitzen haben, der eine soziale Phobie hat, eine Depression und eine Computerspielsucht – und wenn derjenige schon als Kind sehr viel Computerspiele zum Beispiel genutzt hat, bestimmte Entwicklungsaufgaben gar nicht für sich hat lösen können, die ja häufig was mit der analogen Welt zu tun haben, also mit der Sinnlichkeit, mit der unmittelbaren Zwischenmenschlichkeit, dann ist das gar nicht so einfach auseinanderzudröseln: Hat sich derjenige gekränkt, verängstigt in die virtuelle Welt zurückgezogen? Oder war die reale Welt so unattraktiv und ist so wenig genutzt worden, weil das Computerspiel immer zuerst da war?“
Positives Potenzial von Spielen
Häufiges Computerspielen verändert das Gehirn, beeinflusst Verhalten, motorische Fähigkeiten und Wahrnehmung – darauf deuten inzwischen viele Studien hin. Es gibt Hinweise, zum Beispiel, auf eine geringere sprachliche Intelligenz und Impulskontrolle und auf eine schlechtere Verarbeitung sozialer Informationen. Aber: Es gibt ebenso Hinweise auf ein besseres Arbeitsgedächtnis bei Spielern, ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen und bessere Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen.
„Ich sehe immer, dass wir ständig dieselben Diskussionen führen. Wir reden über Gewalt in Spielen, wir reden eh grad wieder über Sucht in Spielen. Das sind sehr, sehr wichtige Themen klarerweise.“
Johanna Pirker. Assistenzprofessorin an der Technischen Universität Graz, Leiterin des Grazer Game-Labs, Gamerin, Spieleentwicklerin.
„Aber die Welt der Spiele ist irrsinnig, irrsinnig vielschichtig. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen Fokus auf das positive Potenzial von Spielen setzen und sie einfach auch für das, in Anführungszeichen, ‚Gute‘ verwenden. Es gibt extrem viele Spiele, die eine ganz kurze Erfahrung darstellen, oft ganz persönliche Erfahrungen. Zum Beispiel, wo ich in die Fußstapfen eines Flüchtlings treten kann oder wo ich die Welt aus den Augen einer Krebspatientin sehen kann. In einem Spiel bin ich mittendrin und muss selbst Entscheidungen treffen. Und das lehrt uns halt ganz anders.“
Die Öffentlichkeit nimmt es kaum wahr, sagt Johanna Pirker, aber: Mit den Spielerinnen und Spielern sind längst auch die Spiele erwachsen geworden.
„Ich finde erstens diese Technologien, dass ich tatsächlich dann in eine andere Haut schlüpfen kann, relativ spannend. Dass ich die Welt aus der Sicht Anderer leben kann. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele, sehr simple Mini-Mechaniken: Dass ich einfach kleine, spielerische Elemente nehme, die mich dazu motivieren, Sachen zu tun, die vielleicht sonst nicht ganz so lustig sind.“
Spiele-Mechanismen zum Lernen
Wie die Game-Psychologie unterschiedliche Spielertypen unterscheidet und versucht, sie im Spiel zu halten, mit Rankings etwa oder über kleine Belohnungen, so gibt es auch unterschiedliche Lerntypen, die mit Spiele-Mechanismen zum Lernen angehalten werden können.
„Ich habe selbst damals meine Diplomarbeit gamifiziert, hab so kleine Progress-Bars gemacht, dass ich immer sehe, wie stehe ich jetzt im Großen und Ganzen, hab mir kleine Tasks gesetzt – und da habe ich einfach gemerkt, dass mich das irrsinnig motiviert hat. Und das war dann der Bereich, den wir auch in unserer Lehre zum Beispiel versucht haben, einzusetzen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig: Wenn wir uns zu etwas motivieren wollen, gibt es unterschiedliche Wege, die wir vielleicht inspiriert aus der Spieledesign-Mechaniken-Welt verwenden können, um uns da weiterzuhelfen.“
Das menschliche Gehirn ist enorm plastisch; alles, was wir tun, hinterlässt dort Spuren. Und vielleicht werden Computerspiele unsere Gehirne langfristig mit Fähigkeiten ausstatten, die wir brauchen, um den zunehmend digitalen Alltag zu bewältigen. Erwachsene, die als Kinder viel Pokémon gespielt hatten etwa, zeigten im Hirnscan Veränderungen in einem Bereich, der wesentlich für die Erkennung von Objekten und Gesichtern zuständig ist. Ihr Gehirn hatte die Erkennung speziell von Pokémon-Figuren quasi hinzugefügt. Aber: Vielleicht sollten wir gar nicht fragen, ob, wie und welche Spiele uns kompatibler mit dem Alltag machen könnten und welche nicht. Sondern: Was muss passieren, damit unser Alltag viel öfter die Leichtigkeit eines Spiels bekommt? Und das in jedem Alter.
Es sprachen: Moses Leo und die Autorin
Regie: Friederike Wigger
Ton: Thomas Monnerjahn
Redaktion: Kim Kindermann