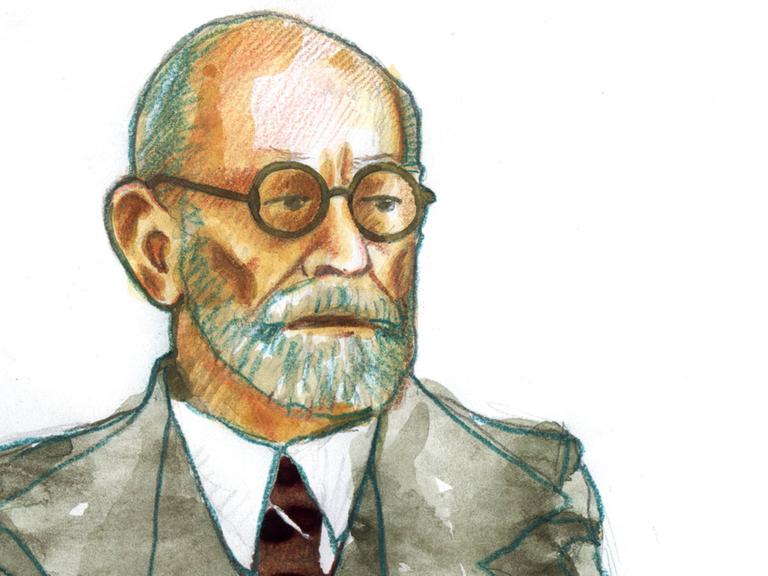Irvin D. Yalom: „Wie man wird, was man ist. Memoiren eines Psychotherapeuten“
Aus dem Englischen von Barbara von Bechtolsheim
btb München 2017
448 Seiten, 25 Euro
Über die Schwierigkeit, mit sich ins Reine zu kommen

Der Amerikaner Irvin Yalom ist einer der einflussreichsten Psychiater der Welt und ein erfolgreicher Autor. In „Wie man wird, was man ist“ schaut er zurück auf sein Leben – als Kind russischer Einwanderer, als jüdischer Student und als Psychiater, der seine Zunft nicht so ernst nimmt.
An den Anfang seiner Memoiren stellt Irvin Yalom einen Albtraum. Er ist in diesem Traum zwölf Jahre alt. Plump grüßt er das Nachbarskind Alice mit „Hallo Masern“, denn das Mädchen hat zeitlebens rote Flecken im Gesicht. Ein dummer Spruch, der sogleich geahndet wird. Alices´ Vater taucht auf, packt den Jungen, schreit ihn an. Ihm wird klar, er hat das Mädchen verletzt. Er erschrickt und erwacht. Diesen Albtraum erlebt Yalom, als er schon ein alter Mann ist. Dass plötzlich Schuld in ihm aufbricht, überrascht ihn – so viele Jahre nach der realen Begegnung mit Alice.
Selbstanalytisch, warmherzig und offen schaut der 86-Jährige auf sein Leben zurück. Der Amerikaner Irvin Yalom ist einer der einflussreichsten Psychiater der Welt, aber auch ein erfolgreicher Autor, ein Schreibtalent, das seit Jahren auch eine breite Leserschaft anzieht. Vier Romane hat er verfasst und drei Erzählbände, in denen er Leichtigkeit in die Schwere der Psychoanalyse bringt. Durch Alltagsgeschichten macht er sein Fach der Allgemeinheit zugänglich. Seine eigene erzählt er ebenso packend.
Wunsch, der jüdischen Kultur zu entfliehen
Chronologisch, in vierzig Kapiteln, rollt Irvin Yalom sein Leben auf. Die frühen Jahre in armen Verhältnissen als Kind russischer Einwanderer in Washington D.C.. Sein Wunsch, der jüdischen Kultur zu entfliehen. Der enorme Leistungsdruck, dem er sich aussetzt, weil nur fünf Prozent aller Plätze für ein Medizinstudium an Juden gehen dürfen. Die Liebe seines Lebens, Marilyn. Und natürlich die Suche nach der Richtung in der Psychotherapie, die seinen Neigungen am ehesten entspricht.
Yalom zeigt sich in diesen Geschichten immer als nahbarer Mensch, mit dem man sich identifizieren kann. Als Kind ist er zugeknöpft, er leidet, fühlt sich einsam. Selbstzweifel plagen ihn, und er sehnt sich danach, dass seine Fähigkeiten erkannt werden. Mit klarem Blick und ohne jede Larmoyanz arbeitet er sich an den Autoritäten seines Lebens ab. Etwa an der Mutter, die ihn als Störenfried empfindet. Oder später, an den Koryphäen der Psychotherapie – Victor Frankl, Bruno Hettelheim oder Rollo May. Diese Begegnungen machen seine Memoiren zu einem Dokument der Zeitgeschichte. Die Anekdoten faszinieren aber auch, weil er sich selbst und die Zunft der Psychiater vom Sockel holt. Dadurch wird auch für den Laien verständlich, warum er für sich die Gruppentherapie gewählt hat. Er hält sie schlicht für die wirksamste Arbeitsmethode.
Irritationen zum Schluss
Über all dem schwebt immer der Wunsch nach Versöhnung. Irvin Yalom will das Einzigartige seiner Mitmenschen herausstellen und gleichzeitig mit sich selbst ins Reine kommen. Das überzeugt zwar und ist sehr lesenswert. Dennoch endet das Buch düster. Denn immer wieder bedauert er, sich über vieles in seinen Beziehungen nicht schon früher im Klaren gewesen zu sein. Etwa wie sehr er das Nachbarmädchen Alice tatsächlich gekränkt hat. Oder dass seine Mutter ihn doch geliebt hat, trotz aller Konflikte. Vor allem aber hadert er massiv mit dem Altwerden. Das irritiert, angesichts eines so erfüllten Lebens. Denn einem ganz Großen wie Irvin Yalom hätte man am Ende doch mehr Zufriedenheit zugetraut.