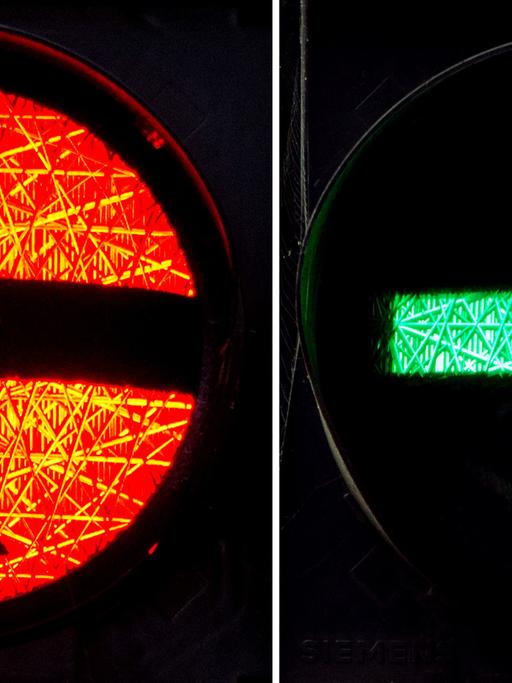Politischer Kompromiss - Tugend oder Laster?
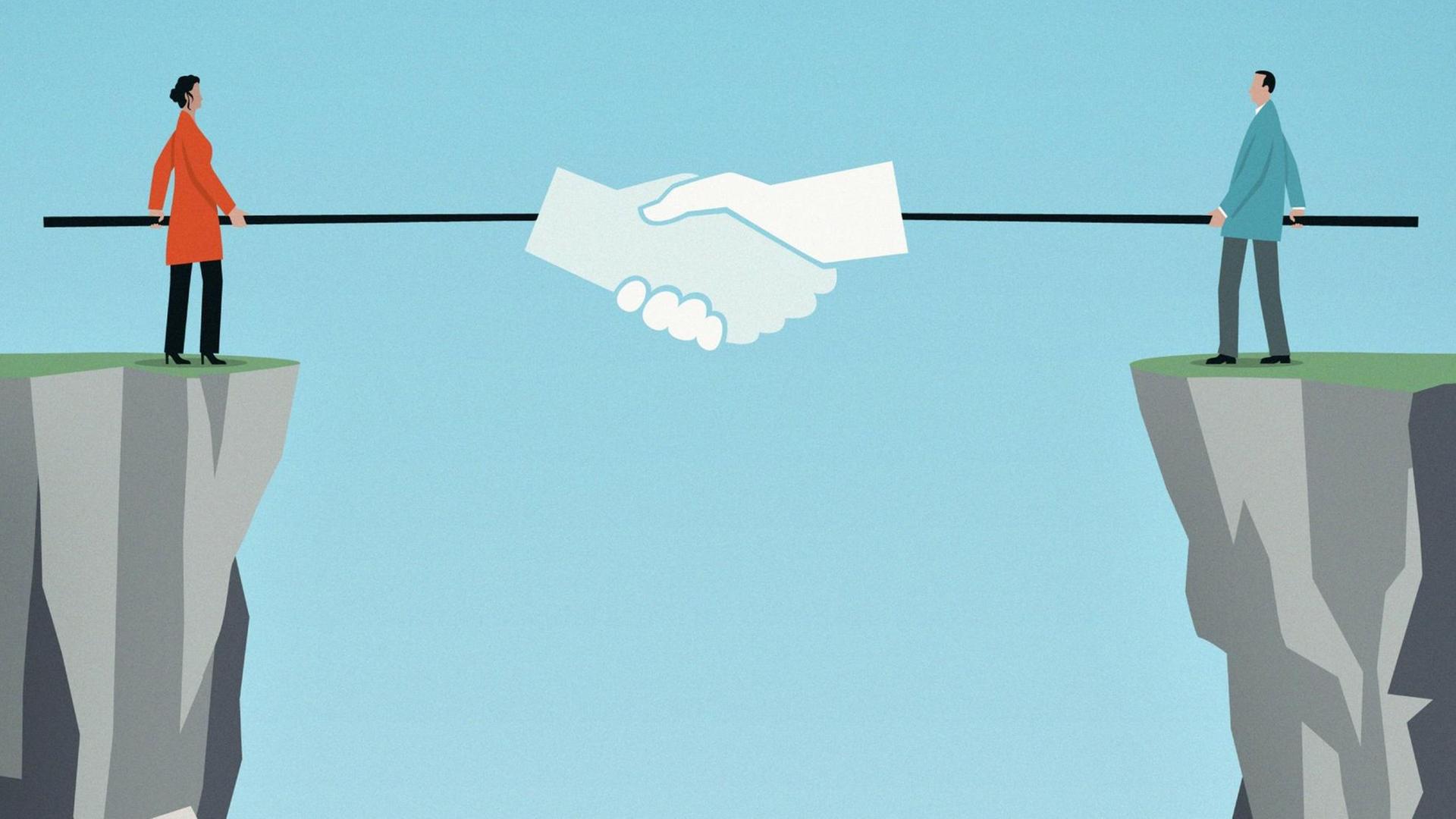
Die "Jamaika"-Koalitionäre sollten flexibel und kompromissfähig sein, fordern einige. Doch politische Flexibilität straft der Wähler oft schnell als "faulen Kompromiss" ab. Was ist nun wünschenswert? Eine tugendethische Betrachtung des Philosophen Arnd Pollmann.
Die Bremer Stadtmusikanten können davon ein Lied singen: Vier Parteien, jeweils leicht altersschwach, von Armut bedroht und alleine machtlos, werden durch das Schicksal zu einer schlagkräftigen Koalition zusammengeschweißt. Da muss vorab nicht nur sondiert und – dem Gewicht nach – sortiert werden. Die vier Parteien werden jeweils auch Abstriche, d.h. Kompromisse, machen müssen. Als Hahn, Katze, Hund und Esel am Ende realisieren, dass das ersehnte Musikerleben in der Stadt für immer eine Utopie bleiben wird, machen sie auf halber Strecke halt und begnügen sich damit, ein Haus zu überfallen, um es sich darin fortan bequem zu machen.
Die goldene Mitte oder rückratlose Kompromittierung?
Mit diesem märchenhaften Kompromiss wird zunächst das Wesen aller Kompromisse offenbar: Wann immer widerstreitende Absichten nicht zugleich realisiert werden können, mag die Suche nach der "goldenen Mitte" die vernünftigste Lösung sein. Zugleich liegt aber aus realpolitischer Sicht eine damit schwer verträgliche Wahrheit auf dem Tisch. Um es mit Max Weber zu sagen: Wer politische Kompromisse machen muss, ist selbst zu schwach, zu macht- und chancenlos, "den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen". Und oft sehnt sich die Wählerschaft eben doch nach einer entsprechenden Dominanz und Durchsetzungskraft.

Kompromissfähigkeit als Tugend oder Laster? Die Sondierungsgespräche erweisen sich als zäh.© dpa-Bildfunk / Michael Kappeler
Betrachten wir diesen Widerspruch erst einmal tugendethisch: Die »Kompromissfähigkeit« einer Person wird ebenso oft als ein vorbildlicher Charakterzug gepriesen wie die »Kompromisslosigkeit« einer anderen. Je nach Sichtweise haben wir es also mal mit einer Tugend, mal mit einem Laster zu tun. Wer Kompromissfähigkeit vermissen lässt, scheint für die Politik, wie für das Leben überhaupt, ungeeignet. Wer hingegen ständig Kompromisse macht, unentwegt »einknickt« und sich folglich niemals kompromisslos zeigt, ist ein Opportunist – ohne Willensstärke und Rückgrat. Der Weg vom Kompromiss zur Kompromittierung des eigenen Charakters ist gelegentlich nicht weit.
Der faule Kompromiss verstetigt die Probleme
In der repräsentativen Demokratie nimmt dieser Widerspruch die Gestalt einer unerfüllbaren Erwartungshaltung an: "Nun rauft euch mal zusammen, macht eine Koalition. Aber verbiegt euch dabei bloß nicht so, dass man euer Profil gar nicht mehr wiedererkennt!". Schmerzhafte Kompromisse mögen zur Politik dazugehören. Gelegentlich wird die Politik gar definiert als eine Kunst des "Dissensmanagements". Aber selbst wenn politische spin doctors in der Tradition von Niccolò Machiavelli dem Personal eine gewisse Flexibilität des Rückgrats anempfehlen, so wird dies von der Wählerschaft fast immer verachtet.
Der Kompromiss, der "faule" zumal, stellt den kalten Krieg auf Dauer. Sicher, solange kein echter Konsens möglich scheint, kann der Kompromiss unerträglich lange Diskussionen abwürgen, Ressourcen sparen, Stillstand verhindern. Aber nicht selten haben Kompromisse lediglich eine aufschiebende Wirkung. Die Probleme werden nicht ausdiskutiert, Gräben künstlich zugeschüttet, Wirbelsäulen gedehnt und Wählerschaften verprellt. Mit John Rawls gesprochen: Hier schlägt das reasonable disagreement in ein unreasonable agreement um.
Programmatischer Opportunismus verdirbt den klugen Kompromiss
Es ist also auf ganz fundamentale Weise widersprüchlich, was die Wählerschaft von potenziellen Koalitionären erwartet. Man könnte dies den Wählern selbst vorwerfen, doch das Problem ist hausgemacht. Die derzeit sondierenden Stadtmusikanten haben vorab bewusst auf einen Lagerwahlkampf mit klaren Frontlinien verzichtet. Sie haben sich aus machtpolitischen und demoskopischen Erwägungen fast alle Koalitions-Optionen offen gehalten. Und genau diese Flatterhaftigkeit fällt ihnen nun auf die Füße. Wer sich im Vorfeld auf derart promiskuitive Weise paarungswillig zeigt, braucht sich hinterher nicht wundern, wenn viele nun die monogame Gesinnung vermissen. Eben das ist dann auch die entscheidende Moral von der Geschicht‘: Wer sich von Anfang an für einen gradlinigen Kurs entscheidet, muss hinterher nicht so viel schlingern.