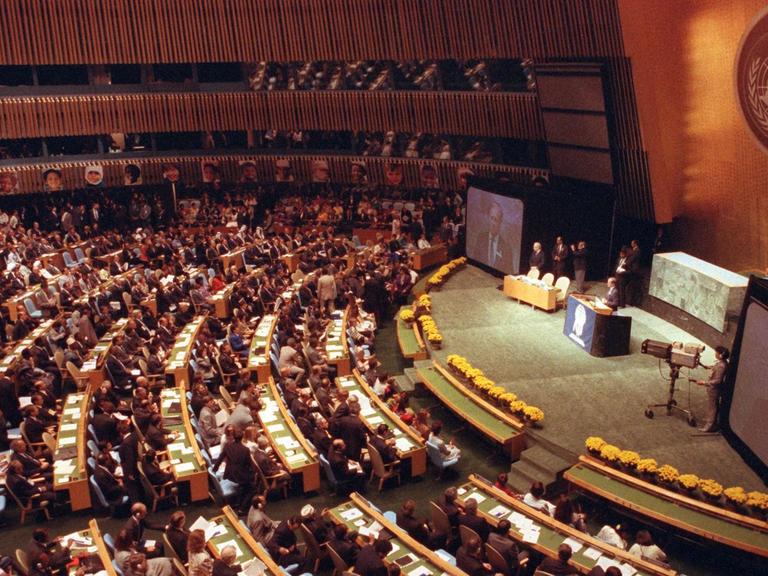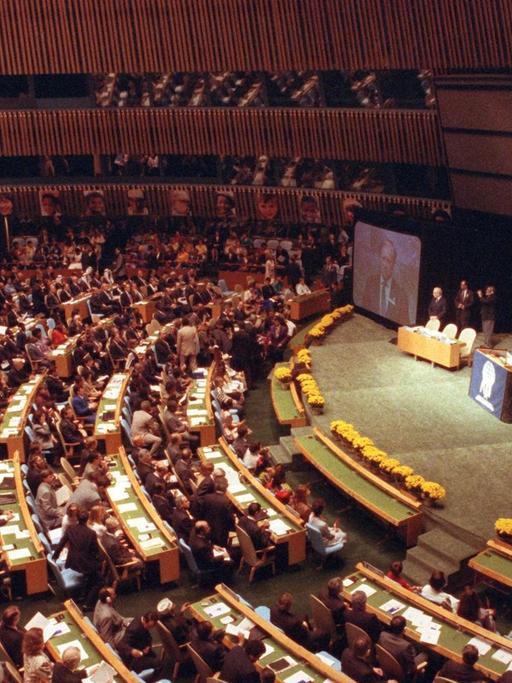Prekäre Kindheit in einer Leistungsgesellschaft

Japan gehört zwar zu den reichsten Industrienationen der Welt, für arme Familien aber hatte es bisher wenig übrig. Dabei lebt jedes sechste Kind in Armut - und es werden immer mehr.
Im Schnelltempo schreibt Hajime Schriftzeichen in sein Schulheft. Einmal in der Woche kommt der Elfjährige zu der japanischen Hilfsorganisation Wakuwaku.
"Meine Mutter hat kein Geld für die Nachschule. Und wir haben gehört, hier ist es kostenlos. Ja, und deshalb bin ich jetzt hier und lerne."
Zur Nachschule gehen fast alle japanischen Schulkinder, denn nur so können sie den vielen Lernstoff bewältigen.
"Ich bin seit vergangenem Sommer dabei, und wenn es diesen Ort hier nicht mehr geben würde, würde mir wirklich etwas fehlen. Ich wäre sehr traurig."
Denn bei Wakuwaku, was so viel bedeutet wie "begeistert sein", lernt Hajime nicht nur, sondern die Freiwilligen – meist Studierende und Rentner – gehen mit ihnen auch auf den Spielplatz und bieten Abendessen für Kinder und Eltern an.
Hajimes Mutter gehört zu der besonders prekären Gruppe der Alleinerziehenden. Jede zweite von ihnen ist arm. Die Mutter arbeite von früh bis spät. Zu Hause sei sie immer gestresst, sagt der Elfjährige. Seine größten Wünsche sind im Grunde ganz kleine:
"Ich würde gern mal ins Restaurant oder ins Schwimmbad gehen."
Chieko Kuribayashi hat Wakuwaku vor zwölf Jahren gegründet, erst seit kurzem zahlt die Stadt die Räumlichkeiten, der meiste Teil aber wird aus Spenden finanziert.
"Wir setzen uns für mehr Chancengleichheit ein. Kinder sollen hier nicht nur lernen, sondern vor allem mehr Selbstbewusstsein bekommen. Wir wollen ihnen Mut machen, dass sie im Leben bestehen können."
In der japanischen Leistungsgesellschaft würden gerade diese Kinder denken, sie seien nichts wert, könnten es zu nichts bringen, sagt die Sozialwissenschaftlerin Aya Abe.
"Familien versuchen ihre Armut zu verbergen, sie schämen sich dafür, man gilt als Versager, als einer, der es nicht geschafft hat. Und die Leute geben sich auch tatsächlich selbst die Schuld für ihre Armut."
16 Prozent der Kinder sind arm
Erst seit zwei Jahren gibt es in Japan ein Gesetz zur Bekämpfung der Kinderarmut, dabei steigen die Zahlen seit Jahren. War in den 80er-Jahren noch jedes zehnte Kind arm, seien es jetzt schon mehr als 16 Prozent, so Aya Abe:
"Die Regierung hat zwar ein Gesetz erlassen, ja, aber sie erkennt den Ernst der Lage nicht. Wenn jedes sechste Kind arm ist, bedarf es einer enormen Kraftanstrengung und vieler Investitionen, um diese Kinder und Jugendlichen so auszubilden, dass sie zur Produktivität unseres Landes beitragen."
Nur zwei Prozent der Bevölkerung bekämen staatliche Hilfen und die seien sehr gering. Ebenso wie das Kindergeld.
Wie schwer es gerade Alleinerziehende haben, wird bei der Organisation Wakuwaku an einem anderen Abend deutlich. In einer kleinen Straße in einem eher ärmlichen Stadtteil Tokios duftet es schon von weitem nach gebratenem Fleisch
Kazuo Yamada öffnet den Ofen, um ihn herum wuseln ein Dutzend Freiwillige, schnippeln und richten an:
"Heute gibt es einen Gemüsekuchen aus Broccoli, Kartoffeln und Mohrrüben. Dazu eine Kürbissuppe und gegrilltes Hähnchen."
Und als Nachtisch für jeden ein kleines Stück Kuchen und eine als Weihnachtsmann dekorierte Erdbeere. Als der Rentner vor zwei Jahren seine Frau verloren hat, schloss er sich der Hilfsorganisation an. Seitdem öffnet er zwei Mal im Monat sein Haus für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern.

Als Weihnachtsmann dekorierte Erdbeeren, aufgenommen in einer Hilfsorganisation für arme Familien in Japan© Deutschlandradio / Kathrin Erdmann
Für etwa zwei Euro können sich alle satt essen. Mio ist heute mit einem ihrer vier Kinder dabei:
"Mein Ex-Mann unterstützt mich finanziell überhaupt nicht. Und von der Stadt bekomme ich 20.000 Yen Kindergeld im Monat."
Das sind umgerechnet etwa 150 Euro. Während des Gesprächs lässt sie – wie viele Japaner – ihren Mundschutz an. Die Verkäuferin will nicht krank werden.
"Wir leben jetzt zu fünft in einer sehr teuren Zwei-Zimmer Wohnung, ich wünschte, wir hätten mehr Platz, aber das kann ich mir nicht leisten. Deshalb wünsche ich mir manchmal, die Kinder würden nicht größer werden."
Für mehr Chancengleichheit setzt sich auch der Jurastudent Ryohei Takahashi ein. Der 23-Jährige zeigt ein Foto auf seinem Smartphone:
"Das hier ist ein Foto von uns nachdem wir auf der Straße Geld für arme Kinder gesammelt haben."
Gute Ausbildung kostet privates Geld
Erst vor wenigen Tagen haben sie wieder Spenden gesammelt, dieses Mal für Studierende aus weniger wohlhabenden Familien. Royheis Engagement kommt nicht von ungefähr. Sein Vater nahm sich das Leben, als er in der siebten Klasse war. Ein Tabu in der japanischen Gesellschaft – und das bedeutete zugleich das Abrutschen in die Insolvenz.
Studieren kann er nur dank zweier Darlehen. Das Geld ist aber nur geliehen.
"Ich werde 20 Jahre lang jeden Monat 30.000 Yen zurückzahlen müssen."
Also umgerechnet rund 200 Euro. Nebenbei hat er mehrere Jobs, unter anderem reinigt er Klimaanlagen – eine schmutzige Arbeit, die viele nicht machen würden.
Mit viel Fleiß und Engagement wird Ryohei vielleicht eines Tages Anwalt oder Richter werden und dann ein anderes Leben führen. Doch das schaffen in Japan nur ganz wenige aus armen Familien, glaubt er:
"Wer eine gute Ausbildung will, muss privat zahlen. Das ist eine enorme Belastung für die Familien und heißt im Umkehrschluss: Wer sich das nicht leisten kann, bekommt keine gute Ausbildung. Alles hängt also von der wirtschaftlichen Situation der Eltern ab."