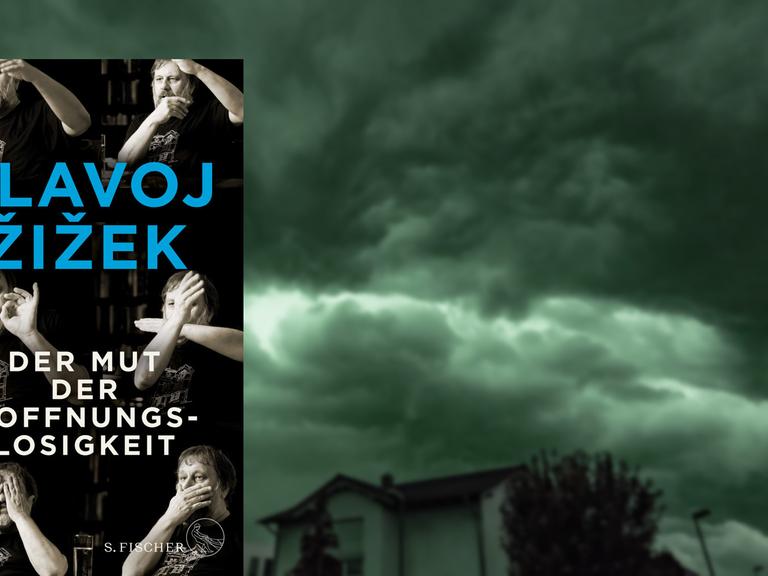Johannes Richardt (Hg.): Die sortierte Gesellschaft. Zur Kritik der Identitätspolitik
Novo Argumente Verlag, Frankfurt/Main 2018
194 Seiten, 16,00 Euro
Die Fallstricke der Identitätspolitik

Behindert der Fokus auf marginalisierte Gruppen die Solidarität in der Gesellschaft? In "Die sortierte Gesellschaft" üben linke bis konservative Autoren Kritik an einer übertriebenen Identitätspolitik - auch ein Lieblingsthema der Neuen Rechten.
Es ist seit Jahren offenkundig: Linke und Linksliberale stecken in der Krise. Sie haben nicht nur in Deutschland die Diskurs-Hoheit verloren. Sie konkurrieren zunehmend erfolglos mit neuen rechten Bewegungen und Parteien, ihre politische Gestaltungskraft erodiert. Eine Ursache für die Malaise, so heißt es oft, sei die Fixierung auf Identitätspolitik, also auf die Ermächtigung marginalisierter Gruppen, die vor Diskriminierung geschützt, gesellschaftlich anerkannt und zu einer positiven Selbstbestimmung befähigt werden sollen.
Der Band "Die sortierte Gesellschaft. Zur Kritik der Identitätspolitik" vertieft diese These. Die Autoren, politisch selbst zwischen links und konservativ beheimatet, rechnen teils polemisch mit linken Vorlieben für Anders-Sein, Opfer-Denken und die entsprechende Moralisierung der Politik ab. Der Reiz liegt darin, dass sich ihre Kritik fernzuhalten sucht von den Argumenten der Neuen Rechten, die ihrerseits den Linksliberalismus anfeindet. Das gerät bisweilen zur Gratwanderung.
Verschobener Fokus
Für den britischen Soziologen Frank Furedi beginnt die moderne Verehrung kultureller Identität mit Johann Gottfried Herder (1744-1803), der jedem Volk einen eigenen Geist zuschrieb. Furedi zeigt, wie es etwa die Betonung einer schwarzen Identität durch die US-Bürgerrechtsbewegung der Linken erschwerte, an einem umfassenden Solidaritätsgedanken festzuhalten. Deshalb sei ihr Fokus von der Klasse zur Identität gewandert. Ein Argument, das oft auftaucht und pointiert lautet: Übertriebene Identitätspolitik verrät das universalistische Denken der Aufklärung, führt zu fragwürdigem Anti-Individualismus und beschädigt trotzdem den Gemeinsinn, weil sie die Bedürftigen nicht mehr als soziale Klasse erkennt.
Der Soziologe Mark Lilla behauptet sogar, dass es viele US-Demokraten aufgrund ihrer "subjektivierten Politik" gar nicht mehr kümmert, "ob sie die Wahlen gewinnen" - solange nur "Selbstentfaltung, Selbstbehauptung und Selbstfindung" nicht zu kurz kommen. Der Journalist Tim Black bringt die Entwicklung auf die Formel "Kultur ersetzt Politik" und beklagt, dass die Politisierung von (unpolitischen) Lebensstilen das öffentliche Leben vergiftet. Wie bizarr das enden kann, zeigt der "TAZ"-Redakteur Jan Feddersen, der die politische Karriere der Chiffre "LGBTI*QA" untersucht. Der Philosoph Robert Pfaller hält Identitätspolitik schlicht für den Motor der "neoliberalen Erzeugung von Ungleichheit".
Kritik am Multikulturalismus
Den Beiträgen fehlt manchmal Tiefe, selten Schärfe. Multikulturalismus, ein altes linksliberales Steckenpferd, sei "eine Form kultureller Apartheit", wettert der in der Karibik geborene Philosoph Jason D. Hill. Seine Begründung: Multikulturalismus lege die Menschen auf klar unterscheidbare Gruppenzugehörigkeit fest, während sie in Wirklichkeit ein unentwirrbares Mischprodukt diverser Subkulturen seien. Und die europäische Identität? Ist laut Thilo Spahn ein elitäres EU-Projekt, das den wichtigsten Erfolg des Nationalstaats unterminiert: die Demokratie.
Keine Frage, viele Autoren behandeln Lieblingsthemen der Neuen Rechten. Die meisten tun es jenseits des Lager-Denkens im Duktus aufklärerischer Kritik. Von den Erfolgen der Identitätspolitik ist nirgends die Rede. Wurde sie für Linke und Linksliberale wirklich zur Falle? Der Band lässt wenig Raum für Zweifel.