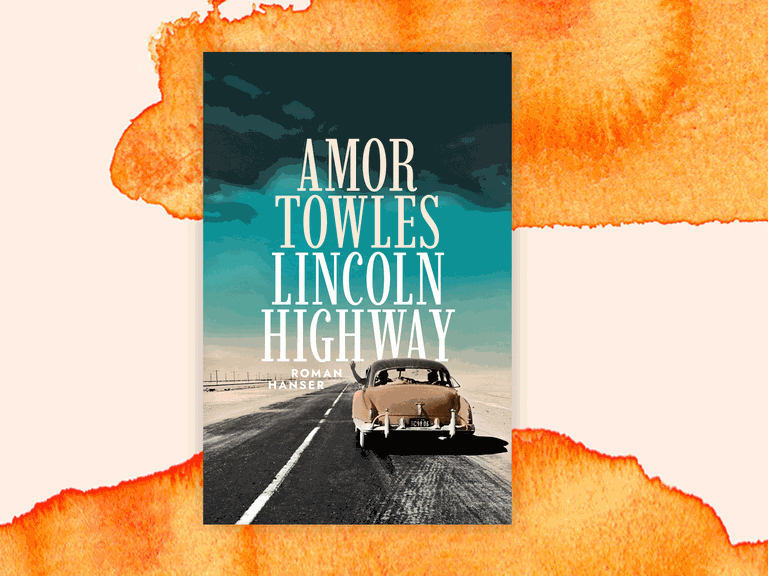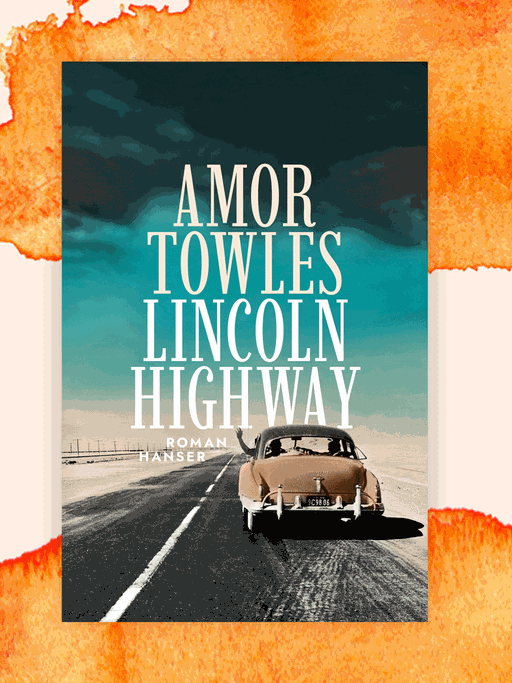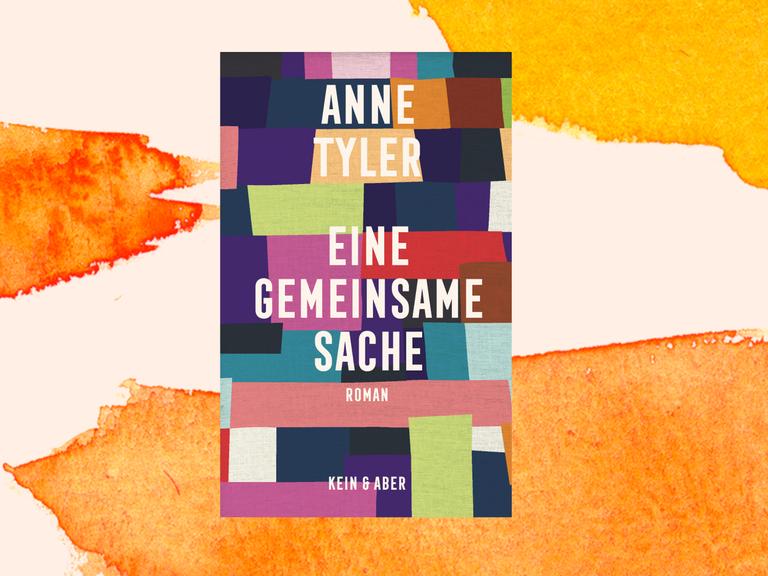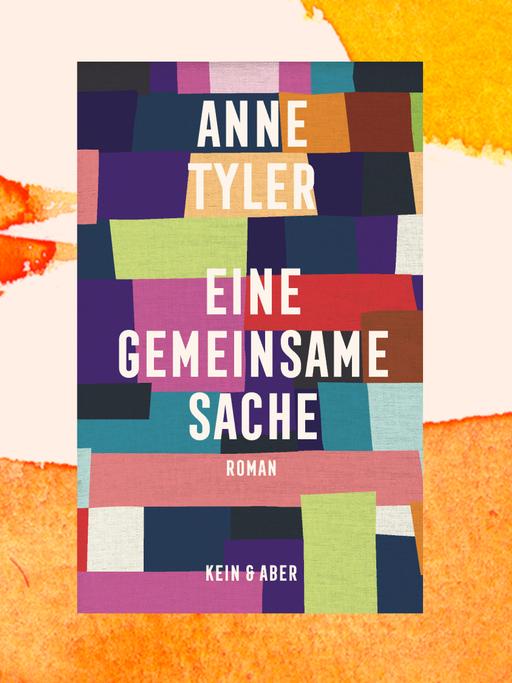John Jeremiah Sullivan: "Vollblutpferde"
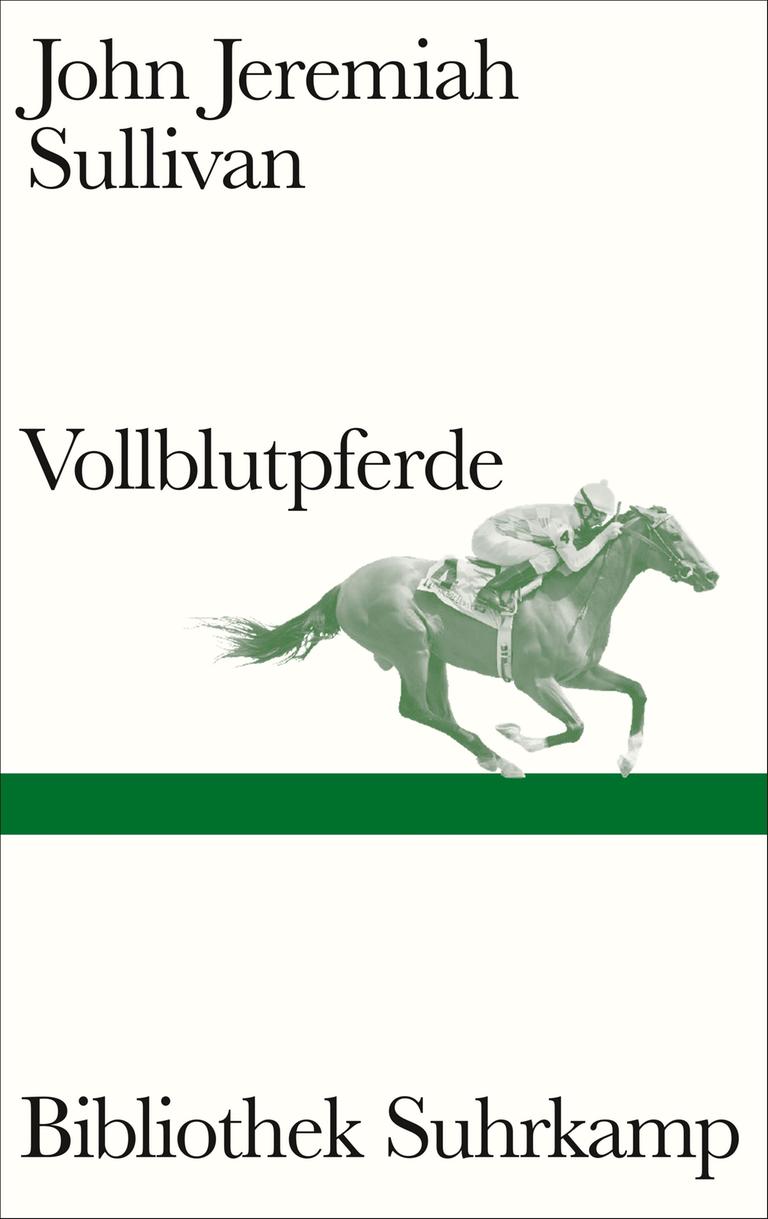
© Suhrkamp
Das Glück der Erde
05:08 Minuten
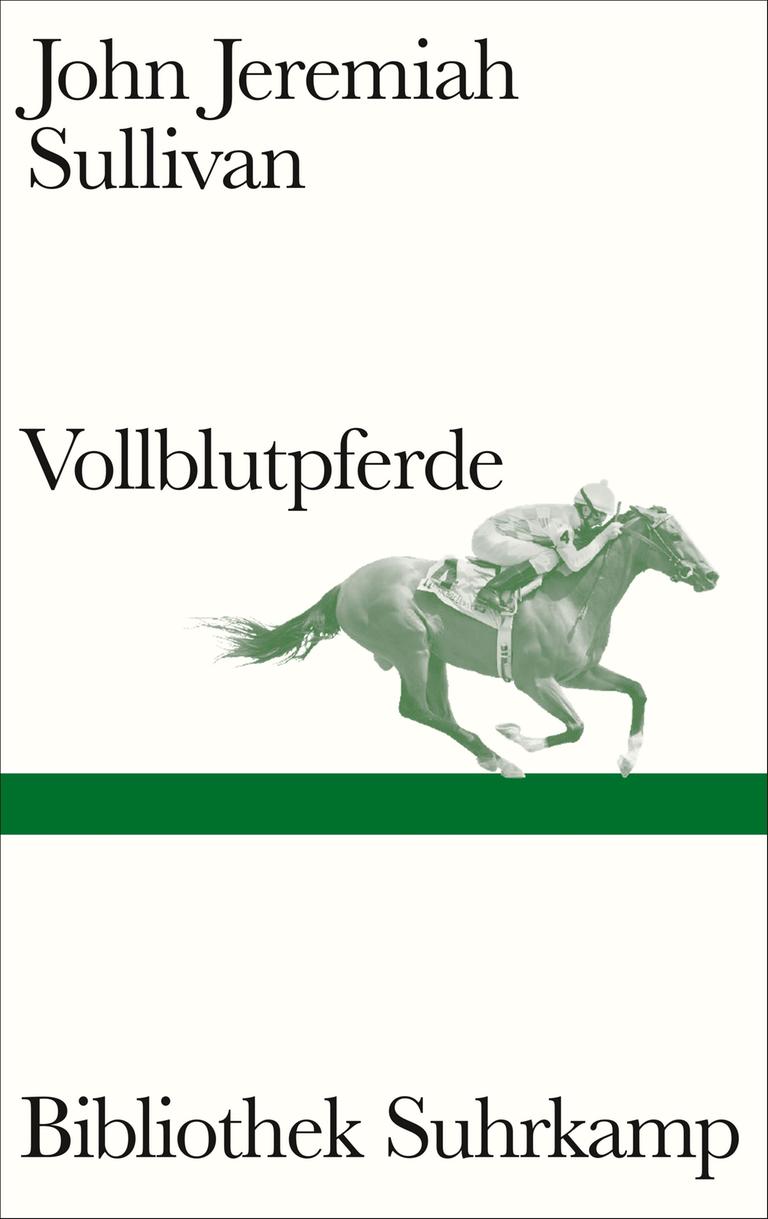
John Jeremiah Sullivan
Üersetzt von Hannes Meyer
VollblutpferdeSuhrkamp, Berlin 2022272 Seiten
24,00 Euro
John Jeremiah Sullivans Langreportage blickt hinter die Kulissen des Abermillionengeschäfts Pferderennen in den USA. Zugleich ist sie eine humorvolle Hommage an den verstorbenen Vater des Autors, einen Lebemann und enthusiastischen Sportjournalisten.
Als der Sportsender ESPN eine Liste der größten nordamerikanischen Athleten des vergangenen Jahrhunderts zusammenstellte, landete auf Platz 35 ein Pferd: Secretariat, ein kastanienbrauner Vollbluthengst, der 1973 das Triple der wichtigsten Pferderennen in den USA gewann und dabei auf jeder Bahn einen bis heute gültigen Rekord aufstellte.
An das letzte dieser Rennen erinnerte sich der Sportreporter Mike Sullivan noch Jahrzehnte später als eindrucksvollstes Erlebnis seiner gesamten Karriere. Nichts als Schönheit habe er damals im Lauf des Champions erblickt, berichtete er seinem Sohn auf dem Krankenbett, das kurz darauf zu seiner Todesstätte wurde.
Eigenartige Welt des Pferderennsports
Zum Gedenken an den Vater hat eben dieser Sohn, der hervorragende Essayist John Jeremiah Sullivan, sich darangemacht, die Faszination am Pferderennsport zu durchdringen. Kenntnisreich beschreibt er in „Vollblutpferde“ die Hintergründe des lukrativen Geschäfts mit den Rennpferden, wozu er in manchem Kapitel auch kulturgeschichtlich weit ausholt.
Den roten Faden bilden die Vor-Ort-Recherchen, die Sullivan auf Gestüte und zu Auktionen führten, wo Pferde für Unsummen ihre schwerreichen Besitzer wechseln.
Mit der Zeit bemerkte Sullivan, wie unnahbar und seltsam unbeteiligt die Tiere in allem Trubel stets wirken. Jeder Versuch, sich ihnen schreibend anzunähern, führt über jene, die sie züchten, auf sie wetten oder sie einfach nur anhimmeln – über Menschen wie sein Vater.
Lebemann der alten Schule
Dieser war offenkundig ein humorvoller Mann, der zum Spaß ganze Tage lang nur in Bob Dylan-Zitaten kommunizierte oder zeitlebens eine Fotografie des pubertierenden Sohnes mit nach hinten geglätteten Haaren, Zahnlücke und Tarnfarbenbarett bei sich trug, weil ein Blick darauf ihn auch an schlechteren Tagen erheiterte.
Allerdings hatte er auch eine dunkle Ader, aß schrecklich ungesund und trank und rauchte maßlos. Die Familie ist gegen seinen Lebenswandel machtlos, John Jeremiahs Mutter lässt sich schließlich scheiden, der Vater stirbt mit Mitte 60.
Sullivan erzählt diese Geschichte episodenhaft und sucht seinen Zugang häufig über scherzhafte Anekdoten. Eine Tragödie hat er nicht verfasst, den Vater portraitiert er stattdessen, wie er ihn in Erinnerung behalten will: gescheitert zwar an einstigen schriftstellerischen Ambitionen, im schlechtesten Sinne sorglos, aber auch aufrecht, freudvoll und gut, und empfänglich für die Anmut, die ihm der Lauf eines Pferdes offenbaren konnte.
Hommage an Heimat und Vater
Für den Sohn sind die Pferde der Schlüssel zu einem besseren Verständnis seines Vaters und auch der Heimat, dem pferdevernarrten Kentucky. Wechselseitig wächst aber auch die eigene Hochachtung vor den Tieren, des Vaters Verehrung für den legendären Secretariat weiß Sullivan bald nachzuvollziehen.
Die verkommene Dekadenz der Pferderennbranche bleibt ihm zwar ebenso wenig verborgen wie ihre tierethischen Schattenseiten, doch ist Sullivan ein Autor, der Missstände lieber aufzeigt, als über sie zu urteilen. So ist „Vollblutpferde“ eine Hommage im doppelten Sinne: an das besondere Verhältnis zwischen Mensch und Pferd und nicht zuletzt an seinen Vater, dem er mit diesem Buch auch ein Denkmal setzt.