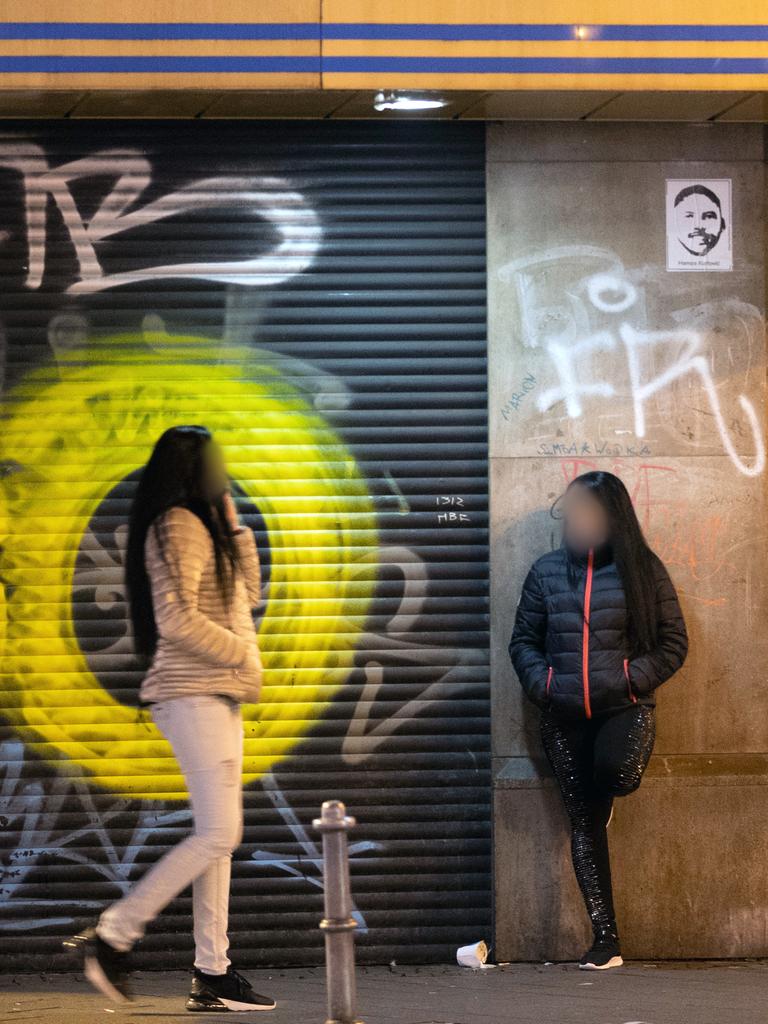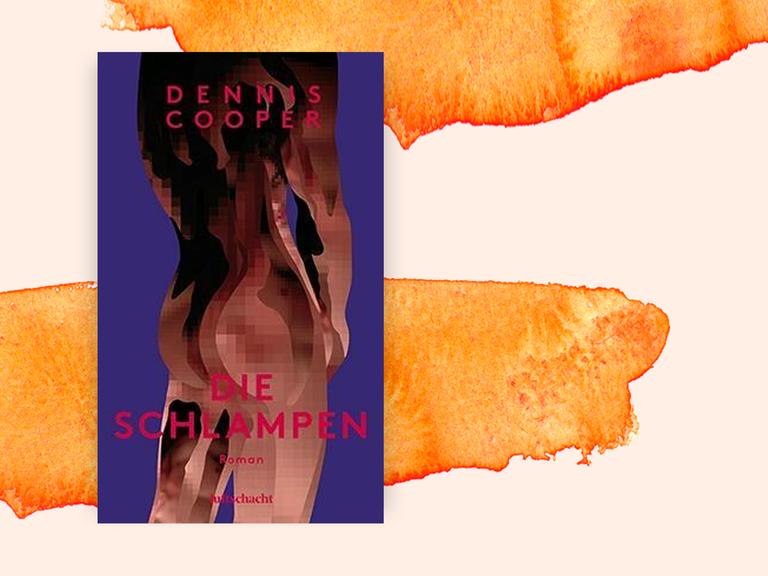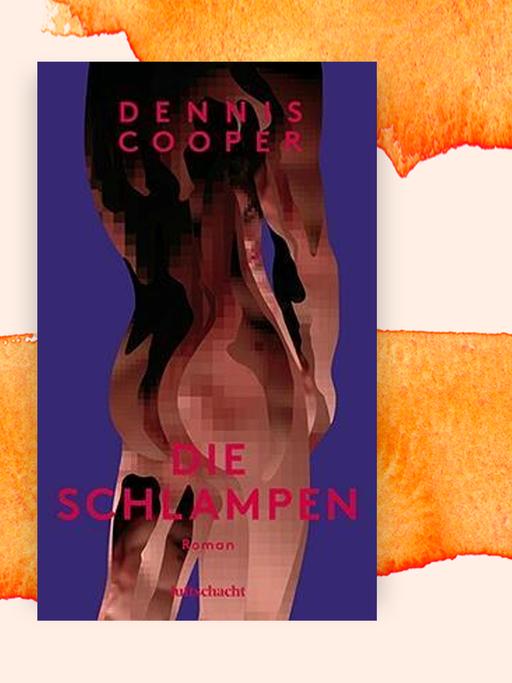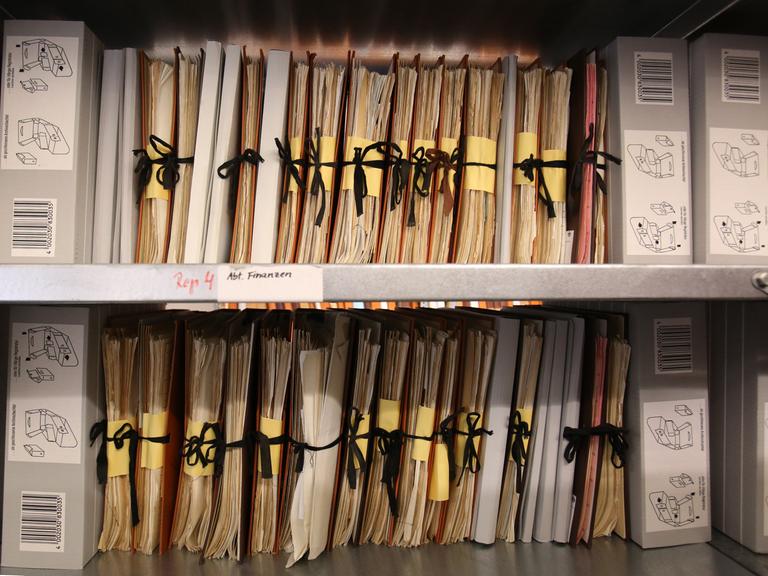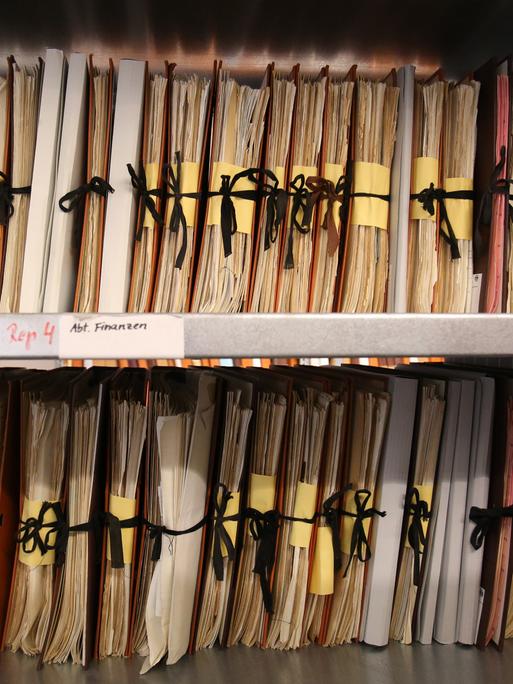Meine Schönheit […], das hatte ich in LA schmerzlich lernen müssen, war eine sehr glatte und berechenbare Schönheit, die zwar selten war, aber nicht selten genug. Wenn ich meinen Körper also zu Geld machen wollte, musste ich mich zwangsläufig mit den schmutzigeren Jobs abfinden, denn abgesehen vom Modeling hatte ich keine besonderen Skills, und Lohnarbeit kam nicht infrage, sie war der neunte Höllenkreis, war die Kloake, die einen jeden Morgen verschlang und zum Feierabend als halb verdauten Elendsklumpen wieder ausschiss.
Jonas Theresia: „Toyboy“
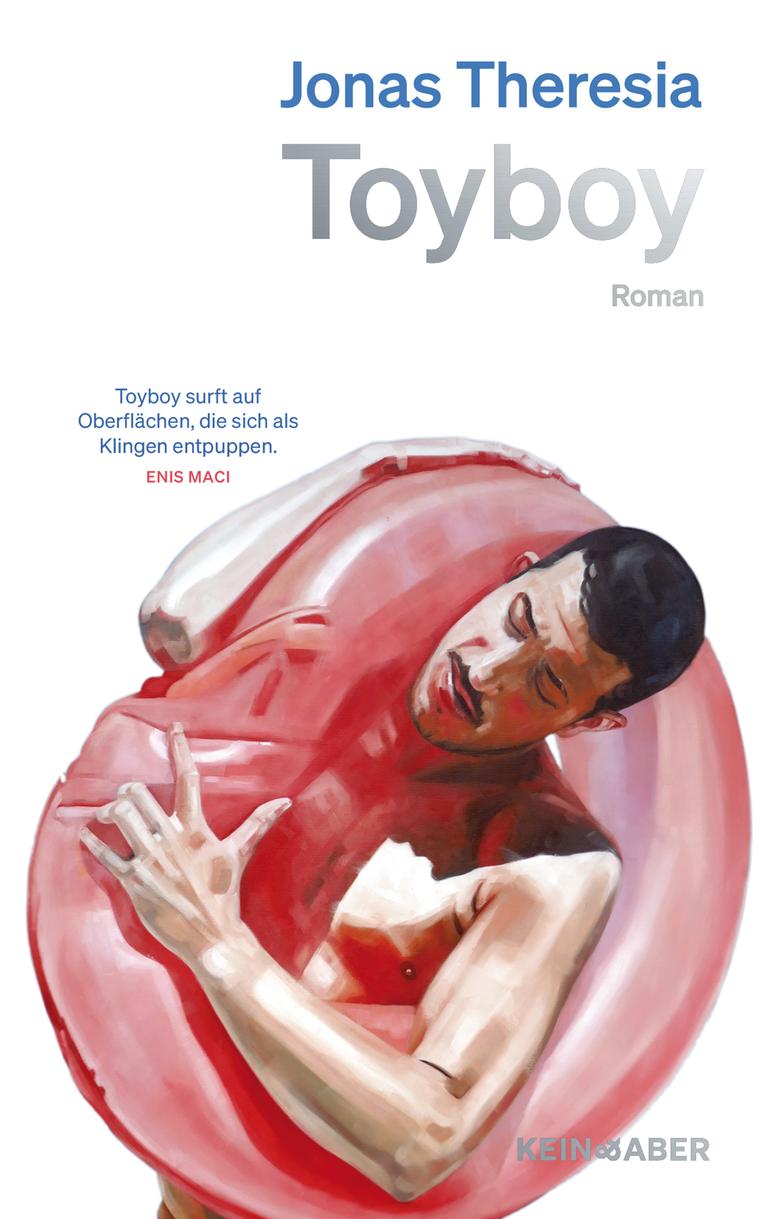
© Verlag Kein & Aber
Ein Callboy als Seismograf unserer Welt
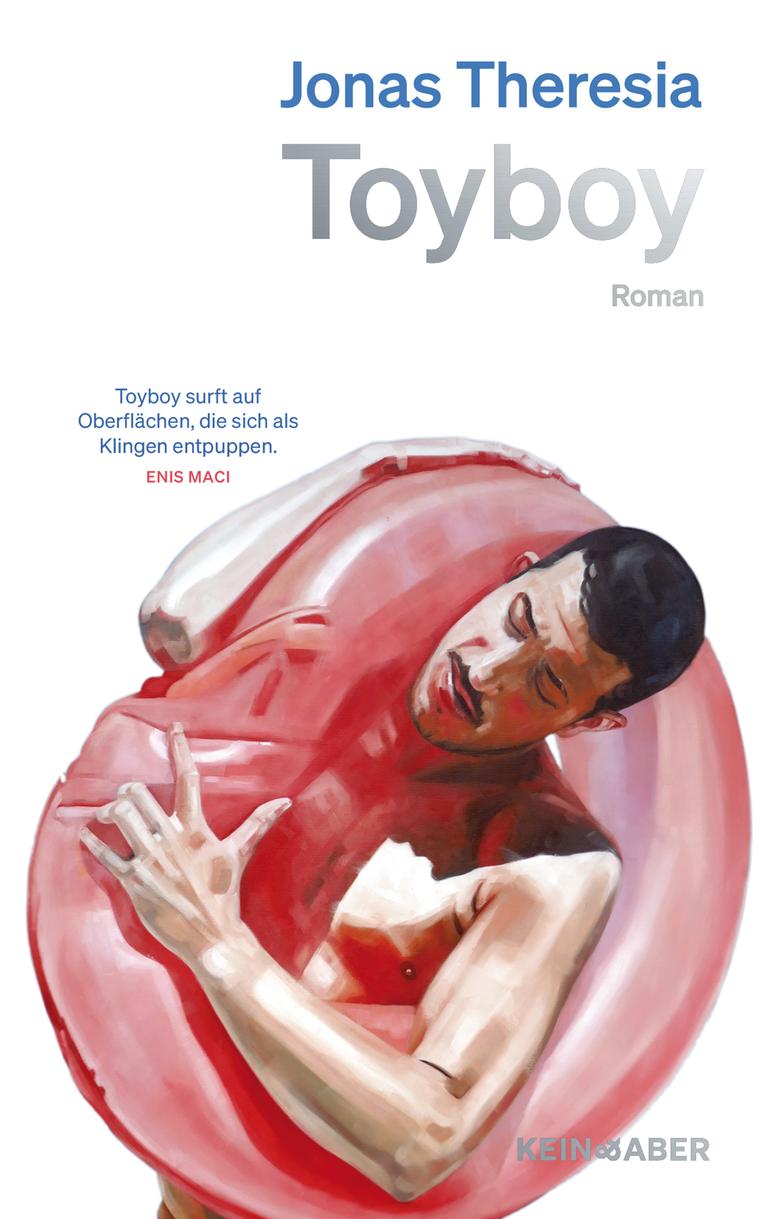
Jonas Theresia
ToyboyKein & Aber, Zürich 2025224 Seiten
23,00 Euro
Jonas Theresia erzählt in seinem Roman „Toyboy“ vordergründig von einem jungen Mann, der Sex gegen Geld hat. Eigentlich aber geht es dem Autor nicht um eine Milieustudie unter Callboys, sondern um die Suche nach Sinn und Sinnlichkeit in unserer Zeit.
Levin und Gregor sind in dem Alter, in dem man sein Leben anpacken sollte. Zwei Brüder, junge Erwachsene auf dem Sprung ins eigene Leben. Aber: Dort, wo Levin und Gregor herkommen, nimmt man sein Leben nicht in die Hand.
Sehnsüchte aber entstehen auch dort. Und Levin, der Ich-Erzähler des Romans, hat sich für seine Sehnsucht sogar aufgerafft, ist nach Kalifornien gezogen, hat zu hoffen gewagt, dort als Model Fuß zu fassen. Erklärt oder immerhin angekündigt hatte er diesen Schritt niemandem, plötzlich war er einfach weg. Und jetzt ist er wieder da.
Zwei Brüder, zwei Verlorene
Zu Hause beim kleinen Bruder, der zwischenzeitlich in Pubertät und Games, Weltschmerz und Pornos verloren gegangen ist und für Levin und dessen Enttäuschung keinen Blick hat:
Die Suche nach neuen Männerbildern
Levin ist nicht bloß auf der Suche nach Arbeit. Er hofft, über die Arbeit ein anderes, neues Modell von Männlichkeit zu entdecken. Vater und Großvater – das weiß er – hätten nicht verstanden, warum ehrliche Arbeit für ihn ein Tabu darstellt, nicht aber die „schmutzigeren Jobs“ – Abende als Escort an der Seite seines Jugendfreunds Momo oder Drehs von Pornofilmchen. Aber diese Männer, die ihr Leben selbst der Arbeit geopfert haben, können Levin kein Beispiel geben.
Es geht dem Autor Jonas Theresia also nur auf der ersten Ebene um den Alltag eines Mannes, der seinen Körper zu Geld macht. Es geht ihm – wie vor ihm Hermann Hesse, J.D. Salinger oder Paul Auster – um Verlorenheit und Identitätssuche eines jungen Mannes. Ein Thema, so alt wie die Romanform selbst, das Theresia vor dem Hintergrund unserer Lebens- und Arbeitswelt neu ausleuchtet.
Verwobenheit von Mensch und Maschine
Jonas Theresia legt mit seinem Debütroman einen großen Gegenwartsroman vor, der vorführt, wie wenig die Unterscheidung von virtueller und echter Welt noch greift. Selbst im Traum sieht sich Levin als Mensch, der Kamera und Publikum ausgesetzt ist. Und Gregor erzählt dem zurückgekehrten Bruder bald doch noch von seiner Ex-Freundin, die er nie „in real life“ getroffen und von der er sich gerade – dank einer von ChatGPT mitgeschriebenen Nachricht – getrennt habe.
Wie diese Präsenz von Virtualität und Technik menschliches Träumen und Fühlen verändert, das lotet Jonas Theresia in diesem Roman aus. Und ein Mann, dessen Leben um das Berühren und Berührtwerden kreist, um echte und gespielte Erregung, um die Aufmerksamkeit von Mensch und Kamera, so ein Mann ist der beste Erzähler, um sich diesen Fragen zu nähern.
Jonas Theresia schickt seinen Erzähler immer wieder in Situationen, in denen er realisiert, was er wirklich spürt – das Auge der Kamera zum Beispiel – und welche tatsächliche Berührung ihn nicht erreicht. Oder: Welche reale Erfahrung für ihn nur noch mit Bildern der Virtualität greifbar ist. Einmal zum Beispiel sitzt er einer Frau gegenüber, die – wie er – mit ihrem Körper Geld verdient. „I like you“ sagt sie. Und er? Sieht sie im Splitscreen vor sich, tausende Videos der immergleichen Geste: Ihre Hand auf dem Unterarm eines Mannes und der Mund spuckt diese Phrase aus: „I like you“, „I like you“, „I like you“.
Spätestens solche unverbrauchten Bilder machen klar, dass dieser Erzähler kein billiger Trick ist, um dem Roman den Anstrich des Wilden, Anrüchigen zu geben. Es ist ein kluger Schachzug, um Bilder und Denkfiguren zu testen, die von der Suche nach Identität in unserer Zeit erzählen können.