Auf der Suche nach Augenhöhe
09:45 Minuten
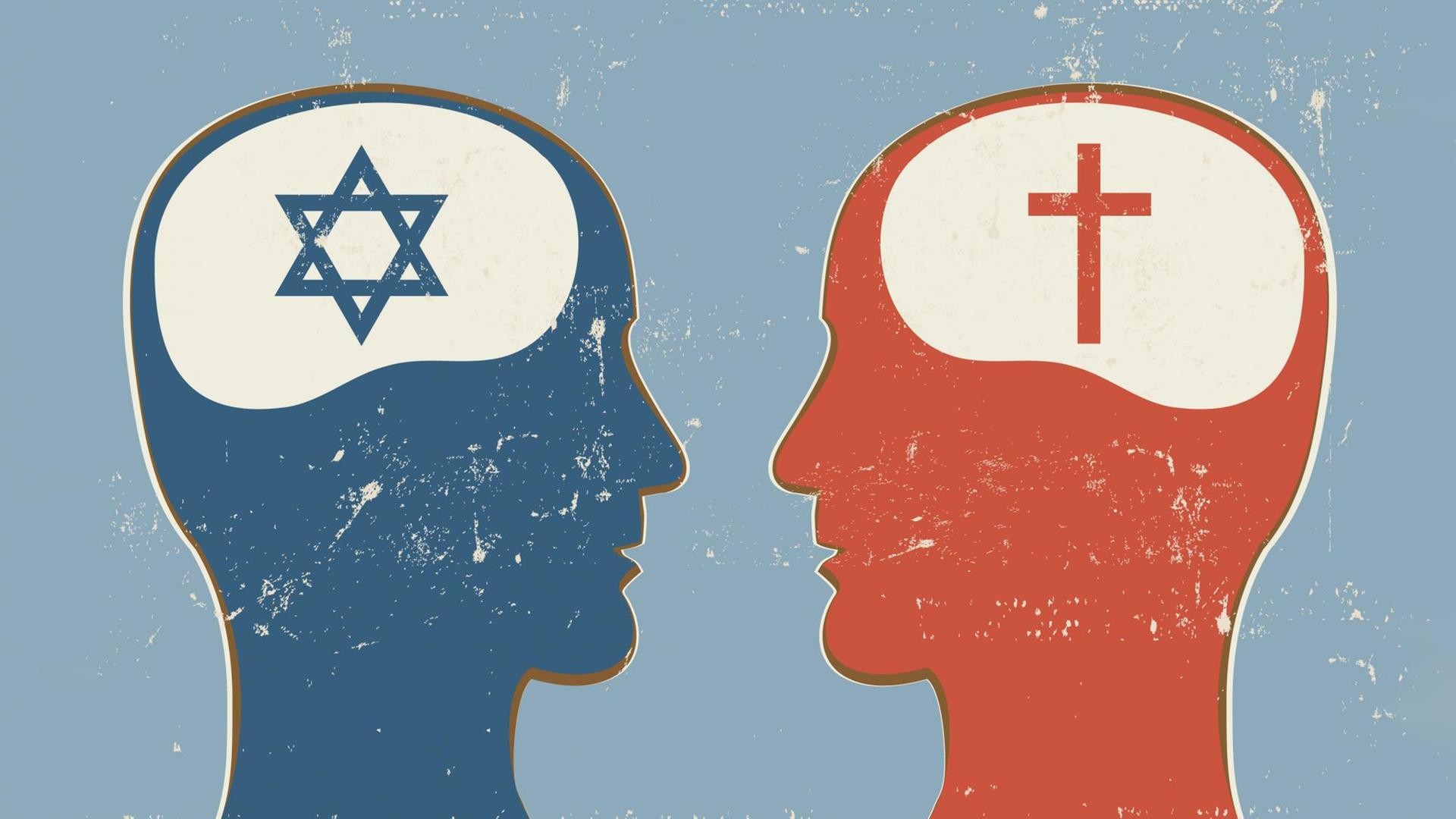
Nie wieder! Unter diesem Motto standen jüdisch-christliche Gespräche, die von den christlichen Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg initiiert wurden: Nie wieder mörderischer Hass. Doch dieser Dialog ist in die Jahre gekommen.
Am Anfang ein paar Zahlen. Denn Zahlen sind wichtig für Perspektiven. Also: Etwas über 43 Millionen Mitglieder haben die christlichen Kirchen in Deutschland, katholisch, evangelisch und andere zusammen. Rund 200.000 Juden und Jüdinnen leben in Deutschland. 43 Millionen zu 200.000, das sind 215 zu 1. Kein Wunder, dass bei Gesprächen über den jüdisch-christlichen Dialog unweigerlich dieses Wort fällt: Augenhöhe.
Versuch eines Neuanfangs
Drei Juden, eine Jüdin, alle vier engagiert im Dialog – und mit sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen: "Erst wieder ab den 2000er Jahren hat sich langsam etabliert, dass es wirklich ein Dialog auf Augenhöhe ist." - "Wenn man miteinander im Gespräch ist, auch im theologischen Streit, im besten Sinne des Wortes, dann ist man schon auf Augenhöhe." - "Das kann nur funktionieren, wenn auf einer Ebene jeder seine eigenen Dinge einbringen kann." - "Ich habe da wenig den Eindruck, dass das auf Augenhöhe ist. Aber ich habe auch nicht die Lösung, wie man es anders machen sollte."
Ein kurzer Blick zurück: 1948, drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutsche haben Millionen Juden ermordet. Die Kirchen haben viel zu wenig dagegen gesagt, viele Christen haben mitgemacht. 1948 sollte es einen Neuanfang geben.
Damals hieß es: "Die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit wissen von der historischen Schuld. Sie stellen sich der verbleibenden Verantwortung angesichts der in Deutschland und Europa von Deutschen und in deutschem Namen betriebenen Vernichtung jüdischen Lebens."
Viele Gespräche zwischen Funktionsträgern
Das Gespräch begann also aus klar christlicher Perspektive: Umgang mit eigener Schuld. Jüdisch-christlicher Dialog fand über Jahrzehnte vor allem unter diesem Dach von inzwischen 80 Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit statt: Woche der Brüderlichkeit jeden März, Buber-Rosenzweig-Medaille für verdiente Persönlichkeiten, viele Gespräche vor allem zwischen Funktionsträgern - vielen Pfarrern und Pfarrerinnen auf der einen, wenigen Rabbinern auf der anderen Seite.
Andreas Nachama, liberaler Rabbiner und Mitglied im Präsidium des Koordinierungsrates sagt: "Ich glaube, die Aufarbeitung von Schuld war die Frage der vorigen Generation, derjenigen, die - in welcher Form auch immer - diese Zeit noch miterlebt haben. Das ist unsere heutige Frage natürlich nicht. Unsere Frage ist: Wo im christlich-jüdischen Zusammenleben oder eben auch in dem Spannungsfeld zwischen Christentum und Judentum gibt es Dinge, die man durch Diskussionen, Gespräche, Initiativen voranbringen kann?"

Im Gespräch bleiben und Initiativen voranbringen: Rabbiner Andreas Nachama, Jüdischer Präsident des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit© picture alliance / dpa / Fabian Sommer
Jehoschua Ahrens, orthodoxer Rabbiner, eine Generation jünger als Nachama und wie er aktiv im organisierten jüdisch-christlichen Dialog, meint: "Es stimmt zwar, dass das überproportional christlich dominiert ist, andererseits, wenn man sich die jüdischen Akteure anschaut, würde ich sagen: Die sind überproportional im Dialog aktiv." Ungleich seien die Bemühungen um Gespräch und Zusammenarbeit schon lange vorher gewesen, sagt Ahrens: "Seit dem 18. Jahrhundert spätestens hat die jüdische Seite tatsächlich versucht, diesen Dialog zu machen. Die Kirchen haben das abgelehnt, die haben ja die Rabbiner gar nicht wahrgenommen."
Rabbiner wurden nicht wahrgenommen
Es habe bis lange nach der Shoah gedauert, bis sich daran etwas geändert habe, sagen beide Rabbiner. Zentral dabei war, dass die Kirchen offiziell erklärten, Jüdinnen und Juden nicht mehr missionieren zu wollen. Damit haben sie sich Zeit gelassen: Die katholische Erklärung Nostra Aetate stammt von 1965, eine entsprechende der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland erst aus dem Jahr 2016, aus dem Vorfeld des Reformationsjubiläums.
Noch einmal Ahrens: "Einen echten Dialog auf Augenhöhe gab es ja eigentlich erst ab diesem Zeitpunkt. Deshalb ist es jetzt von jüdischer Seite viel entspannter vielleicht, man kann viel vertrauensvoller auch mit den Kirchen zusammenarbeiten, weil man weiß: Solche Fehler der Vergangenheit wurden tatsächlich jetzt auch korrigiert."

Das Vertrauen sei gewachsen, seitdem die Kirchen ihren Anspruch aufgegeben haben, Juden zu missionieren, sagt Rabbiner Jehoschua Ahrens.© EKiR
Bei allen inhaltlichen Fortschritten, der offizielle christlich-jüdische Dialog hat ein ganz anderes Problem, meint der Rabbiner: "Der christlich-jüdische Dialog generell ist im Durchschnitt eher überaltert, da ist das Interesse bei der Generation 70 Plus überproportional – das heißt aber nicht, dass man nichts machen kann."
Ahrens zählt mit seinen 42 Jahren bei der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zu den Jüngeren. Juna Grossmann ist ungefähr so alt wie der Rabbiner Ahrens. Sie sagt: "Ich wage zu behaupten, in meiner Generation und jünger hat sich das überlebt, weil es einfach viel normaler geworden ist, miteinander zu reden – und eben nicht aus einem Anlass, sondern weil es einfach normal ist und weil man sich kennt."
Austausch jenseits von Institutionen
Grossmann bloggt, ist in sozialen Medien aktiv, lässt sich gerne fragen und fragt selber nach. Wer heute etwas über jüdisches Leben wissen möchte, sagt Grossmann, kann Ansprechpartner dafür mit einer einfachen Stichwortsuche finden, dazu brauche es keine Institutionen mehr.
Das stimmt schon, meint Andreas Nachama vom Präsidium der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit: "Es muss nicht alles unter dem Dach einer altehrwürdigen Gesellschaft passieren, die ja auch ihre Grenzen hat. Aber auf der anderen Seite ist es so: All diese spontanen Dinge, das erlebe ich im Trialog mit Muslimen, Christen, Juden, da ist es ganz wunderbar, man trifft sich, macht eine Konferenz, macht Dinge zusammen – und 14 Tage später sind alle, die da zusammen waren, nicht mehr da. Der eine ist zurückgereist, der zweite hat seinen Wohnsitz verlegt, und was weiß ich."
Ist es also eine Generationenfrage, ob man Institutionen braucht oder nicht? Juna Grossmann glaubt das nicht nur: "Mit wem reden sie? Funktionäre mit Funktionären. Dann kritisiert man halt nicht. Ich glaube, wenn man professioneller Christ oder Jude ist, dann hat man auch ein paar Grenzen."

Auf die persönliche Begegnung komme es an, meint Juna Grossmann. Das sei heute leichter und spontaner möglich, auch jenseits offizieller Anlässe und Festreden.© picture alliance / dpa / Uwe Zucchi
Grossmanns Beispiel dafür aus jüngster Zeit: die Kampagne "#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst". Evangelische und katholische Kirche wollen damit ihren Gemeinden die Nähe von christlicher und jüdischer Tradition nahebringen und damit ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen: "Pessach beziehungsweise Ostern", "Chanukka beziehungsweise Weihnachten", "Beschneidung beziehungsweise Taufe" – das sei sicher gut gemeint, sagt Grossmann, bügele dabei aber die Unterschiede und damit die jüdischen Traditionen unter:
"Ich könnte mich da sehr aufregen. Aber gleichzeitig sehe ich eben, dass befreundete professionelle Christinnen und Christen, Pfarrerinnen und Pfarrer, dass die das ähnlich kritisch sehen. Das gibt mir immer ein bisschen Hoffnung, dass die in der direkten Arbeit eben doch anders arbeiten."
"Rent a Jew - Meet a Rabbi"
Grossmann setzt auf direkte Begegnung. "Meet a Jew", "Rent a Jew", "Meet a Rabbi" – in den letzten Jahren haben sich viele Juden und Jüdinnen in solchen Aktionen ansprechbar gemacht: Ihr habt Fragen danach, wie jüdisches Leben heute geht? Fragt uns!
"Ohne Anlass, ohne Feier oder so, und das läuft seit Jahren", sagt Grossmann, "das passiert, dazu braucht man keinen Anlass, außer zu sagen: Wir sind da, redet mit uns. Also: mit uns, nicht über uns." Und ohne irgendeine Institution. Wobei: "Meet a Jew" ist inzwischen an den Zentralrat der Juden angegliedert.

Der Klarinettist Nur Ben Shalom bringt Menschen durch Musik ins Gespräch.© Andrej Grilc
Wie er sein Engagement nennen soll, weiß er eigentlich gar nicht, sagt Nur Ben Shalom, und eigentlich will er auch nicht die typische Terminologie des jüdisch-christlichen Dialogs verwenden – damit lande man so schnell in einer bestimmten Ecke.
Ben Shalom ist klassisch ausgebildeter Klarinettist. Er arbeitet mit einem Berliner evangelischen Kirchenkreis für ein besonderes Projekt zusammen, die sogenannten Lebensmelodien. Lieder, Klänge, Melodien, die von jüdischen Musikerinnen und Musikern in der Zeit der Shoah geschaffen wurden, sollen wieder hörbar werden.
Menschen durch Musik verbinden
"Auf jeder Zusammenarbeit ruht Segen, und alle Versuche, Menschen zu verbinden für eine bessere Zukunft, sind großartig, aber bestimmte Terminologien verwende ich dabei nur vorsichtig", sagt Nur Ben Shalom - eben weil das Thema jüdisch-christlicher Dialog so belastet ist, mit christlichem Antijudaismus, mit Antisemitismus, mit Gewalterfahrungen. Ben Shalom mag inhaltlich an Themen aus der Anfangszeit des Dialogs anknüpfen – aber er tut das bewusst als säkularer Jude aus Israel – ein neuer Klang im Dialog:
"Als Musiker und als Mensch interessieren mich die Musik und das allgemein Menschliche. Ob man das in irgendeine Institution einordnen kann, interessiert mich eigentlich nicht. Mich interessieren die Inhalte. Ich glaube, deshalb funktioniert es auch."
Wie sich als Jüdin, als Jude in ein Gespräch mit der Mehrheitsreligion begeben? Das ist eine Frage, die gerade erst dabei ist, neu gestellt zu werden – und diesmal sehr selbstbewusst und selbstbestimmt: von jüdischer Seite aus.






