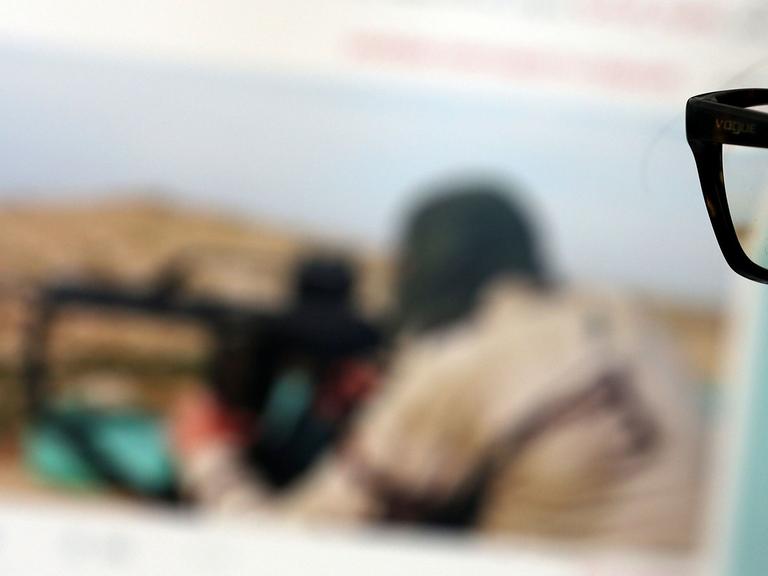Vom humanitären Einsatz zum Krieg

Am 7. August 2014 startete US-Präsident Obama den Kampf aus der Luft gegen die IS-Miliz. Nach einem Jahr ist die Bilanz ernüchternd. Der Krieg gleicht einer politischen Pflichterfüllung mit geringen militärischen Erfolgen. Kein schneller Sieg in Sicht.
Als Präsident Obama am 7. August 2014 an die Öffentlichkeit ging, nannte er zwei Gründe für die Luftangriffe:
"Erstens, in den letzten Tagen hat sich die Terrororganisation IS der kurdischen Stadt Erbil genähert. Dort arbeiten Amerikaner an der Botschaft und Soldaten trainieren das irakische Militär."
In diesem August 2014 waren die IS-Kämpfer noch 30 Fahr-Minuten von der Millionenmetropole Erbil entfernt. Doch der Schutz der Amerikaner war nur die halbe Wahrheit. Erbil ist die Hauptstadt der autonomen Provinz Kurdistan. Die Kurden und ihre Kämpfer sind der verlässlichste Partner der USA im Hexenkessel Irak, Syrien, Türkei. Und die Region ist reich an Öl. Große Ölfirmen wie Exxon und Chevron buddeln dort nach dem Schmierstoff, der Amerika am Laufen hält. Ein Kampf um diese Stadt hätte hunderte von Toten bedeuten können. Und der Einfluss der USA in dieser Region wäre weiter geschrumpft. Die Tatenlosigkeit des Präsidenten angesichts des Bürgerkriegs im Syrien und der Bedrohung durch den islamischen Staat brachte seine Gegner in den USA ohnehin schon zur Weißglut:
"Ist es nicht das Schlimmste, nichts zu tun?", fragte der Republikaner JohnMcCain. Er war zugegeben die lauteste Stimme, die forderte, Amerika müsse sich im Nahen Osten stärker engagieren. Die meisten Amerikaner waren froh, dem Irak entkommen zu sein. So auch Präsident Obama:
"Ich weiß, viele von Ihnen sind sehr besorgt gegenüber jedem Militäreinsatz im Irak auch gegenüber begrenzten Einsätzen, Ich kann das verstehen. Ich habe dieses Amt angetreten, um unsere Kriege im Irak und Afghanistan zu beenden und unsere Truppen heimzuholen."
Für ihn, den Friedensnobelpreisträger, musste es besonders bitter sein, wieder einen Kriegseinsatz zu befehligen. Doch neben den politischen, strategischen und wirtschaftlichen Gründen es einen weiteren Aspekt, mit dem Obama die Luftangriffe begründete. Einen menschlichen, und damit traf er die Amerikaner ins Herz:
"Schätzungsweise 40.000 Jesiden und andere verfolgte religiöse Gruppen waren vor den IS-Mördern in das Sinja-Gebiet im Norden des Irak geflüchtet. Frauen und Kinder mit nichts außer ein paar Fetzen Stoff am Leib. Sie retteten im wahrsten Sinne des Wortes ihre Haut."
Der IS bildete einen Belagerungsring und drohte sie auszuhungern. Die US-Luftwaffe sprengte diesen Ring. Die Soldaten warfen 20.000 Liter Wasser und 8000 Lebensmittelpakete ab. Die leeren Hubschrauber nahmen ein paar Verzweifelte mit an Bord zurück. Der Reporter des Fernsehsenders CNN ist dabei:
"Ich mache seit zehn Jahren solche Geschichten, aber ich habe nie eine Situation erlebt, die so verzweifelt und so emotional aufgeladen war, und ich habe noch nie eine Rettungsaktion erlebt, die so spontan und improvisiert war wie diese."
Der Preis der Freiheit: Amerikas Kriege
Die Gedenkstätte für den Zweiten Weltkrieg in Washington: Sie erinnert an die 16 Millionen amerikanischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gedient haben. Sie haben mitgeholfen, die Welt von der Naziherrschaft zu befreien.
"Hier zeigen wir den Preis der Freiheit" heißt eine Inschrift. Eine andere: "Amerikaner kamen zu befreien, nicht zu erobern, um Freiheit herzustellen und Tyrannei zu beenden."
Die Amerikaner zogen oft um den Preis der Freiheit in den Krieg. Um Vietnam vor den Kommunisten zu retten, den Irak vor ihrem Diktator Hussein, Afghanistan vor den Taliban und jetzt den Irak und Syrien vor den unfassbar grausamen radikalen IS-Terrorgruppen. Oft gingen diese Einsätze schief. Vietnam, Afghanistan und auch der Irak stehen für gescheiterte Kriege. Doch die Amerikaner folgen ihrem Präsidenten erneut:
"Ich denke, es ist richtig, Menschen zu befreien, die unterdrückt werden. Es ist furchtbar, wenn ein Terrorregime ein Gebiet übernehmen kann. Es wundert mich, dass nicht die ganze Welt mithilft, IS zu bekämpfen. Ich denke, Luftangriffe reichen nicht, ich denke, wir müssen mehr tun, denn IS ist so schlimm wie die Nazis"
... sagt Eric Lips aus Missouri. Und Lynn aus Atlanta ergänzt:
"Manchmal ist Krieg ein moralischer Grund, reinzugehen, um Menschen zu befreien. Aus Sicht einer Mutter muss ich sagen, wenn meine Kinder dafür kämpften, andere Menschen zu befreien, würde ich sie unterstützen."
Die Zustimmungsraten bleiben hoch. Nach den letzten Umfragen, die allerdings aus dem vergangenen Jahr stammen, unterstützen 66 Prozent der Amerikaner die Luftangriffe gegen den IS. Die große Unterstützung ist nicht verwunderlich. Es ist noch ein ziemlich unsichtbarer Krieg. Weit weg, ohne amerikanische Verwundete oder gar Tote. Und die Amerikaner sind nicht alleine in den Krieg gezogen. Vor allem dem unermüdlichen John Kerry ist es zu verdanken, dass sich eine internationale Koalition dem Luftkrieg angeschlossen hat:
"Wir haben Länder in der Region und außerhalb der Region und alle sind bereit, Militärhilfe zu liefern oder Bomben, falls dies notwendig ist", so Außenminister Kerry.
Zu Beginn des Militäreinsatzes wollten die Koalitionäre lieber nicht genannt werden, waren doch arabische und muslimische Länder dabei. Doch inzwischen ist die Liste bekannt. Frankreich liefert Munition, Deutschland versorgt kurdische Kämpfer im Nordirak mit Waffen, Australien steuert Kampfjets bei. Andere Länder geben Geheimdienstinformationen, Zelte für Flüchtlinge und Training für die irakischen Soldaten. Doch der Großteil des Einsatzes bleibt an den Amerikanern hängen.
Nur einen Tag, nachdem Präsident Obama angekündigt hatte, Bomben aus der Luft auf IS-Stellungen abzuwerfen, starteten die ersten F/A-18 Kampfflugzeuge – genannt die Hornisse. Das amerikanische Verteidigungsministerium veröffentlichte tonlose Bilder. Darauf waren schwarz-weiß Explosionen zu sehen. Die US-Luftwaffe warf Bomben auf die Konvois, die auf die Stadt Erbil zurollten und zerstörte Gefechtsstellungen der Terrorgruppe. Jetzt zum Jahrestag hat das US-Militär eine Bilanz der Luftangriffe gezogen. Danach sind bislang 5000 Angriffe gegen IS-Stellungen geflogen worden. 15.000 IS-Anhänger seien getötet worden. Doch der Nachschub an jungen Männern, die für einen islamischen Staat in die Schlacht ziehen, scheint unerschöpflich. Ein Jahr Krieg und die Zahl der IS-Kämpfer ist gleich geblieben, zwischen 20- und 30.000, sagen US-Militärs.
Die jungen Männer werden über das Internet angeworben und kommen aus allen Teilen der Welt. Saudi Arabien, Belgien, der Türkei – schätzungsweise 500 aus Deutschland. Ihr Weg führt meist über die Türkei nach Syrien. Die Strecke hat schon den Spitznamen "dschihad highway". Monatelang hat Präsident Obama die türkische Regierung aufgefordert, ihre Grenzen besser zu schützen und sich im Kampf gegen den islamischen Staat stärker zu engagieren. Ein Jahr nach Kriegsbeginn ist es soweit. Die Türkei hat den USA eingeräumt, den Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu benutzen. Für viele Militärbeobachter könnte dies ein Wendepunkt im Kampf gegen den IS sein. Denn jetzt sind die US-Kampfjets nur noch 400 Kilometer entfernt. Zuvor mussten sie immer von ihrem Flugzeugträger im Golf starten, der viermal so weit entfernt war.
Das Gebiet, das der islamische Staat inzwischen kontrolliert, ist groß. Nach Einschätzung der Organisation Observatory for Human Rights in Syria umfasst es inzwischen die Hälfte Syriens, darunter historische Städte wie Palmyra. Im Irak ist es der Norden des Landes in die Hände der religiösen Fanatikern gefallen, Mosul, das Sinja-Gebiet. Wenn also die Zahl der Kämpfer unverändert ist und der IS in den letzten zwölf Monaten mehr Gebiete und Städte in seine Gewalt gebracht hat, muss dann der Einsatz der Amerikaner nicht als gescheitert betrachtet werden? Nein, sagte Präsident Obama bei einem Besuch des US-Verteidigungsministeriums:
"Das wird nicht schnell gehen und wie bei jeder Militäroperation gibt es Fortschritte und Rückschläge. Wir haben über die Jahre gesehen, wenn wir einen effektiven Partner vor Ort haben kann IS zurückgedrängt werden."
Neue Regierung, aber eine schwache Armee
Das Problem ist, es gibt keinen verlässlichen Partner vor Ort. Die irakische Armee ist schwach und von einem jahrelangen Kampf auch gegen die USA ausgelaugt. Ein großer Fehler der Obama-Regierung war in den Augen vieler Nahostexperten, dass die Amerikaner alle Soldaten aus dem Irak abgezogen haben. Der IS konnte sich ungebremst ausbreiten. Es gab keine Verbindungsleute, die verlässliche Informationen geliefert hätten. Inzwischen haben die Amerikaner wieder gut 3000 sogenannte Militärberater in den Irak geschickt. Diese trainieren irakische Soldaten, versorgen sie mit modernen Waffen und zeigen ihnen, wie man sie bedient.
Für die Amerikaner ist die Situation im Irak einfacher geworden, seit dort eine neue Regierung an der Macht ist. Der damalige Präsident Nouri al Maliki hat die Obama-Regierung oft verärgert. Er wollte Waffen und Geld, hat es aber nicht geschafft, die Sunniten in die Regierung einzubinden. Sie wurden verfolgt und unterdrückt und viele haben deshalb mit dem islamischen Staat zumindest sympathisiert. Mit dem neuen Präsidenten Haider Al Abadi arbeitet die USA Regierung vertrauensvoller zusammen. Doch mit der militärischen Leistung sind die Amerikaner nach wie vor unzufrieden: Nachdem in der irakischen Stadt Ramadi die schwarze IS-Fahne gehisst wurde, sagte der amerikanische Verteidigungsminister Ashton Carter dem Fernsehsender CNN:
"Die irakischen Truppen zeigten keine Willen zu kämpfen, sie liefen weg, obwohl sie in der Überzahl waren. Wir können ihnen Waffen und Training geben, aber nicht den Willen, gegen den IS zu kämpfen."
Diese Einschätzung hat dem amerikanischen Verteidigungsminister viel Ärger eingebracht. Die Obama-Regierung ruderte zurück. Denn vom Kampfgeist der irakischen, kurdischen und syrischen Truppen hängt die gesamte Militärstrategie der Amerikaner ab. Obamas Credo lautet "No boots on the ground", wenigstens keine kämpfenden US-Soldaten mehr auf irakischem Boden, nur in der Luft. Und davon wird er in seiner Amtszeit wohl auch nicht mehr abrücken. Im Irak ist zumindest klar, wen man dafür trainieren muss, das irakische Militär. Sehr viel schwieriger ist die Lage in Syrien.
Ein Zwei-Zimmer-Appartement in Alexandria, einem Stadtteil von Washington. Hier lebt der Journalist Khaled Sesem mit seiner Frau und seinem vier Kindern. Er musste vor elf Monaten aus Syrien in die USA fliehen, nachdem er kritisch über den Diktator Assad berichtet hat. Fragt man ihn, was er über die Obama-Politik gegen IS in Syrien denkt, sagt er:
"Ich denke, Obamas Politik in der Syrien-Krise war nicht der richtige Weg. Das syrische Volk wurde allein gelassen im Kampf gegen einen der schlimmsten und blutigsten Diktatoren in der Welt. Die normale Reaktion ist dann, dass extreme Gruppen wie IS entstehen."
In Syrien ist die Situation besonders verworren. Die USA bekämpfen dort den Islamischen Staat, der auch von Diktator Assad verfolgt wird. Doch deswegen werden die USA nicht mit dem Assad Regime zusammenarbeiten. Bleiben als Verbündete die "guten" syrischen Rebellen, die sowohl gegen Assad als auch gegen IS sind. Diese bekommen nun nach jahrelangem Zögern auch Waffen und Training aus den USA, doch es sind zu wenige. Dass die USA es versäumt haben, die syrischen Rebellen rechtzeitig zu unterstützen, gilt als zweiter großer außenpolitischer Fehler der Obama-Regierung. Der IS stieß damit auf keinen schweren Gegner und konnte in Syrien stark werden. Der Hauptsitz des islamischen Staates ist in der syrischen Stadt Rakka. Diese Zentrale haben die Amerikaner verstärkt ins Visier genommen, so Präsident Obama:
"Wir haben unsere Angriffe gegen IS in Syrien intensiviert. Unsere Luftangriffe zielen auf ihre Öl- und Gasanlagen, mit denen sie ihre Einsätze finanzieren. Wir attackieren ihre Infrastruktur in Syrien, mit der sie Propaganda auf der ganzen Welt verbreiten."
Erpressung und Menschenhandel
Die USA versuchen außerdem, den IS finanziell auszutrocknen, sie versuchen zu verhindern, dass Öl über den Iran und die Türkei geschmuggelt wird. Doch inzwischen hat der IS in den besetzten Gebieten eine Art Gemeinwesen errichtet. Er treibt Steuern ein, lebt dazu von Erpressung und Menschenhandel. Die amerikanische Regierung weigert sich bislang, für ihre entführten Amerikaner Geld zu zahlen.
Am 19. August kommt der Krieg gegen den islamischen Staat den Amerikanern ganz nahe. Der Journalist James Foley wird öffentlich hingerichtet. Seine Eltern gehen verzweifelt an die Öffentlichkeit.
Weiter Hinrichtungen folgen, das Muster ist immer dasselbe. Die Amerikaner, später auch ein Brite, knien in einem orangen Häftlingsanzug, wie man sie aus Guantanamo kennt. Dahinter der schwarz vermummte Henker, der inzwischen als britischer Staatsbürger identifiziert ist. Vor ihrem Tod müssen die Männer noch eine Botschaft verlesen:
"Ich appelliere an meine Freunde und Familie, sich gegen meine wahren Feinde zu erheben, die amerikanische Regierung. Ich appelliere an meinen Bruder John, einen Luftwaffenpilot. Denke daran, welche Leben du zerstörst, einschließlich das deines Bruders."
Die Amerikaner haben ihre Lösegeldpolitik inzwischen geändert. Familien dürfen zahlen, ohne strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Die US-Regierung zahlt nach wie vor nicht.
Für Präsident Obama ist der Krieg gegen den IS politische Pflichterfüllung. Er ist nicht vergleichbar mit dem Iran-Abkommen oder der Öffnung Kubas, die er mit Leidenschaft vorantreibt. Vor allem, weil die Amerikaner mit ihren ersten Irak-Kriegen mit dazu beigetragen haben, dass die radikalen Islamisten so stark wurden.
Nicole Goodwill war ein halbes Jahr im Irak. Sie engagiert sich heute bei Veteranen gegen den Krieg und sie ist strikt dagegen, dass die Amerikaner erneut Bomben über dem Irak abwerfen:
"Ich denke, IS würde aufhören, wenn wir Bush und Cheney mit Kriegsverbrechen anklagen würden."
Ein Jahr nach den ersten Luftangriffen ist jedenfalls ein schneller Sieg über den Islamischen Staat nicht in Sicht. Die Strategie der Obama-Regierung ist bislang, die Truppen vor Ort zu stärken, damit Irakis, Kurden und syrische Rebellen die Terrorgruppe zurückdrängen können. Die Amerikaner und ihre Verbündeten liefern dazu Unterstützung aus der Luft: Logistik, Waffen und Training. Die Frage ist, wie sich diese Strategie ändert, wenn Ende kommenden Jahres ein neuer Präsident gewählt wird. Für Donald Trump, derzeit der Favorit bei den Republikanern, ist die Sache ganz einfach:
"Ich würde ihnen ihren Wohlstand wegnehmen und die Ölfelder bombardieren."