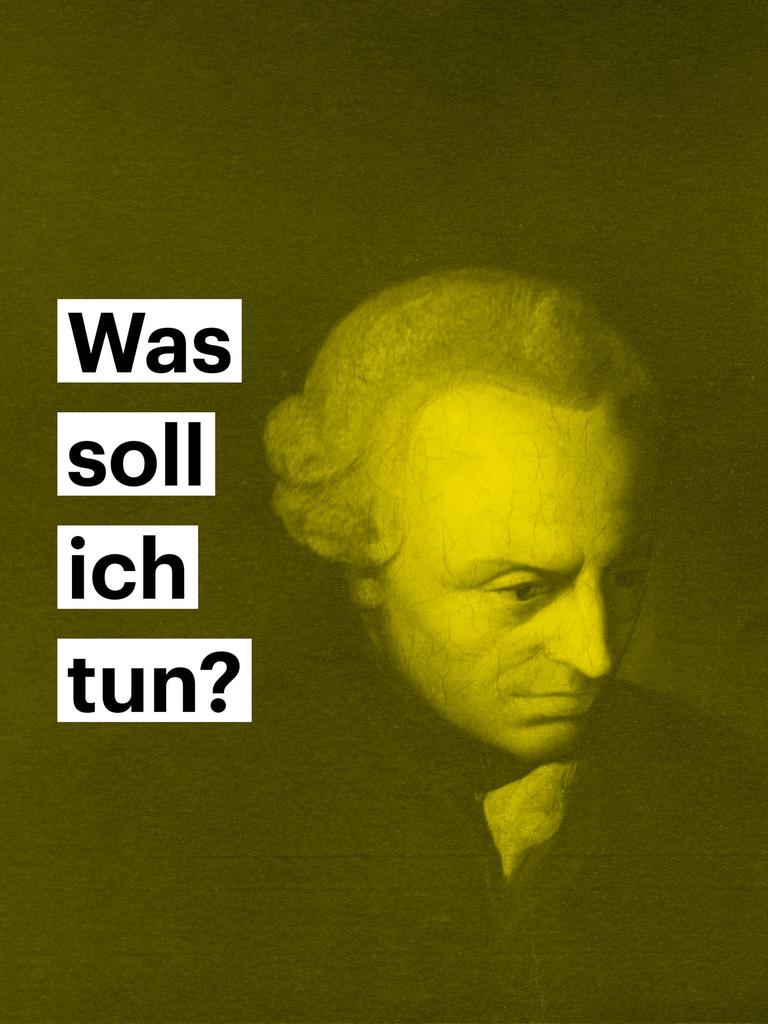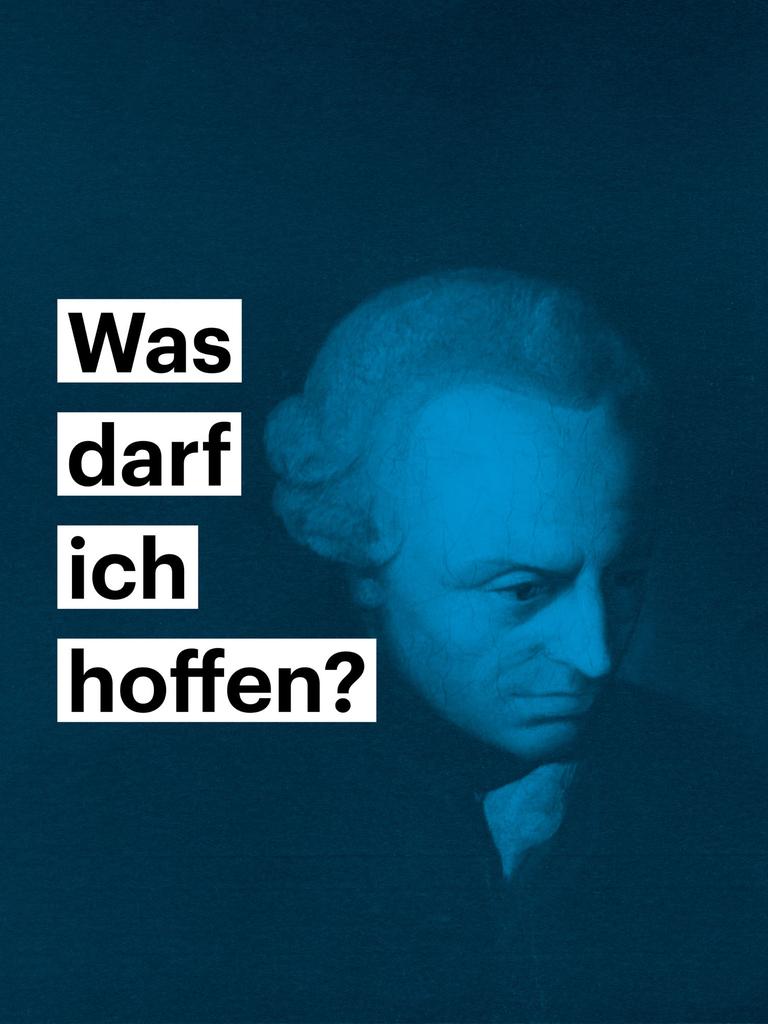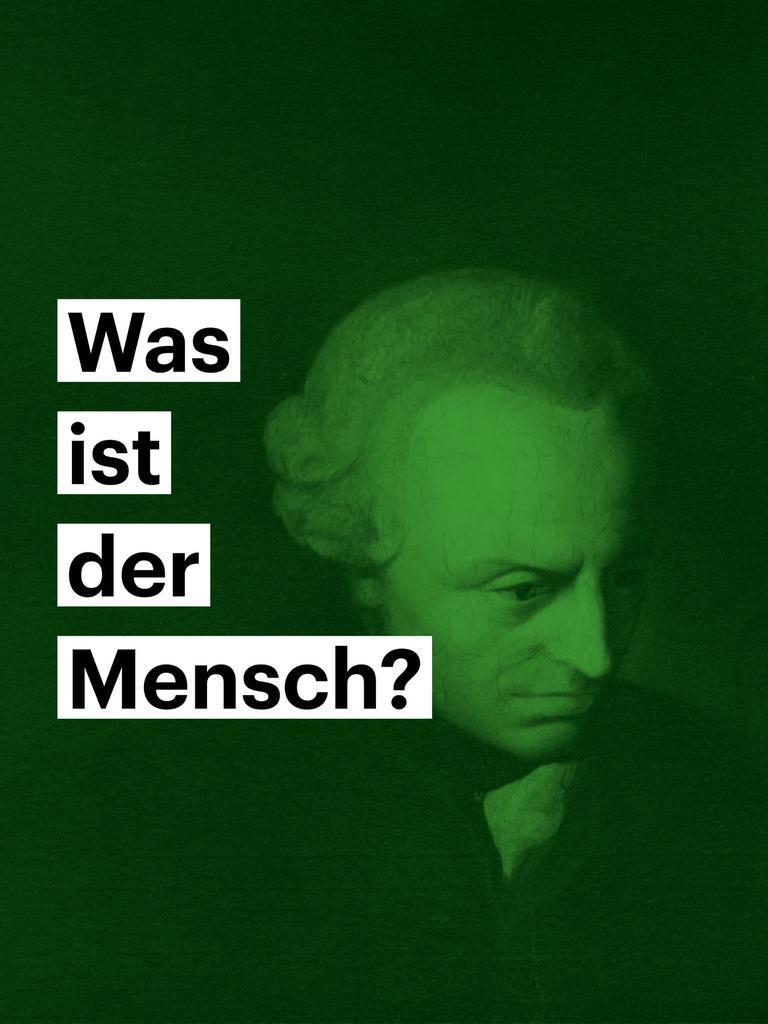Kant reloaded
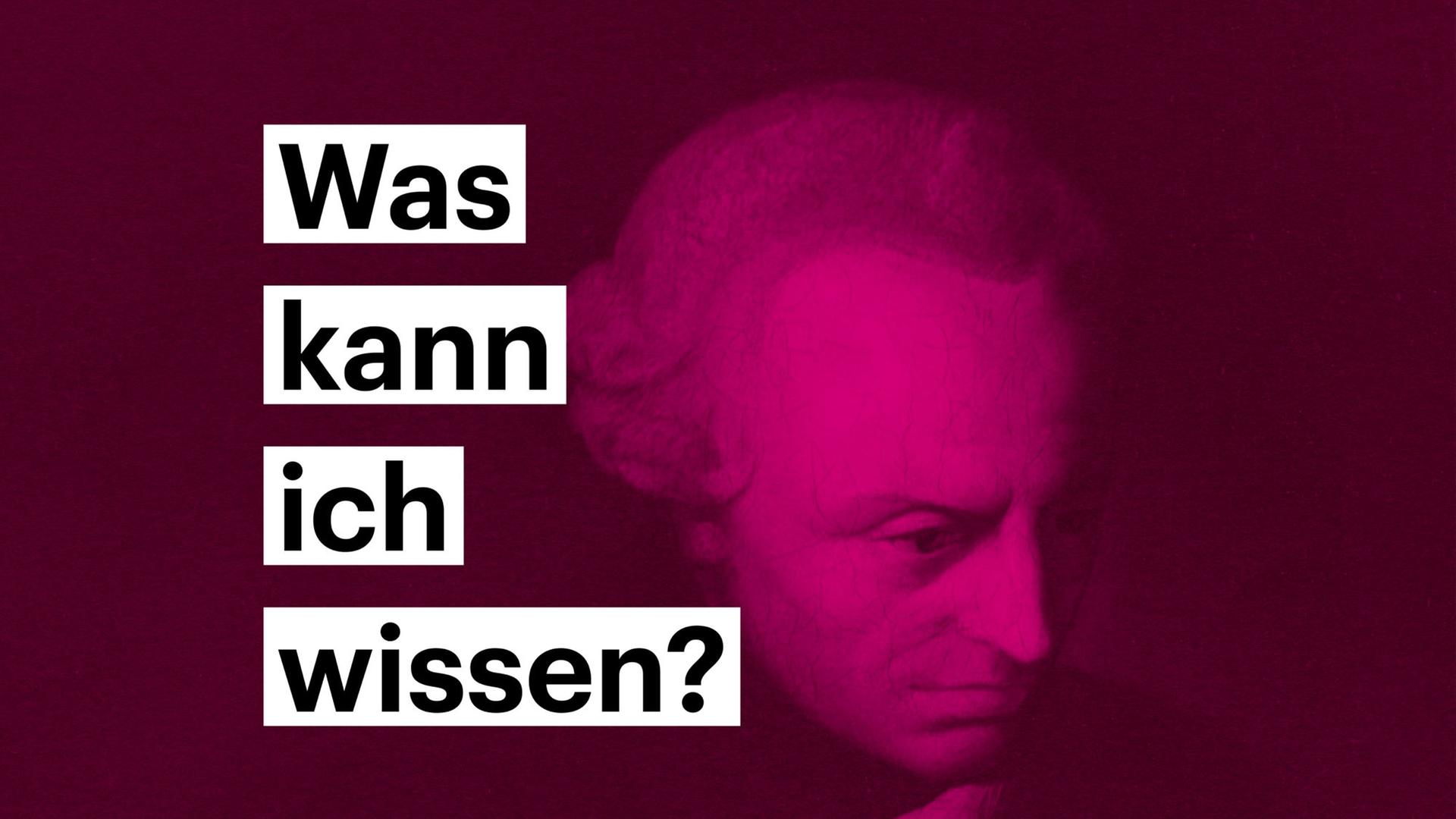
Neugierde, die Triebkraft aller Erkenntnis, reichte in meinem Herkunftsmilieu nicht weiter als bis hinter Nachbars Gardine, sagt Autorin Kerstin Hensel. © picture alliance
Gewolltes Nichtwissen ist zeitlos
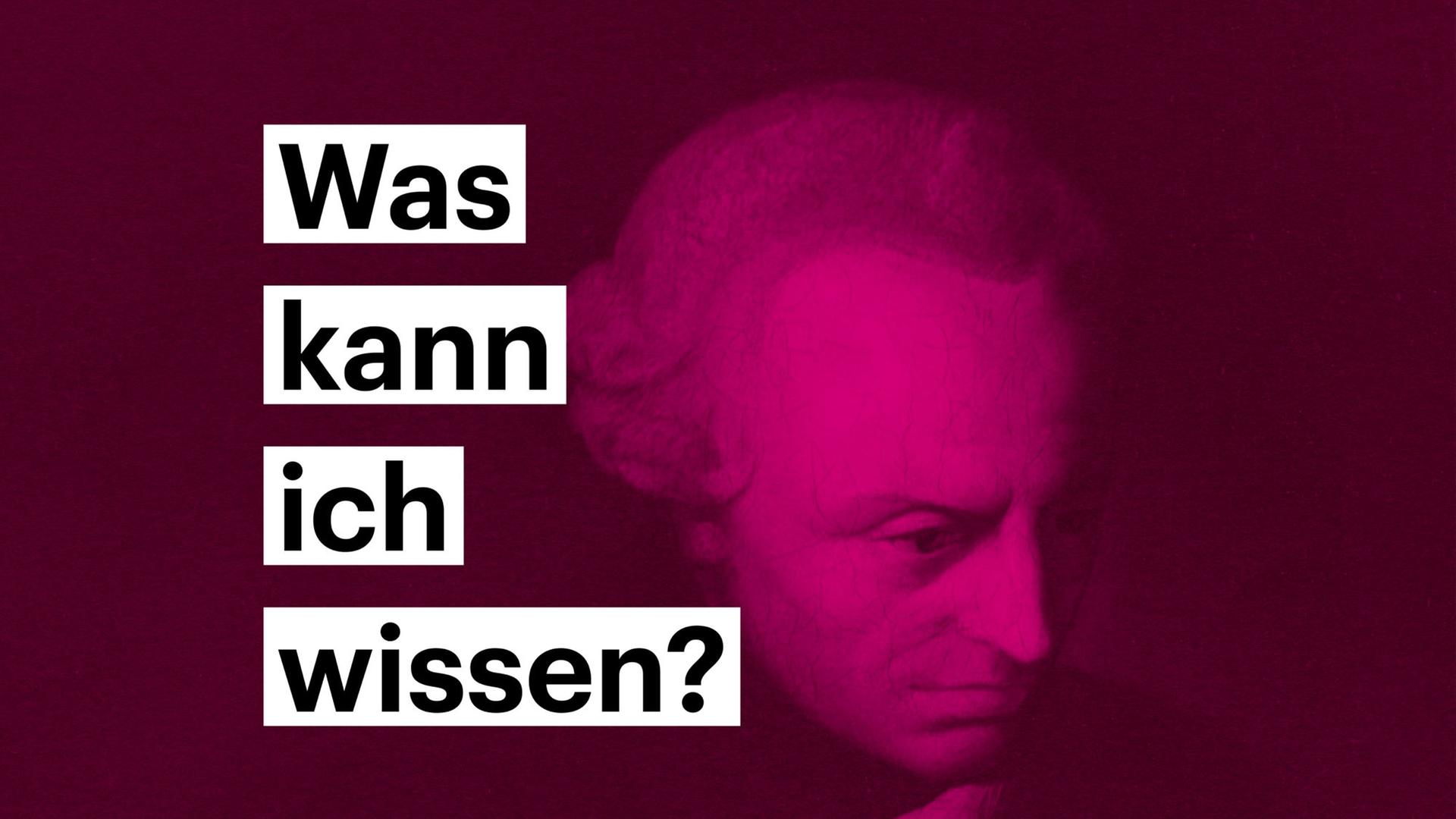
Vier Fragen stellte sich Immanuel Kant 1765. Sie wurden später als Leitmotive der Philosophie berühmt. Wir haben vier Autor*innen gebeten, sich mit jeweils einer der Fragen zu beschäftigen. Was kann ich wissen, fragt sich die Lyrikerin Kerstin Hensel.
Was kann ich wissen? So lautet die Number One des berühmten philosophischen Fragequartetts. Je eifriger ich Auskünfte in Bezug auf mich suche, desto banaler klingt meine Antwort: Was weiß denn ich?
Glücklicherweise ist es heute en vogue, bei ausgeprägtem Unwissen über eine Sache ungehemmt in der Öffentlichkeit seine Meinung kundzutun – und möglichst dergestalt, dass der Eindruck vermittelt wird, die Definition der Wahrheit liege bei einem selbst. Eine andere Möglichkeit ist: Man ist stolz auf seine Unkenntnis und geht damit beim Pöbel hausieren.
Das "Ding an sich": Nie zu erkunden
Immerhin drängle ich mich mit meiner Einsicht, die nicht mehr ist als eine flapsige Gegenfrage, in die geistige Nähe des Inventors Immanuel Kant. Hat er nicht selbst seine illustre Erkundung der im Uneindeutigen wabernden Metaphysik zugeschoben und als „bloß spektakulär“ abgehakt? Kants Schlussurteil, der Mensch werde das „Ding an sich“, also die Wirklichkeit, niemals erkennen, kann ich mit eigener Lebenserfahrung quittieren: Isso!
Dabei war ich bereits als Kind wissensdurstig, habe viel gelesen, gerätselt, abgelauscht und nachgefragt. Doch meine Leidenschaft wurde oft mit ganz unphilosophischen Fragen abgewatscht wie: Warum steckst du deine Nase überall rein? Oder: Musst du immer alles besser wissen? Auch gab es Ansagen wie: Womit du dich beschäftigst, das versteht kein normaler Mensch. Du schon gar nicht!
Neugierde, die Triebkraft aller Erkenntnis, reichte in meinem Herkunftsmilieu nicht weiter als bis hinter Nachbars Gardine. Auf „Normalität“ und dem sogenannten „gesunden Menschenverstand“ pochend, hatte man geradezu Angst vor zu viel Wissen, vor tiefergehender Bildung und Intellektualität.
Als Klugscheißer abgestempelt
Jeder Blick, der unter die Oberfläche einer Sache ging, war den Leuten unheimlich und wurde als zu kompliziert abgelehnt. Es galt die Devise: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Auf diese Weise kam man unbehelligt durchs Leben, ohne Zweifel, ohne sich je die quälende Frage stellen zu müssen: Was kann ich wissen? Wer wissen wollte, wurde Klugscheißer genannt.
Gewolltes Nichtwissen ist zeitlos. Wenn Goethe den in seiner Studierstube von existenziellen Skrupeln geplagten Doktor Faust resümieren lässt: „Ich sehe, dass wir nichts wissen können! / Das will mir schier das Herz verbrennen“, höre ich heute das Völkchen der Social-Media-Hocker, Blogger und Tiktoker hämisch fragen: Was hat der denn für Probleme?
Auch was die antiken Herren Sokrates, Cicero und Platon mit der Essenz „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ als Mangel an Weisheit definierten, war und ist bei Lieschen Müller und Otto Normal kein Grund zur Sorge. Es reicht, wenn man etwas fühlt oder seine ersten Empfindungen zur Weisheit letzter Schluss erklärt.
Ist Wissen Macht?
Ich finde es beruhigend, dass es Dinge gibt (auch das „Ding an sich“), die sich seit Urzeiten einer Festschreibung verweigern. Moderne erkenntnistheoretische Spannbögen, die Wahrheit, Wirklichkeit und Erkenntnisvermögen schlüssig miteinander verbinden, fordern meinen Respekt. Gleichsam neige ich dazu, mich dem grantigen Grübler Friedrich Nietzsche anzuschließen, der diagnostizierte, dass der Mensch durch seine Irrtümer erzogen worden und es daher mit seiner Vollkommenheit nicht weit her sei.
Während also das Unvollkommene des Menschen im Hamsterrad der Philosophie rundläuft, genießt es anderswo hohes Ansehen. Vor allem auf dem Gebiet selbstverschuldeter Unwissenheit. Vor fast 400 Jahren hat Francis Bacon den waghalsigen Spruch „Wissen ist Macht“ in die Welt gesetzt. Den konnte man fürderhin, je nach den Erfordernissen der jeweiligen Epoche, benutzen, missbrauchen oder verkalauern: „Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts.“