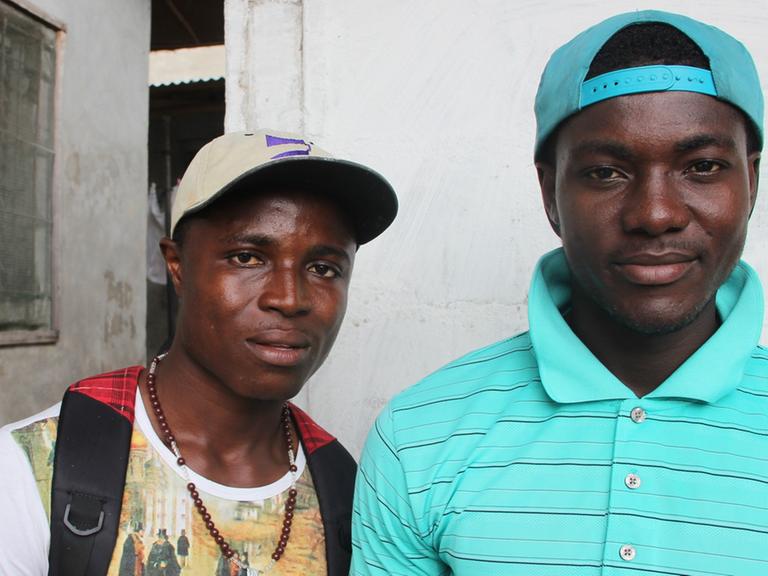Überlebenskampf im Zweier-Team

Helfer werden dringend benötigt, doch wenige trauen sich in die Ebola-Gebiete. Und wer freiwillig hingeht, muss gut ausgebildet sein, weil er sonst sein Leben aufs Spiel setzt. In einer Bundeswehrkaserne werden die Soldaten für ihren Einsatz ausgebildet.
Medienrummel vor der Übungshalle auf dem Gelände der Marseille-Kaserne in Appen – draußen herrscht herbstliche Idylle, drinnen wird für den Ernstfall geprobt. Der Pulk von Journalisten, Fotografen und Kamerateams soll dabei möglichst nicht stören ...
"Wer ein Nahaufnahmen-Foto oder -Videobild nachher braucht, kann dann nach 10 oder 15 Minuten – da müssen wir mal kucken – auch an diese Nahaufnahmen ran. Wir werden das Ihnen allen ermöglichen – aber nicht alle gleichzeitig! Achten Sie bitte auf Ihre Ausrüstung – da wird halt dekontaminiert. Wenn Ihre Kamera nass wird – ich kann nichts dafür!"
In der Halle selbst sind verschiedene Bereiche mit gelbem Flatterband abgesperrt, dahinter stehen auf der einen Seite Soldaten – bereit, unter Anleitung ihre Schutzausrüstung anzulegen. Ausbilder Michael P. – seinen vollen Namen soll er, wie alle Freiwilligen, nicht nennen – hilft beim Auspacken des blauen Kunststoffanzugs und erklärt die einzelnen Komponenten.
"... mit den entsprechenden verklebten Nähten, mit einem Reißverschluss, mit der Verklebung des Reißverschlusses, so dass sie auch nachher später gut dekontaminiert werden können, ohne das Chlorlösung in den Anzug eindringt oder sonst irgend eine Art der Verschmutzung. Sie haben eine Schutzhaube mit einer banalen Operationsmaske, die Sie aber tragen mit einer sogenannten Feinpartikelmaske. Und Sie haben eine Gummi-Schutzschürze, ähnlich wie so eine Metzgerschürze – und das reicht eigentlich aus in Kombination mit einer Brille und dicken Handschuhen, damit sind Sie gut geschützt."
Beim Anlegen der Schutzausrüstung samt Gummistiefeln, Schritt für Schritt nach klar festgelegten Regeln, bilden immer zwei Freiwillige ein Team – eine Grundregel während der ganzen Ausbildung, und auch später im Einsatz.
Die Schutzanzüge sind kein Vergnügen
"Das Vier-Augen-Prinzip – oder bei der Armee nennt man das das Buddy-Prinzip: Man hat immer seinen Partner dabei – man achtet auf sich, man kennt sich, das ist ein ganz wichtiges Prinzip."
Nach gut 20 Minuten stehen vier dick vermummte Gestalten hinter dem Absperrband. Durch einen schmalen Schlitz sind die Augen hinter der dicken Schutzbrille zu erkennen – und in denen ist die Anspannung abzulesen, die wohl alle hier erfasst hat. Anspannung – und Erschöpfung, denn schon bei herbstlich-kühlen Temperaturen in Schleswig-Holstein sind die Schutzanzüge kein Vergnügen – in Westafrika wird der Schweiß in Strömen fließen, weiß der Ausbilder aus eigener Erfahrung zu berichten.
"Sie schwitzen unermesslich – und sie werden Einsatzzeiten haben auch gerade bei diesen klimatischen Bedingungen von... untere Grenze dürfte 30 Minuten sein, die obere Grenze ist mit Sicherheit 60 Minuten – also, es wird irgendwas dazwischen sein, je nachdem, wie sie körperlich dazu in der Lage sein werden."
Lange müssen es die Freiwilligen diesmal nicht in den Anzügen aushalten. Am anderen Ende der Halle markieren grellrote Schilder die "Risiko-Zone": zwei mit grünen Planen abgetrennte Boxen, in denen die Dekontamination und das Ablegen der Schutzkleidung geübt wird. Hier stehen überall Behälter für die verseuchten Abfälle parat, Chlorlösung wird als Desinfektionsmittel in große Spritzen – ähnlich den Unkrautspritzen für die Gartenarbeit – gefüllt. Wieder Schritt für Schritt müssen die Lehrgangsteilnehmer sich aus den Anzügen schälen – und zwar bitte genau nach Vorschrift!
"Ok... und jetzt... halt, halt, halt! An den Riemen entlang nach hinten in den Nacken, den Riemen lösen und die Schürze nach oben wegnehmen und hier in diesen Behälter rein! Und Hände waschen!"
Immer wieder müssen die Hände – bzw. die Gummihandschuhe – wenn sie Kontakt mit der Außenseite der Schutzkleidung hatten, mit Desinfektionsmitteln abgewaschen werden. Und zwischendurch kommt immer wieder der Mann mit der Spritze und der Chlorlösung.
"Ok ... jetzt die Arme abwinkeln und nach unten ... drehen ... ok, wieder umdrehen ... nächster Schritt ist? Brille! Abnehmen der Brille, genau ... Augen geschlossen, Brille nach unten wegziehen, Kopf nach hinten nehmen – super, und Brille in den schwarzen Eimer ... und die Hände waschen."
Auch diese Prozedur dauert 15 bis 20 lange Minuten – verschwitzt stellt sich anschließend einer der Freiwilligen den Reporterfragen. Steffen ist Leutnant beim Heer - für den 32-Jährigen stand ganz schnell außer Frage, dass er freiwillig nach Afrika gehen wollte.
Das Risiko ist allgegenwärtig
"Als Techniker und Logistiker kann ich da meine Kenntnisse, die mir die Bundeswehr gegeben hat, einbringen – und genau das will ich auch."
Soweit der Leutnant. Aber da gibt es ja auch noch den jungen Mann, Steffen – der muss doch auch ganz persönliche Gründe für dieses Engagement haben.
"Ja – helfen!"
Große Diskussionen mit der Familie gab es trotz des Risikos nicht.
"Da ich ledig – kinderlos bin, habe ich das allein mit mir selbst ausgemacht und habe meine Mutter dann auf der Herfahrt zu diesem Lehrgang über das Telefon informiert."
Und deren Reaktion darauf?
"Natürlich keine große Begeisterung – das ist klar. Aber das wäre dasselbe, wenn ich in irgendeinen anderen Einsatz geschickt werden würde."
Es ist aber nicht irgendein Einsatz – sondern es geht in ein Krisengebiet mit einer Epidemie von bisher nicht bekanntem Ausmaß, mit einem hoch infektiösen Erreger. Dieses Risiko ist allgegenwärtig – auch für Claudia, Tropenmedizinerin am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. Die 36-Jährige hat bereits eine Ebola-Patienten in Hamburg mitbehandelt. Im Gegensatz zum Leutnant spricht sie es offen aus:
"Ich denke Angst hat jeder von uns – und das wäre auch nicht natürlich, ruhig und gleichgültig jetzt in diesen Einsatz zu gehen. Trotzdem muss man sagen, wir müssen natürlich auch unsere Emotionen da etwas kontrollieren, aber trotzdem bleibt natürlich ein Unwohlsein, eine Unsicherheit, ja."
Und genau dieses Unwohlsein, diese Unsicherheit – die sollen mit dem intensiven Training in Appen möglichst ausgeschaltet werden. Deshalb wird vor allem der Umgang mit der Schutzkleidung immer wieder konzentriert geübt – bis wirklich jeder Handgriff sitzt.
"So – Kopfhaube! Schön hinten in die Kopfhaube fassen, nach oben anheben und nach vorne wegnehmen!"