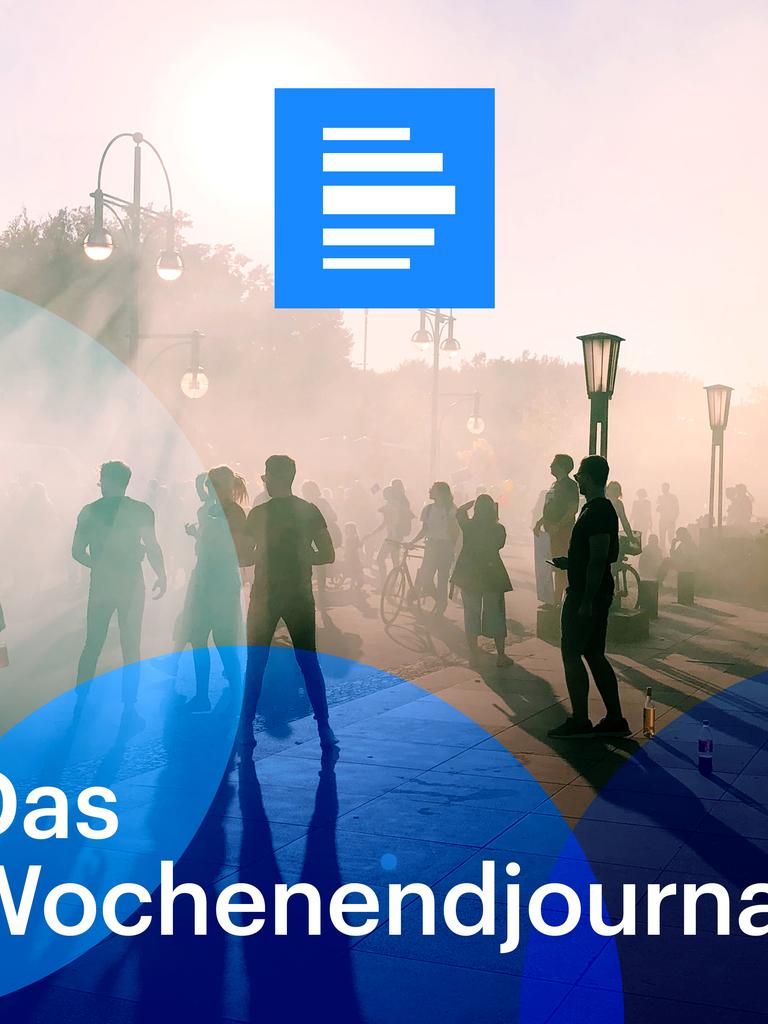Alternative Kirchennutzung

Neue Konzepte sollen ausgestorbene Kirchen in Deutschland wieder zu lebendigen Orten machen. © picture alliance / Fotostand / Matthey
Kampf gegen leere Gotteshäuser

Die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland sinkt, viele Gotteshäuser verwaisen. Doch es gibt Bemühungen, den Trend aufzuhalten: Neue Nutzungsmodelle sollen die ausgestorbenen Sakralbauten wiederbeleben.
Ein runder Teppich, größer als manch Ein-Zimmer-Wohnung, bedeckt die dunkelgrauen Steinfliesen des Kirchenraums. Samtig sieht er aus. Und erstaunlich fleckenlos, bedenkt man, was sich auf ihm Woche für Woche abspielt: Kleinkinder robben über seine rosa Zotteln, die Seniorenyogagruppe trifft sich zum Sonnengruß, Frauen und Männer rekeln sich nach der gemeinsamen Meditation, manche barfüßig und in Sporthosen, andere in Jeans und Shirt.
„Was wir machen, ist der Versuch, eine Verbindung zu schaffen zwischen der Kirche und dem Kiez", beschreibt Pfarrer Moritz Kulenkampff das Programm in der Genezarethkirche in Berlin-Neukölln. Eine Verbindung zwischen einem Gotteshaus, das immer mehr zu verwaisen drohte, und dem dynamischen Leben außerhalb seiner Mauern.
Verwaiste Gotteshäuser
Wie der Genezarethkirche geht es zahlreichen Gotteshäusern im Land. Die hiesigen Kirchen werden immer leerer, die Zahl ihrer Mitglieder sinkt stetig. Seit 2022 gehören erstmals nur noch weniger als die Hälfte der Bundesbürger einer der beiden großen christlichen Kirchen an.
Noch geringer ist die Zahl der aktiven Christen. Laut einer Studie der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) gelten nur 13 Prozent der Bevölkerung als kirchlich-religiös, besucht etwa häufig Gottesdienste oder engagiert sich in der Gemeinde. Die Folge: Immer mehr Sakralbauten verwaisen. Doch es gibt Bemühungen, den Trend aufzuhalten und ausgestorbene Gotteshäuser wiederzubeleben.
Kirche als „lebendiger Raum“
Auch in Berlin-Neukölln ist man überzeugt: Kirche kann mehr als Kanzelpredigt und Orgelmusik. Und sie muss mehr, will sie wieder ein relevanter Ort für die Menschen werden. Anfang 2021 riefen die Kirchenkreise Neukölln und Tempelhof-Schöneberg deshalb das Projekt „Startbahn“ ins Leben. Ihr Ziel: Kirche als „einen lebendigen, öffentlichen Raum“ erlebbar machen.
Und zwar, so der Anspruch, mit einem Angebot, das möglichst viele im Kiez erreicht. Getaufte ebenso wie Menschen ohne Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft oder mit einer anderen Konfession. Im Kalender stehen deshalb neben Familiengottesdiensten Termine wie Konzerte und Ausstellungen, Achtsamkeitszeremonien und Meditationen.

Teppich statt Kirchenbank: Ein Pop-up-Tauffest an Ostern 2023 in der Genezarethkirche in Berlin-Neukölln.© picture alliance / epd-bild / Hans Scherhaufer
Das rote Backsteingebäude mit den neogotischen Spitzbogenfenstern steht auf dem Herrfurthplatz, dem Dreh- und Angelpunkt des Schillerkiezes in Berlins bevölkerungsreichstem Bezirk. Einst als Quartier für Besserverdienende angelegt, ist das Gründerzeitviertel heute Wohnort für Menschen verschiedenster Herkunft, für Studierende, junge Familien, Zugezogene, und gilt schon länger als eines der besonders gefragten Viertel der Hauptstadt. Der britische „Guardian“ nannte den Kiez vor ein paar Jahren gar eines der angesagtesten Viertel Europas.
Doch während der Schillerkiez immer beliebter wurde, nahm das Interesse an der Kirche in seiner Mitte weiter ab. „Ihr fehlte die Perspektive“, sagt Pfarrer Kulenkampff. Das Gotteshaus war zu einem Ort geworden, der den Anschluss verloren hatte – obgleich er doch mittendrin war. Ein Schicksal, das die Genezarethkirche mit vielen Sakralbauten hierzulande teilt.
Weniger Gläubige, weniger Geld
In Deutschland gibt es mehr als 40.000 Kirchen. Doch etwa jedes dritte kirchliche Gebäude dürfte in den nächsten rund 40 Jahren aufgegeben werden. So prognostizieren es ein evangelischer und ein katholischer Baurechtsexperte in einem gemeinsamen Positionspapier. Vornehmlich seien Pfarr- und Gemeindehäuser betroffen, aber zunehmend auch Kirchen. Es fehlt ihnen an Gläubigen, und am Geld. Denn sinken die Mitgliederzahlen, sinken auch die Einnahmen.
Thomas Frings, Finanzdezernent beim Bistum Limburg, sagte im 2023 in der FAZ: "Wir gehen davon aus, dass wir 2060 weniger als 50 Prozent unserer bisherigen finanziellen Mittel zur freien Verfügung haben werden." Die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs erklärte im Mai 2024: „Wir werden eine kleinere und ärmere Kirche, dieser Tatsache müssen wir uns stellen.“
„Geht weit über den Bedarf hinaus“
Altes Mauerwerk, hohe Instandhaltungskosten. Fast überall in den kirchlichen Haushalten sind die Gebäude der zweitgrößte Posten. Im Positionspapier heißt es: „Eine überwältigende Anzahl kirchlicher Immobilien kann und soll nicht mehr gehalten werden.“ Der Bestand gehe weit über den künftigen Bedarf hinaus. Dabei haben die Protestanten in den vergangenen drei Jahrzehnten bereits 700 solcher Bauten aufgegeben. Die Katholiken mehr als 500.
Ein Großteil der Sakralbauten steht unter Denkmalschutz. Um den Gebäuden wieder Leben einzuhauchen, erhalten immer mehr von ihnen einen neuen Nutzen. Entweder, indem sie profaniert, also entwidmet werden, und nun zum Beispiel als Wohnraum, Restaurant, Synagoge oder gar als Sparkassenfiliale fungieren. Oder indem sie neben ihrer sakralen Funktion zusätzlich eine profane erhalten. Also weiterhin eine Kirche sind, aber darüber hinaus zum Beispiel auch Eventraum oder Bibliothek.

In der ehemaligen Martini-Kirche in Bielefeld eröffnete 2005 das Restaurant "Glück und Seligkeit"© picture alliance / epd-bild / Norbert Neetz
Laut Matthias Hoffmann-Tauschwitz vom Kirchlichen Bauamt der Evangelischen Kirche waren Kirchen, zumindest nach evangelischem Verständnis, eigentlich schon immer für alles Mögliche außer für den Gottesdienst gut: „Da fand Markt statt, da fanden Sitzungen statt, da fanden Gerichtsverhandlungen statt und dergleichen mehr.“
Andere Länder, etwa die Niederlande, Frankreich oder Großbritannien, seien in diesem Punkt „sehr viel radikaler, sehr viel weiter“. Hierzulande werde hingegen erst seit einem knappen halben Jahrhundert darüber nachgedacht, „dass man eigentlich viel zu viele Kirchen hat“. Riesige Gebäude, die geheizt und instand gehalten werden müssten.
"Da gingen alle Alarmsignale auf Rot"
Im Fall der Genezarethkirche sorgte ein Ereignis vor ungefähr vier Jahren für den Sinneswandel. Genauer gesagt, ein Ereignis, das nie stattgefunden hat: die Wahl zum Gemeindekirchenrat. Denn es hatten sich nicht genügend Menschen gefunden, die sich zur Wahl aufstellen lassen wollten. „Da gingen alle Alarmsignale auf Rot“, so Kulenkampff. Statt eines neuen Wahltermins entschied man sich für einen anderen Weg: Man schmiss die dunklen Holzbänke raus, legte Teppich und Sitzkissen aus, strich die Emporen in bunten Farben.
Dabei ist die Genezarethkirche weiterhin ein Gotteshaus, sie bietet weiter ein spirituelles Angebot. Nur wird sie eben auch für andere, für gesellschaftspolitische und kulturelle Ideen genutzt. Um ihr Programm zu ermöglichen, ist die "Startbahn" auf Projektförderung angewiesen, dazu kommen Spenden und Mieteinnahmen. So findet hier auch mal ein Firmendinner statt oder ein Kongress-Abend.
Räume und Kosten teilen
Aus Sicht des EKD-Kulturbeauftragten Johann Hinrich Claussen kann das ein Weg für die Zukunft sein: Kirchen bleiben als Gemeinwesenhäuser erhalten, „aber wir öffnen sie auch für andere und versuchen, die Verantwortung zu teilen“. Das sei besser, als kirchliche Problemimmobilien komplett aufzugeben, zu verkaufen, womöglich abzureißen und Orte ohne Gotteshäuser zu hinterlassen, meint Claussen. Oder etwas zu behalten, das sich allein nicht finanzieren lasse.
In Berlin-Neukölln betont Pfarrer Kulenkampff: Das Projekt "Startbahn" sei nicht die Patentlösung für Kirche im Allgemeinen, die Genezarethkirche kein „Abziehbild“ für andere verwaiste Sakralbauten im Land. „Wir sagen nicht: Reißt überall die Bänke raus und rollt einen Teppich aus.“ Vielmehr gehe es darum, dass die Kirche offen sei für das, was um sie herum passiert, für die Bedürfnisse der Menschen vor Ort.
irs