Regie: Beatrix Ackers
Technik: Christiane Neumann
Redakteur: Carsten Burtke
Sprecher: Mirko Böttcher
Was gilt als krank, was nicht?
29:59 Minuten
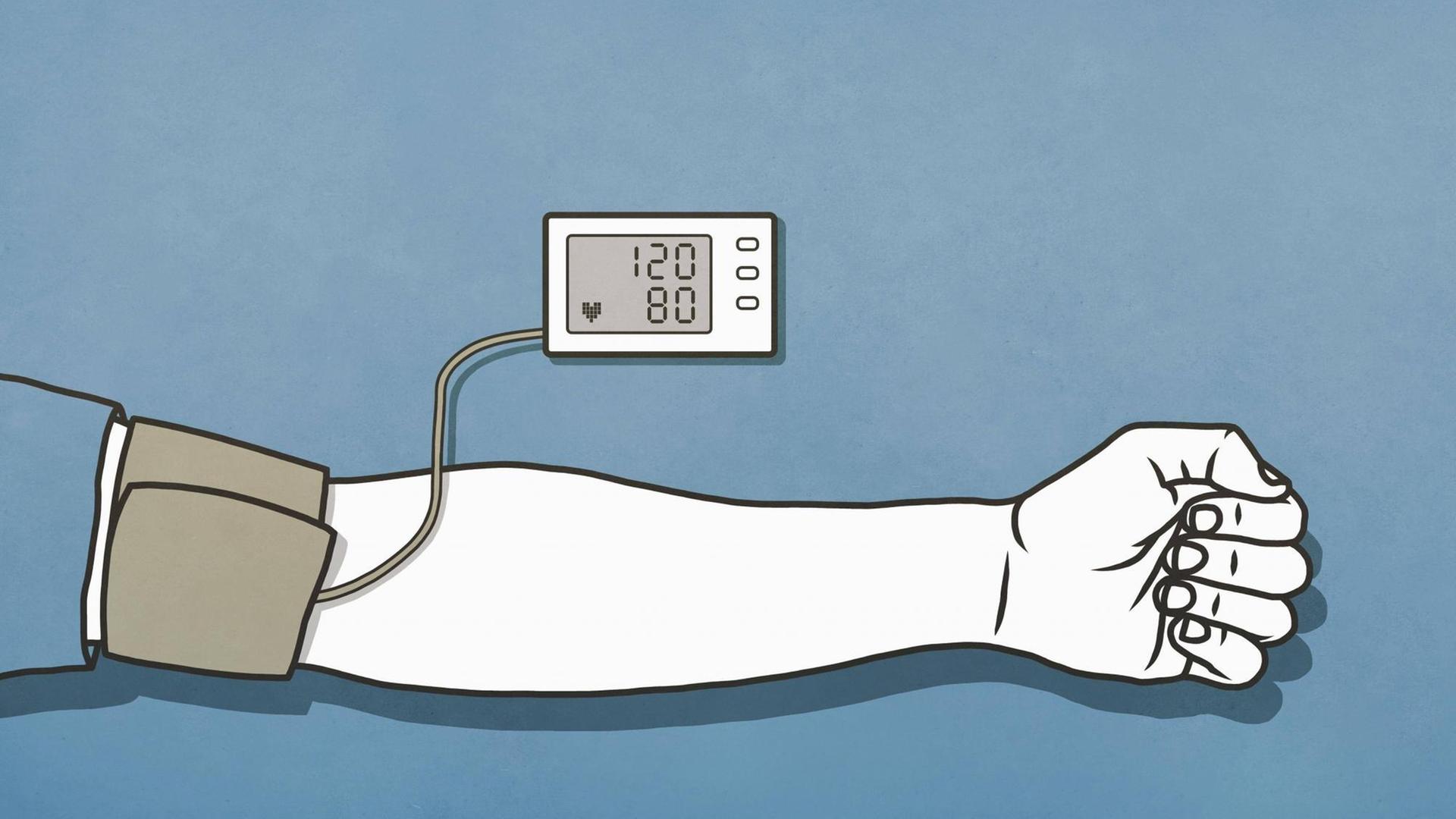
Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten (ICD) legt fest, was als Krankheit gilt und was nicht. Das kann große Auswirkungen auf Diagnose und Behandlung haben. Wie entsteht die Klassifikation und wer nimmt dabei Einfluss?
"Bei uns ist klar, jemand hat Fieber, weil er Fieber gemessen hat. Es ist über eine gewisse Grenze rüber, also zack, Kind darf nicht in die Schule, man legt sich ins Bett und kuriert sich aus und geht nicht zur Arbeit. Aber, dass man Fieber misst, macht man als Privatperson erst knapp 120 Jahre und davor hat man das Ganze normal klassisch mit Handauflegen gemacht. Aber noch einmal Hundert Jahre früher, um 1800, war Fieber ein Pluralbegriff. Es gab nicht nur ein Fieber, sondern viele verschiedene Fieber, die sich sehr voneinander unterschieden haben – und wo dann der Arzt hauptsächlich durch Pulsfühlen diagnostiziert hat, welche Form des Fiebers das eigentlich ist."
Krankheiten im 18. Jahrhundert kaum erforscht
Fieber war früher eine Gefühlssache des Arztes, meint die Medizin-Historikerin Nadine Metzger. Wie auch die Todesursache. Bei einem Arzt stirbt der Patient an Fieber, weil Gott es so will. Beim anderen, weil die Körpersäfte aus dem Gleichgewicht sind. Und ein dritter Arzt vermutet, dass Bakterien oder Viren damit zu tun haben.
Im 18. Jahrhundert sind Krankheiten und Todesursachen noch kaum erforscht. Aber die Grundideen der Aufklärung setzen sich mehr und mehr durch. Dazu gehörte die Erkenntnis, "dass man die Natur geistig komplett erschließen kann. Und die Idee war: Wenn das mit Pflanzen geht und vielleicht auch mit Tieren, dann müsste das doch auch mit Krankheiten gehen."
Gesundheit als Mittel zum Zweck
Während Naturwissenschaftler untersuchen, welche Pflanzenarten und wie viele davon es in einem Land gibt, versuchen Mediziner zum ersten Mal dasselbe mit Krankheiten. Dabei geht es zunächst aber weniger um das Wohl der Menschen. Deren Gesundheit war vielmehr Mittel zum Zweck.
Um im 18. Jahrhundert bei den zahlreichen militärischen Auseinandersetzungen mit anderen Ländern konkurrenzfähig zu sein, will jeder europäische Herrscher eine große gesunde Bevölkerung – und vor allem viele wehrfähige Männer: "Das fängt damit an, dass geguckt wird, wie kann man die Kindersterblichkeit senken. Und für diese Idee, dass man sein Volk zahlenmäßig hochhalten möchte, dafür ist die Statistik ein wichtiges Werkzeug."
Statistische Ämter in Europa entstehen
In ganz Europa werden damals statistische Ämter gegründet. Woran die Menschen sterben, darüber herrscht unter den europäischen Mediziner nur bei Infektionskrankheiten Einigkeit.
In Deutschland sterben in dieser Zeit – das zeigen die Erhebungen – die meisten Menschen an Tuberkulose, Durchfall oder der Pest.
Immer häufiger wird in diesem Zusammenhang auch über die Notwendigkeit einer "Medicinischen Policey" gesprochen. Es sind die Anfänge einer staatlichen Gesundheitspolitik. Deren Ziel es beispielsweise ist, den Ausbruch und die Verbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern.
In Deutschland sterben in dieser Zeit – das zeigen die Erhebungen – die meisten Menschen an Tuberkulose, Durchfall oder der Pest.
Immer häufiger wird in diesem Zusammenhang auch über die Notwendigkeit einer "Medicinischen Policey" gesprochen. Es sind die Anfänge einer staatlichen Gesundheitspolitik. Deren Ziel es beispielsweise ist, den Ausbruch und die Verbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern.
Es muss ein weiteres Jahrhundert vergehen, bis sich die europäischen Länder auf eine Nomenklatur der Todesursachen verständigen. Erst 1900 wird auf einer internationalen Konferenz in Paris ein solches Verzeichnis für verbindlich erklärt. Doch dann folgen zwei Weltkriege. Und das Verzeichnis wird bis 1945 kaum oder gar nicht gepflegt.
"Da war dann nach dem Krieg zufälligerweise die WHO gegründet, und dann dachte man: Das ist ja so ein Projekt, das ist perfekt für eine internationale Organisation wie die WHO. Also geben wir doch diesen ‚ongoing Process‘ von der Verbesserung der Klassifizierungssysteme an die WHO."
"Für die Beobachtung der Wirksamkeit von Gesundheitsmaßnahmen braucht es eben irgendetwas, das erlaubt zu zählen. Unabhängig von der Sprache, unabhängig vom Land auf eine Art und Weise, dass man eben Gesundheitsstatistiken bekommt, sodass dann Land A sich überlegen kann, warum sind meine Muster von Krankheiten so viel anders als im Land B? Und beide Länder sind benachbart, haben eine ähnliche Infrastruktur und Wohlstandsniveau", erklärt Robert Jakob den heutigen Zweck des Verzeichnisses. Er ist Gruppenleiter der WHO für Klassifikationen von Krankheiten und Todesursachen.
"Da war dann nach dem Krieg zufälligerweise die WHO gegründet, und dann dachte man: Das ist ja so ein Projekt, das ist perfekt für eine internationale Organisation wie die WHO. Also geben wir doch diesen ‚ongoing Process‘ von der Verbesserung der Klassifizierungssysteme an die WHO."
"Für die Beobachtung der Wirksamkeit von Gesundheitsmaßnahmen braucht es eben irgendetwas, das erlaubt zu zählen. Unabhängig von der Sprache, unabhängig vom Land auf eine Art und Weise, dass man eben Gesundheitsstatistiken bekommt, sodass dann Land A sich überlegen kann, warum sind meine Muster von Krankheiten so viel anders als im Land B? Und beide Länder sind benachbart, haben eine ähnliche Infrastruktur und Wohlstandsniveau", erklärt Robert Jakob den heutigen Zweck des Verzeichnisses. Er ist Gruppenleiter der WHO für Klassifikationen von Krankheiten und Todesursachen.
Erstes Klassifikationssystem durch die WHO
Schließlich ist es die junge Weltgesundheitsorganisation, der es nach Ende des Zweiten Weltkrieges gelingt, alle Todesursachen, als auch Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme weltweit statistisch einheitlich zu erfassen und zu klassifizieren. Die International Classification of Deseases (ICD) ist seitdem das weltweit geltende Klassifikationssystem.
Es setzt sich heute aus insgesamt 55.000 Einträgen zusammen. Jeder Eintrag darin besteht aus einer Diagnoseziffer, die sich einem Krankheitsbild zuordnen lässt und ordnet dieses wiederum einem Typ von Krankheit zu.
"Das ist eine Baumstruktur, die sozusagen von einem gemeinsamen Stamm, das nennen wir mal der ICD, sich in Kapiteln aufteilt. Von denen eines sich mit Infektionskrankheiten beschäftigt, das nächste mit Krebssorten. Und ähnlich Unterteilungen gibt es auch für die restlichen Erkrankungen."
Für Deutschland haben die Auswertungen der WHO 2021 beispielsweise ergeben, dass die häufigste Todesursache Krebs ist, oder, dass Demenz mittlerweile zu einer der zehn häufigsten Todesursachen zählt. "Und das triggert häufig Reaktionen auf politischer Ebene, auf Seiten der gesetzgeberischen Maßnahmen oder auch eben in akuten Gesundheitsmaßnahmen. Momentan fokussieren sich viele Menschen auf Covid-19 als Pandemie. Das ist zurzeit relativ einfach, weil es ja nur eine Krankheit gibt. Aber es gibt eben noch ganz viele andere Krankheiten, bei denen man das auch macht."

Hauptsitz der WHO in Genf: Die Organisation wird mit der Aufgabe beauftragt, eine Klassifikation der Krankheiten zu erstellen.© AFP / Fabrice Coffrini
Zu wenige Rückmeldungen zu Todesumständen
Um Todesursachen besser verstehen und bekämpfen zu können, wäre es aus Sicht von Jakob wichtig, dass die WHO aus den verschiedenen Ländern auch Rückmeldungen zu den Todesumständen der Menschen bekommt. "Mal nachlässig gesagt, dass wenn man stirbt, man an einem Herzstillstand stirbt, ist trivial und fördert nicht unbedingt die Erkenntnisse in der Gesundheit einer Bevölkerung. Sondern es wäre schon schöner, wenn jemand sagte, wodurch denn dieser Herzstillstand herbeigeführt wurde. Das kann durch einen Messerstich wie auch durch einen Herzinfarkt sein. Alles ist möglich."
Zehn Auflagen hat es seit Einführung des Internationalen Klassifizierungssystems von Krankheiten inzwischen gegeben. Robert Jakob ist mitverantwortlich für die elfte Auflage der ICD, die im kommenden Jahr in Kraft tritt. Ab 2022 ist sie die offizielle Nomenklatur, mit der Krankheiten und Todesursachen von der WHO gezählt werden.
Zehn Auflagen hat es seit Einführung des Internationalen Klassifizierungssystems von Krankheiten inzwischen gegeben. Robert Jakob ist mitverantwortlich für die elfte Auflage der ICD, die im kommenden Jahr in Kraft tritt. Ab 2022 ist sie die offizielle Nomenklatur, mit der Krankheiten und Todesursachen von der WHO gezählt werden.
Schlaganfall künftig der Neurologie zugeordnet
Ein Fachbereich wird mit der kommenden Version schlagartig höhere Todeszahlen zu verzeichnen haben: die Neurologie. Zu den Erkrankungen des Nervensystems zählt dann nämlich auch der Schlaganfall.
Bei einem Schlaganfall reißt oder verstopft ein Gefäß im Gehirn. In beiden Fällen wird die Region dahinter nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, und es kommt zu Ausfällen im Gehirn. Bisher galt der Schlaganfall als eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Bei einem Schlaganfall reißt oder verstopft ein Gefäß im Gehirn. In beiden Fällen wird die Region dahinter nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, und es kommt zu Ausfällen im Gehirn. Bisher galt der Schlaganfall als eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Dass diese Zuordnung nicht stimmt, wusste schon in den 1980ern ein junger Neurologe in Minden. "Bevor ich kam, wurden die Schlaganfälle alle in der medizinischen Klinik behandelt. Ich habe dann gesagt, das ist eine neurologische Krankheit! Ich werde die in Zukunft behandeln! Das ist auf Widerstände gestoßen. Hat sich aber dann durchgesetzt."
Nach Ansicht von Otto Busse haben die Folgen eines geplatzten Gefäßes im Gehirn mehr Einfluss auf das Nervensystem als auf Herz und Kreislauf. Als Busse schließlich 1983 Chefarzt der Neurologie in Minden wird, behandelt er fortan auch Schlaganfallpatienten auf seiner Station. "Das war nicht einfach, die Patienten aus der inneren Medizin heraus zu bekommen. Der dortige Spezialist für die Kardiologie, der hat das schon nicht so gerne gesehen."

Früher galt der Schlaganfall als Herz-Kreislauf-, heute als neurologische Erkrankung. Das wirkt sich auf die Behandlung der Patienten aus.© dpa / Friso Gentsch
Akute Erkrankungen meist internistisch behandelt
Sein Argument dabei: Welche Schäden das geplatzte Gefäß im Gehirn anrichtet, das kann nur ein Neurologe schnell feststellen. Damit stößt er sogar bei seinen Kollegen auf Skepsis.
"Man muss sagen, dass die Neurologen der alten Schule eigentlich nicht gewohnt waren, Patienten akut zu versorgen. Die Neurologie war ein sehr konservatives Fach. Und alles, was akut war – selbst akute Hirnhautentzündungen -, die kamen überwiegend in eine internistische Klinik."
Nach und nach kann sich Otto Busse aber durchsetzen und erreicht schließlich, dass ein Schlaganfall bereits in der Akutphase von einem Neurologen untersucht werden muss.
"Wenn man zurückdenkt, so 50 Jahre, dann war ja ein Patient mit Schlaganfall primär seinem Schicksal insofern ausgeliefert, als dass es zielgerichtete Behandlungen in diesem Sinne kaum gab. Wohingegen heutzutage mit schneller Diagnostik, fachlich neurologischer und radiologischer Beurteilung man sich sehr schnell ein Bild machen kann und muss", begründet Robert Jakob von der WHO den Wechsel des Schlaganfalls in ein anderes Fachgebiet und hebt in diesem Zusammenhang vor allem die Bedeutung von Stroke Units hervor.
"Man muss sagen, dass die Neurologen der alten Schule eigentlich nicht gewohnt waren, Patienten akut zu versorgen. Die Neurologie war ein sehr konservatives Fach. Und alles, was akut war – selbst akute Hirnhautentzündungen -, die kamen überwiegend in eine internistische Klinik."
Nach und nach kann sich Otto Busse aber durchsetzen und erreicht schließlich, dass ein Schlaganfall bereits in der Akutphase von einem Neurologen untersucht werden muss.
"Wenn man zurückdenkt, so 50 Jahre, dann war ja ein Patient mit Schlaganfall primär seinem Schicksal insofern ausgeliefert, als dass es zielgerichtete Behandlungen in diesem Sinne kaum gab. Wohingegen heutzutage mit schneller Diagnostik, fachlich neurologischer und radiologischer Beurteilung man sich sehr schnell ein Bild machen kann und muss", begründet Robert Jakob von der WHO den Wechsel des Schlaganfalls in ein anderes Fachgebiet und hebt in diesem Zusammenhang vor allem die Bedeutung von Stroke Units hervor.
In Deutschland ist es nicht zuletzt Otto Busse, dem Gründer der Deutschen Schlaganfallgesellschaft, zu verdanken, dass diese spezielle Abteilung für die schnelle Behandlung von Schlaganfällen seit Mitte der 1990er-Jahre eingerichtet wurden. Mehr als 300 dieser Einheiten gibt es hier inzwischen. Ein Spitzenwert im internationalen Vergleich.
Trotz dieser medizinischen Fortschritte und trotz der Einordnung des Schlaganfalls in der Gruppe der neurologischen Erkrankungen bedeutet das nicht automatisch, dass künftig nur noch Neurologen die Behandlung übernehmen. Die ICD kann in dieser Hinsicht lediglich Empfehlungen aussprechen. Wie eine Erkrankung zu behandeln ist, schreibt das Gesundheitssystem des jeweiligen Landes vor.
Trotz dieser medizinischen Fortschritte und trotz der Einordnung des Schlaganfalls in der Gruppe der neurologischen Erkrankungen bedeutet das nicht automatisch, dass künftig nur noch Neurologen die Behandlung übernehmen. Die ICD kann in dieser Hinsicht lediglich Empfehlungen aussprechen. Wie eine Erkrankung zu behandeln ist, schreibt das Gesundheitssystem des jeweiligen Landes vor.
Eigenes Kapitel für Erkrankungen des Immunsystems
Dass eine Erkrankung das Fachgebiet wechselt, kommt äußerst selten vor. Fast nie kommt es vor, dass das Klassifikationssystem ein neues Kapitel erhält. Die elfte Version ist da eine Ausnahme, erklärt Robert Jakob von der WHO: Es wird ein eigenes Kapitel für Erkrankungen des Immunsystems geben.
"Wo dann zum ersten Mal, selbst bei den höheren statistischen Zusammenfassungen man sehen kann, wer stirbt denn eigentlich an Krankheiten des Immunsystems? Das ist früher in den alten Statistiken immer irgendwie verschwunden. Und das ist jetzt da!"
Es geht aber auch um andere, weniger schwere Erkrankungen. So hat man festgestellt, dass eine ganze Reihe von Krankheiten – zum Beispiel die Schuppenflechte – immunologische Ursachen hat.
"Dann gibt es natürlich den ganzen Bereich der Allergene, wo man früher gesagt hat, wir suchen das Allergen. Und da war dann die Entscheidung aller beteiligten Gruppen, dass es Sinn macht, die Krankheit, die den ganzen Körper und das Immunsystem betreffen, die in ein eigenes Kapitel zu verschieben, sodass man die genauer untersuchen kann."
"Wo dann zum ersten Mal, selbst bei den höheren statistischen Zusammenfassungen man sehen kann, wer stirbt denn eigentlich an Krankheiten des Immunsystems? Das ist früher in den alten Statistiken immer irgendwie verschwunden. Und das ist jetzt da!"
Es geht aber auch um andere, weniger schwere Erkrankungen. So hat man festgestellt, dass eine ganze Reihe von Krankheiten – zum Beispiel die Schuppenflechte – immunologische Ursachen hat.
"Dann gibt es natürlich den ganzen Bereich der Allergene, wo man früher gesagt hat, wir suchen das Allergen. Und da war dann die Entscheidung aller beteiligten Gruppen, dass es Sinn macht, die Krankheit, die den ganzen Körper und das Immunsystem betreffen, die in ein eigenes Kapitel zu verschieben, sodass man die genauer untersuchen kann."
Auch Lobbyarbeit führt zu Neueinträgen im ICD
Einträge in der ICD spiegelten immer den aktuellen Wissenstand der Medizin wider, sagt Jakob. Wer aber sorgt schließlich dafür, ob ein neuer Eintrag in die ICD kommt? "Da sind sehr verschieden Gruppierungen mit dabei", meint die Medizinhistorikerin Nadine Metzger. "Teilweise nehmen da auch einfach Patientenorganisationen, also Lobbygruppen Einfluss. Es gibt Fälle, in denen das sehr erfolgreich ist. Aber dann haben die richtigen Leute an der richtigen Stelle erfolgreich Lobbyarbeit gemacht. Am besten funktioniert das, wenn diese Lobbygruppe einen guten Fuß in der ärztlichen Community hat."
Zum Schlaganfall wurden so über Jahre wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen, und gesellschaftliche Gruppierungen wie die Schlaganfallgesellschaften haben Vorschläge eingereicht.
Das sei immer wieder der Fall, erklärt Robert Jakob. "Natürlich haben Personengruppen Einfluss auf Einträge, weil das, was mit der Klassifikation dargestellt wird, schon auch einen Einfluss hat auf die Einteilung, ob man krank ist oder nicht krank ist, ob man eine Behandlung braucht, möglicherweise sogar, was für Behandlungsansätze richtig sind. Von daher spielt das eine große Rolle."
Die Vorschläge werden dann von internationalen Arbeitsgruppen der WHO für die entsprechenden Krankheiten geprüft und gegebenenfalls aufgenommen.
Zum Schlaganfall wurden so über Jahre wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen, und gesellschaftliche Gruppierungen wie die Schlaganfallgesellschaften haben Vorschläge eingereicht.
Das sei immer wieder der Fall, erklärt Robert Jakob. "Natürlich haben Personengruppen Einfluss auf Einträge, weil das, was mit der Klassifikation dargestellt wird, schon auch einen Einfluss hat auf die Einteilung, ob man krank ist oder nicht krank ist, ob man eine Behandlung braucht, möglicherweise sogar, was für Behandlungsansätze richtig sind. Von daher spielt das eine große Rolle."
Die Vorschläge werden dann von internationalen Arbeitsgruppen der WHO für die entsprechenden Krankheiten geprüft und gegebenenfalls aufgenommen.
Chronische Schmerzen als eigenständige Kategorie
So war es, als es um die Klassifizierung chronischer Schmerzen in der neuen ICD ging. Acht Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen Schmerzen. Doch bisher fehlte ein umfassender Eintrag als eigenständige Erkrankung und damit die Aussicht auf eine richtige Behandlung. Das liege an der Komplexität der Krankheit, meint Antonia Barke. Die Psychologin war Teil der internationalen Arbeitsgruppe, die den Eintrag für chronische Schmerzen in der ICD-11 geschrieben hat.
"Für eine Krankheit gibt es eine Ursache, die sie ausführt. Wenn ich die heilen will, beseitige ich nach Möglichkeit die Ursache, und dann gehen die Krankheit weg und auch die Symptome, die damit einhergehen. Zum Beispiel: Wenn Sie sich jetzt ein Bein brechen, dann tut es doll weh, dann muss man sich um das Bein kümmern, muss es schienen, vielleicht auch einfach schonen. Und dann, wenn es abgeheilt ist, dann sind die Schmerzen – Symptome – auch wieder weg. Bei chronischen Schmerzen passt das jetzt leider weniger gut."
Zwar werden in der momentan noch gültigen ICD chronische Schmerzen aufgeführt, die beispielsweise durch eine Verletzung oder Operation hervorgerufen wurden. Einen Eintrag für Schmerzen mit anderen Ursachen gibt es bisher noch nicht. Und das hat Folgen für viele Patienten.
Claudia geht vor drei Jahren im Park mit Freunden spazieren, als sie plötzlich einen heftigen Schmerz im Knie fühlt. "So ein Gefühl, als wenn dir etwas in den Rücken schießt. Ich glaube, das kennen die meisten. Und so hat es sich dann angeführt: Als würde irgendetwas in mein Bein reinfahren. Und bin ich auf den Boden gefallen, weil ich ja nicht mehr weiterlaufen konnte. Auf jeden Fall war mein Bein in so einer gebeugten Position, und ich konnte es nicht mehr strecken. Im Kniegelenk war es einfach total fest, und ich konnte es auch nicht mehr bewegen. Dann haben die Muskeln angefangen, alle total fest zu werden, und dann konnte ich gar nichts mehr machen. Es hat sich angefühlt wie ein extrem schmerzhafter Krampf."
Freunde rufen den Notarzt, und Claudia wird ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte können aber keine Verletzung feststellen. Sie geben ihr ein Mittel zur Muskelentspannung und schicken sie wieder nach Hause.
Doch der schmerzhafte Krampf kommt in unregelmäßigen Abständen wieder, und Claudia beschließt, sich andere Hilfe zu suchen: "Dann bin ich zu meiner Orthopädin, die konnte auch nichts feststellen. Dann habe ich ein MRT machen lassen, das war negativ. Dann ist es wieder passiert, und ich bin zu einem alten Professor, der ist auch Orthopäde. Er meinte, es kommt eventuell von meinem Rücken, aber er konnte jetzt auch nichts feststellen. Dann ist es wieder aufgetreten. Dann bin ich zu einem Therapeuten in Brandenburg an der Havel, der hat dann auch ganz viele Tests gemacht, der hat mich darauf hingewiesen, dass ich Allergien habe und da mit meinem Magen und Darm in Verbindung gebracht. Es kam raus: Ich habe Lebensmittelallergien."
"Für eine Krankheit gibt es eine Ursache, die sie ausführt. Wenn ich die heilen will, beseitige ich nach Möglichkeit die Ursache, und dann gehen die Krankheit weg und auch die Symptome, die damit einhergehen. Zum Beispiel: Wenn Sie sich jetzt ein Bein brechen, dann tut es doll weh, dann muss man sich um das Bein kümmern, muss es schienen, vielleicht auch einfach schonen. Und dann, wenn es abgeheilt ist, dann sind die Schmerzen – Symptome – auch wieder weg. Bei chronischen Schmerzen passt das jetzt leider weniger gut."
Zwar werden in der momentan noch gültigen ICD chronische Schmerzen aufgeführt, die beispielsweise durch eine Verletzung oder Operation hervorgerufen wurden. Einen Eintrag für Schmerzen mit anderen Ursachen gibt es bisher noch nicht. Und das hat Folgen für viele Patienten.
Claudia geht vor drei Jahren im Park mit Freunden spazieren, als sie plötzlich einen heftigen Schmerz im Knie fühlt. "So ein Gefühl, als wenn dir etwas in den Rücken schießt. Ich glaube, das kennen die meisten. Und so hat es sich dann angeführt: Als würde irgendetwas in mein Bein reinfahren. Und bin ich auf den Boden gefallen, weil ich ja nicht mehr weiterlaufen konnte. Auf jeden Fall war mein Bein in so einer gebeugten Position, und ich konnte es nicht mehr strecken. Im Kniegelenk war es einfach total fest, und ich konnte es auch nicht mehr bewegen. Dann haben die Muskeln angefangen, alle total fest zu werden, und dann konnte ich gar nichts mehr machen. Es hat sich angefühlt wie ein extrem schmerzhafter Krampf."
Freunde rufen den Notarzt, und Claudia wird ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte können aber keine Verletzung feststellen. Sie geben ihr ein Mittel zur Muskelentspannung und schicken sie wieder nach Hause.
Doch der schmerzhafte Krampf kommt in unregelmäßigen Abständen wieder, und Claudia beschließt, sich andere Hilfe zu suchen: "Dann bin ich zu meiner Orthopädin, die konnte auch nichts feststellen. Dann habe ich ein MRT machen lassen, das war negativ. Dann ist es wieder passiert, und ich bin zu einem alten Professor, der ist auch Orthopäde. Er meinte, es kommt eventuell von meinem Rücken, aber er konnte jetzt auch nichts feststellen. Dann ist es wieder aufgetreten. Dann bin ich zu einem Therapeuten in Brandenburg an der Havel, der hat dann auch ganz viele Tests gemacht, der hat mich darauf hingewiesen, dass ich Allergien habe und da mit meinem Magen und Darm in Verbindung gebracht. Es kam raus: Ich habe Lebensmittelallergien."
Schmerzpatienten suchen bei vielen Ärzten Hilfe
"Chronische Schmerzen sind halt so beeinträchtigend und quälend häufig für die Menschen, die sie haben, dass sie natürlich erst Ärzte probieren, vielleicht auch Psychologen. Sie probieren aber häufig alles, was irgendwie Linderung verspricht. Und dann ist es einfach Glückssache und leider manchmal auch Pechsache."
Den meisten Patienten könne kein Arzt wirklich helfen, da keiner eine Verletzung, also die Ursache feststellen könne und jeder nur im eigenen Fachgebiet nach dem Auslöser suche, meint Antonia Barke.
"Wenn Sie sich die ICD ansehen, dann sehen Sie, es gibt lauter einzelne Kapitel. Und die chronischen Schmerzen sind jetzt unter ‚Andere Symptome’ eingeordnet, weil sie eben ein bisschen die Klassifikation – na ja – nicht sprengt, aber es ist eben eine übergreifendere Kategorie."
Forscher gehen davon aus, dass chronische Schmerzen bio-psycho-sozial bedingt sind, also biologische, psychische und soziale Ursachen haben. Mit Schmerztherapien, die unterschiedliche Behandlungsansätze miteinander kombinieren, könnte den Patienten dann geholfen werden, hofft Barke.
Umso wichtiger ist für sie der künftige Eintrag im Klassifikationssystem: "Denn es wird Auswirkungen haben für die einzelnen Patienten. Wobei da noch verhandelt werden muss, wer bezahlt was, wenn ich diese Diagnoseziffer bekomme. Aber es wird auch riesige Auswirkungen haben, wenn wir jetzt daran denken: Es werden Studien gemacht. Was hilft gut gegen den Schmerz?"
Ein entscheidender Aspekt bei der Entwicklung von Therapien bei chronischen Schmerzen wird die psychische Komponente sein.
Den meisten Patienten könne kein Arzt wirklich helfen, da keiner eine Verletzung, also die Ursache feststellen könne und jeder nur im eigenen Fachgebiet nach dem Auslöser suche, meint Antonia Barke.
"Wenn Sie sich die ICD ansehen, dann sehen Sie, es gibt lauter einzelne Kapitel. Und die chronischen Schmerzen sind jetzt unter ‚Andere Symptome’ eingeordnet, weil sie eben ein bisschen die Klassifikation – na ja – nicht sprengt, aber es ist eben eine übergreifendere Kategorie."
Forscher gehen davon aus, dass chronische Schmerzen bio-psycho-sozial bedingt sind, also biologische, psychische und soziale Ursachen haben. Mit Schmerztherapien, die unterschiedliche Behandlungsansätze miteinander kombinieren, könnte den Patienten dann geholfen werden, hofft Barke.
Umso wichtiger ist für sie der künftige Eintrag im Klassifikationssystem: "Denn es wird Auswirkungen haben für die einzelnen Patienten. Wobei da noch verhandelt werden muss, wer bezahlt was, wenn ich diese Diagnoseziffer bekomme. Aber es wird auch riesige Auswirkungen haben, wenn wir jetzt daran denken: Es werden Studien gemacht. Was hilft gut gegen den Schmerz?"
Ein entscheidender Aspekt bei der Entwicklung von Therapien bei chronischen Schmerzen wird die psychische Komponente sein.
Dunkles Kapitel der psychischen Erkrankungen
Psychische Erkrankungen waren lange Zeit ein dunkles Kapitel in der Medizin. Noch bis in die 1960-Jahre machten grausame Behandlungsmethoden wie die Lobotomie Schlagzeilen. Dabei wurde Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen bei vollem Bewusstsein eine Art Eispickel unter dem Augenlied durch die Augenhöhle bis ins Gehirn gerammt, um dort Nervenbahnen zu durchtrennen, die für die Erkrankung verantwortlich sein sollten.
Auch die Schwester des ehemaligen US-Präsidenten, Rosemary Kennedy, wurde dieser Behandlungsmethode unterzogen, erzählt die Medizinhistorikerin Nadine Metzger: "Man muss sehen, dass man zu dieser Zeit völlig hilflos war gegenüber psychischen Erkrankungen. Das Einzige, was man machen konnte, war, die Leute in psychiatrischen Anstalten aufzubewahren. Ihr ganzes Leben lang. Und es ist klar, dass man in einer psychiatrischen Anstalt lieber Patienten hat, die ruhig vor sich hingedämmert haben. Was die meisten lobotomierten Patienten gemacht haben, anstatt aufrührerisch und tobend, also schwer zu kontrollieren zu sein. In der Psychiatrie gibt es ja ganz viele solcher folterartigen Therapieversuche, und das hängt damit zusammen, dass man einfach nichts machen konnte, bis man die ersten Psychopharmaka entwickelt hat."
Das war dann in 1960er- und 1970er-Jahren der Fall. Für die Psychiaterin Carina Borzim eine wichtige Entwicklung für die Behandlung und den Umgang mit Patienten mit psychischen Erkrankungen.
"Wenn man so an die Großeltern-Generation denkt, da war es viel verpönter, psychische Störungen zu haben oder sich überhaupt irgendwie Hilfe zu holen in der Psychiatrie oder bei Psychotherapeutinnen. Das hat sich verändert. Und die depressive Episode ist so weit verbreitet, dass wir alle im Entfernten eine Person kennen, die davon betroffen ist. Das Verständnis ist einfach viel größer, als es damals war. Also, das Verständnis, dass Menschen betroffen sind, aber auch ein gesellschaftliches Verständnis davon, dass es das gibt."
Das war dann in 1960er- und 1970er-Jahren der Fall. Für die Psychiaterin Carina Borzim eine wichtige Entwicklung für die Behandlung und den Umgang mit Patienten mit psychischen Erkrankungen.
"Wenn man so an die Großeltern-Generation denkt, da war es viel verpönter, psychische Störungen zu haben oder sich überhaupt irgendwie Hilfe zu holen in der Psychiatrie oder bei Psychotherapeutinnen. Das hat sich verändert. Und die depressive Episode ist so weit verbreitet, dass wir alle im Entfernten eine Person kennen, die davon betroffen ist. Das Verständnis ist einfach viel größer, als es damals war. Also, das Verständnis, dass Menschen betroffen sind, aber auch ein gesellschaftliches Verständnis davon, dass es das gibt."
Computerspielsucht in der neuen ICD
So gibt es ab 2022 im dann gültigen Klassifikationssystem eine Reihe neuer Einträge mit psychischer Komponente: Trennungsangst als eine Angststörung, Kaufsucht als Impulskontrollstörung oder Internetsucht als eine Verhaltenssucht.
"Es gab ja eine lange Diskussion um die Computerspielabhängigkeit, die auch total nachvollziehbar ist. Gesellschaftlich gesehen sorgt einfach vieles dafür, dass wir viel Zeit am Smartphone, bei Social Media oder beim Spielen verbringen, und dann ist das immer eine Abwägungssache, ab wann das Ganze einen Krankheitswert hat."
Die Psychiaterin ist aber skeptisch, ob eine Einstufung eines gewissen Verhaltens als Krankheit und eine entsprechende Klassifizierung immer hilfreich ist.
"Es gab ja eine lange Diskussion um die Computerspielabhängigkeit, die auch total nachvollziehbar ist. Gesellschaftlich gesehen sorgt einfach vieles dafür, dass wir viel Zeit am Smartphone, bei Social Media oder beim Spielen verbringen, und dann ist das immer eine Abwägungssache, ab wann das Ganze einen Krankheitswert hat."
Die Psychiaterin ist aber skeptisch, ob eine Einstufung eines gewissen Verhaltens als Krankheit und eine entsprechende Klassifizierung immer hilfreich ist.
Ein Eintrag kann auch ein Stigma bedeuten, wie ein Blick in die ICD-Geschichte zeigt. Es habe immer wieder Krankheiten gegeben, bei denen die gesellschaftliche Meinung bei den Einträgen eine wesentliche Rolle gespielt hat, sagt die Historikerin Nadine Metzger.
"Früher gab es mal die Krankheit Hysterie, und das haben Frauenorganisationen in den USA rausgekriegt. Weil sie gesagt haben, das als Frauenkrankheit drinnen zu haben, das ist nicht richtig und würde auch nicht dem Forschungsstand entsprechen. Deswegen hat man das umbenannt oder gesplittet in mehrere verschiedenen Syndrome mit jeweils unterschiedlichen Namen."

Massenphänomen Gaming: Heute ist Spielsucht als Krankheit offiziell anerkannt.© dpa / Geisler-Fotopress
Transsexualität als psychische Krankheit gestrichen
Umstritten war schon lange auch der Eintrag "Transsexualismus", mit dem Menschen mit einer Transidentität als psychisch krank eingestuft wurden. Auch den wird es künftig nicht mehr geben.
"In Bezug auf die Transsexualität, also die Genderinkongruenz, da haben sich Gruppen gemeldet, die Forschung ist vorangeschritten, die Psychiatrie hat gearbeitet, sodass sich herausgestellt hat, dass das nichts ist, wo man sagen kann, das ist eine Krankheit. Sondern das ist etwas Eigenständiges, wo auch nicht primär jemand darunter leidet, aber wo man sagen kann, wer damit ein Problem hat, dem sollte auch geholfen werden."
"In meiner frühen Teenager Zeit, da war ich so elf, 12, da hatten wir damals im Biologie-Unterricht gerade Sexualkunde, und da habe ich erfahren, dass eigentlich alle Teenager in den Stimmbruch kommen. Nur bei den einen fällt die Stimme sehr steil nach unten, vor allem bei den Jungs, und bei den Mädchen nur so ein bisschen. Und ich habe dann auch gemerkt, wie ich manchmal mitten im Satz so durch die Töne gesprungen bin und hab mich dann gefreut: Oh, ja toll, ich komme in den Stimmbruch! Und ich komme in den Stimmbruch der Jungs, weil jetzt wird sich alles doch richtigstellen, jetzt wird sich doch herausstellen, dass das alles ein Irrtum war!"
Jan ist ein Transmann. Geboren mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen, fühlt er sich als Junge immer schon wohler.
"Die Vorstellung, dass sich eine Person nicht mit dem eigenen Körper identifiziert und eine andere Geschlechtsidentität hat, da war einfach nur die Möglichkeit zu sagen: Das ist krank, das passt einfach überhaupt nicht in unsere Norm", meint Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans*.
Während Homosexualität bereits bei den antiken Griechen akzeptiert war, werden Lesben und Schwule in der ICD erst Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr als psychisch krank eingestuft. Und ab 2022 nun auch Transmenschen nicht mehr.
"In Bezug auf die Transsexualität, also die Genderinkongruenz, da haben sich Gruppen gemeldet, die Forschung ist vorangeschritten, die Psychiatrie hat gearbeitet, sodass sich herausgestellt hat, dass das nichts ist, wo man sagen kann, das ist eine Krankheit. Sondern das ist etwas Eigenständiges, wo auch nicht primär jemand darunter leidet, aber wo man sagen kann, wer damit ein Problem hat, dem sollte auch geholfen werden."
"In meiner frühen Teenager Zeit, da war ich so elf, 12, da hatten wir damals im Biologie-Unterricht gerade Sexualkunde, und da habe ich erfahren, dass eigentlich alle Teenager in den Stimmbruch kommen. Nur bei den einen fällt die Stimme sehr steil nach unten, vor allem bei den Jungs, und bei den Mädchen nur so ein bisschen. Und ich habe dann auch gemerkt, wie ich manchmal mitten im Satz so durch die Töne gesprungen bin und hab mich dann gefreut: Oh, ja toll, ich komme in den Stimmbruch! Und ich komme in den Stimmbruch der Jungs, weil jetzt wird sich alles doch richtigstellen, jetzt wird sich doch herausstellen, dass das alles ein Irrtum war!"
Jan ist ein Transmann. Geboren mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen, fühlt er sich als Junge immer schon wohler.
"Die Vorstellung, dass sich eine Person nicht mit dem eigenen Körper identifiziert und eine andere Geschlechtsidentität hat, da war einfach nur die Möglichkeit zu sagen: Das ist krank, das passt einfach überhaupt nicht in unsere Norm", meint Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans*.
Während Homosexualität bereits bei den antiken Griechen akzeptiert war, werden Lesben und Schwule in der ICD erst Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr als psychisch krank eingestuft. Und ab 2022 nun auch Transmenschen nicht mehr.
"Es sind auch viele Transpersonen sicherlich beteiligt gewesen, die Druck aufgebaut haben und gesagt haben: So kann das nicht sein! Ich würde das aber nicht unbedingt als Lobbyarbeit bezeichnen, sondern eher als menschenrechts-basierte Interessensvertretung."
Der Bundesverband-Trans* schätzt, dass in Deutschland bis zu 100.000 Menschen eine Transidentität haben. Und bei jeder und jedem einzelnen ist sie anders ausgeprägt.
"Ich weiß am Ende nicht, wie es ist, Frau zu sein. Ich weiß auch nicht, wie es ist, Mann zu sein. Ich kenne nur, wie es ist, ich zu sein. Und es ist am Ende ganz schwierig einzuordnen, ob sich das jetzt mehr in der männlichen oder in der weiblichen Kategorie befindet. Ich lebe einfach irgendwie so vor mich hin, wie ich es halt für richtig halte. Und von außen wird das Ganze dann mal als männlich und als weiblich kategorisiert. Aber für mich spielt das ehrlich gesagt kaum eine Rolle."
Der Bundesverband-Trans* schätzt, dass in Deutschland bis zu 100.000 Menschen eine Transidentität haben. Und bei jeder und jedem einzelnen ist sie anders ausgeprägt.
"Ich weiß am Ende nicht, wie es ist, Frau zu sein. Ich weiß auch nicht, wie es ist, Mann zu sein. Ich kenne nur, wie es ist, ich zu sein. Und es ist am Ende ganz schwierig einzuordnen, ob sich das jetzt mehr in der männlichen oder in der weiblichen Kategorie befindet. Ich lebe einfach irgendwie so vor mich hin, wie ich es halt für richtig halte. Und von außen wird das Ganze dann mal als männlich und als weiblich kategorisiert. Aber für mich spielt das ehrlich gesagt kaum eine Rolle."
Was Jan relativ entspannt sieht, kann für viele Transpersonen einen Leidensdruck bedeuten, sagt Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans*.
Um die äußerlichen Merkmale an die eigene Identität anzugleichen, lassen Transpersonen entweder den Namen ändern oder chirurgische Eingriffe und hormonelle Therapien vornehmen.
"Bisher war es lange Zeit so, dass Transpersonen, bevor sie eine Hormontherapie beginnen konnten, eine Zwangspsychotherapie über sich ergehen lassen mussten. Sie mussten ein halbes Jahr psychotherapeutisch in Behandlung sein, bevor eine Hormontherapie begonnen werden konnte. Das ist etwas, das wir als Verband ganz klar kritisieren, weil wir sagen: Psychotherapie, das muss freiwillig sein!"
Um die äußerlichen Merkmale an die eigene Identität anzugleichen, lassen Transpersonen entweder den Namen ändern oder chirurgische Eingriffe und hormonelle Therapien vornehmen.
"Bisher war es lange Zeit so, dass Transpersonen, bevor sie eine Hormontherapie beginnen konnten, eine Zwangspsychotherapie über sich ergehen lassen mussten. Sie mussten ein halbes Jahr psychotherapeutisch in Behandlung sein, bevor eine Hormontherapie begonnen werden konnte. Das ist etwas, das wir als Verband ganz klar kritisieren, weil wir sagen: Psychotherapie, das muss freiwillig sein!"
Geschlechtsinkongruenz als neuer Eintrag
Mit der ICD-11 wird der Eintrag "Geschlechtsinkongruenz" heißen und soll keine Pathologisierung mehr zur Folge haben: In Deutschland entfällt dann bei einer Hormontherapie zwar die Psychotherapie, sie ist aber nach wie vor verpflichtend bei einem chirurgischen Eingriff und wird in der Regel von den Krankenkassen vor der Kostenübernahme verlangt.
"Aber natürlich ist in dem Falle das Interesse der Krankenkasse auch so einigermaßen dein eigenes Interesse. Du möchtest ja wahrscheinlich auch nicht deine eigene Gesundheit aufs Spiel setzen oder operative Eingriffe an dir vornehmen lassen, wenn du hinterher das Ganze bereust oder feststellst: Das wäre gar nicht notwendig gewesen. Es sollte einfach eine stabilisierende Begleitung da sein, die ausschließt, dass irgendwelche Faktoren in deiner Vergangenheit stattgefunden haben, die dir eine Ablehnung gegen deinen eigenen Körper eingepflanzt haben, ohne dass dir das bewusst war."
Jan, der sich sowohl chirurgische als auch hormonell hat behandeln lassen, sieht es gelassen. Der Eintrag einer Genderinkongruenz im Klassifikationssystem kann einer Person zur gewünschten Operation verhelfen. Eine andere Person hat sie vielleicht nicht nötig.
"Aber natürlich ist in dem Falle das Interesse der Krankenkasse auch so einigermaßen dein eigenes Interesse. Du möchtest ja wahrscheinlich auch nicht deine eigene Gesundheit aufs Spiel setzen oder operative Eingriffe an dir vornehmen lassen, wenn du hinterher das Ganze bereust oder feststellst: Das wäre gar nicht notwendig gewesen. Es sollte einfach eine stabilisierende Begleitung da sein, die ausschließt, dass irgendwelche Faktoren in deiner Vergangenheit stattgefunden haben, die dir eine Ablehnung gegen deinen eigenen Körper eingepflanzt haben, ohne dass dir das bewusst war."
Jan, der sich sowohl chirurgische als auch hormonell hat behandeln lassen, sieht es gelassen. Der Eintrag einer Genderinkongruenz im Klassifikationssystem kann einer Person zur gewünschten Operation verhelfen. Eine andere Person hat sie vielleicht nicht nötig.
Mehr Mitsprache bei Klassifikation von Krankheiten
Die elfte Ausgabe der ICD bringt aber noch eine weitere Neuerung. Bisher wurden alle Versionen ausschließlich in gedruckter Form herausgegeben. Die künftige wird es nur online geben. Und mit einem Portal für die Öffentlichkeit sei sie zudem näher am Puls der Zeit, wie es Robert Jakob von der WHO formuliert.
"Es gibt da eine Internetseite, die ist icd.who.int, da hat man einen zentralen Zugang und einen Zugang zur aktuellen Version. Da muss man sich dann schon anmelden mit Namen und Hintergrund, sodass man zumindest eine leise Kontrolle hat, wer das ist. Und dann kann man auf den Teil der ICD hingehen – sagen wir mal, mir gefällt nicht, dass da Bluthochdruck steht. Dann geh ich zu Bluthochdruck und mach da einen Vorschlag, wo ich sage: Das muss verändert werden, hierzu gibt es Studien, aus diesen und jenen Gründen."
Alle Vorschläge würden von Arbeitsgruppen geprüft und, wenn sie sich als haltbar erweisen, auch in das Klassifikationssystem einfließen. Denn die WHO hat das Ziel, dass durch die Kommentare und Hinweise künftig durchgehend kleine Aktualisierungen möglich werden. Fast so wie bei Wikipedia, sagt Robert Jakob, allerdings mit Einschränkungen.
"Der Aspekt ist, dass natürlich die ICD ein Steuerungsinstrument ist und ein kontrollierter Standard und der muss ein gewisses Niveau an Stabilität haben und der muss etwas strenger kontrolliert werden als Wikipedia. Von daher kann man das nicht ganz so frei lassen. Aber ja, die Vision ist schon, dass man durch diese Öffnung viel Input bekommt, den man sonst nicht so ohne weiteres bekommen würde."
"Es gibt da eine Internetseite, die ist icd.who.int, da hat man einen zentralen Zugang und einen Zugang zur aktuellen Version. Da muss man sich dann schon anmelden mit Namen und Hintergrund, sodass man zumindest eine leise Kontrolle hat, wer das ist. Und dann kann man auf den Teil der ICD hingehen – sagen wir mal, mir gefällt nicht, dass da Bluthochdruck steht. Dann geh ich zu Bluthochdruck und mach da einen Vorschlag, wo ich sage: Das muss verändert werden, hierzu gibt es Studien, aus diesen und jenen Gründen."
Alle Vorschläge würden von Arbeitsgruppen geprüft und, wenn sie sich als haltbar erweisen, auch in das Klassifikationssystem einfließen. Denn die WHO hat das Ziel, dass durch die Kommentare und Hinweise künftig durchgehend kleine Aktualisierungen möglich werden. Fast so wie bei Wikipedia, sagt Robert Jakob, allerdings mit Einschränkungen.
"Der Aspekt ist, dass natürlich die ICD ein Steuerungsinstrument ist und ein kontrollierter Standard und der muss ein gewisses Niveau an Stabilität haben und der muss etwas strenger kontrolliert werden als Wikipedia. Von daher kann man das nicht ganz so frei lassen. Aber ja, die Vision ist schon, dass man durch diese Öffnung viel Input bekommt, den man sonst nicht so ohne weiteres bekommen würde."






