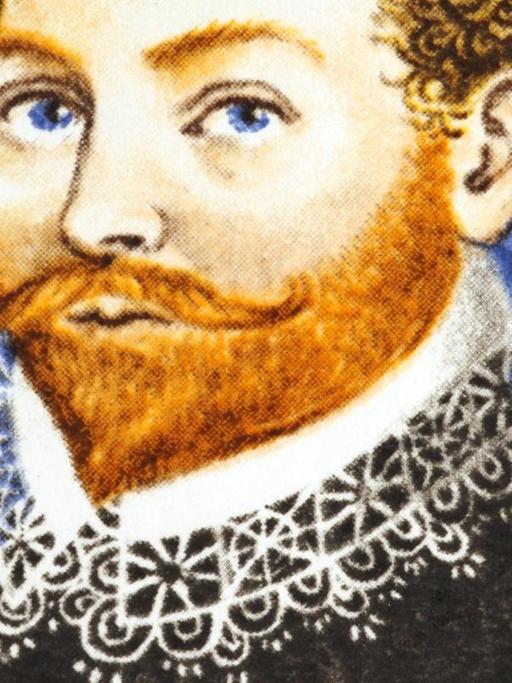Siegfried Kohlhammer: „Piraten. Vom Seeräuber zum Sozialrevolutionär“
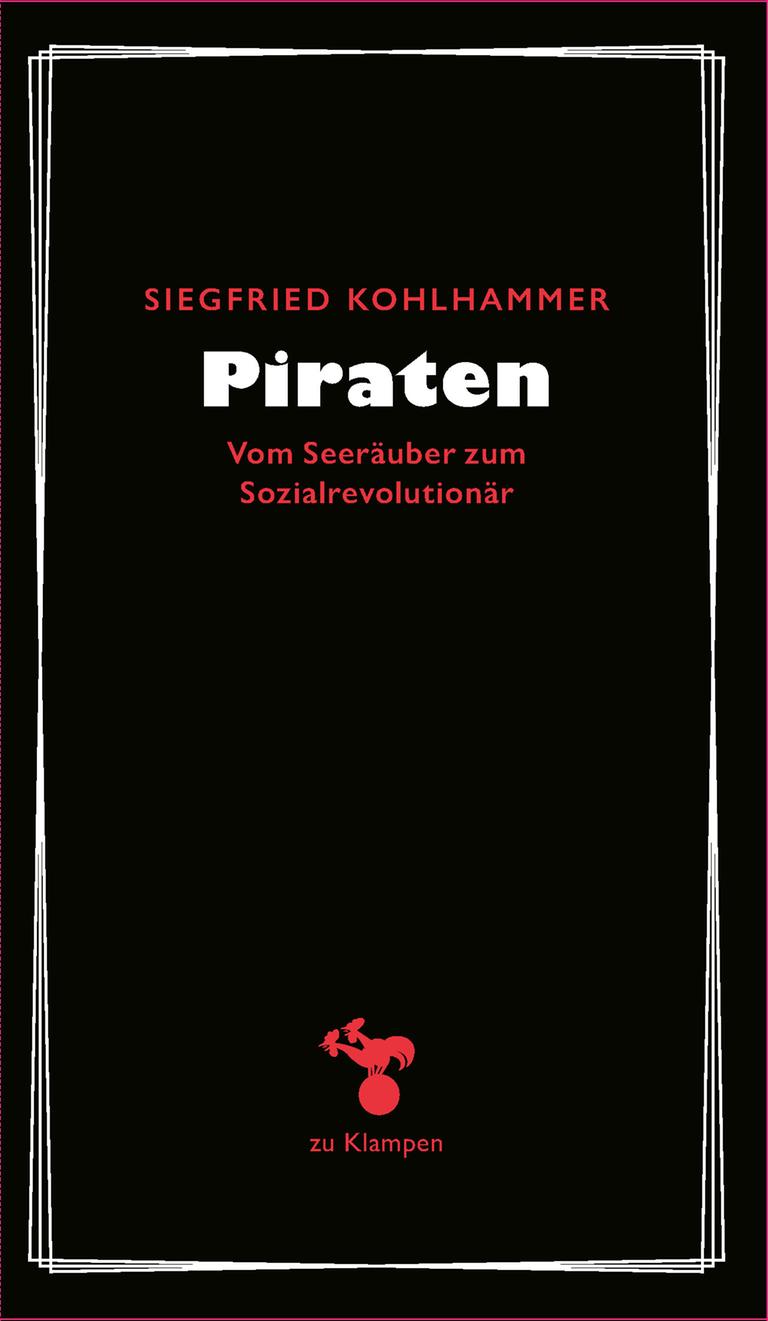
© zu Klampen Verlag
Piraten sind böse und nicht lustig
36:41 Minuten
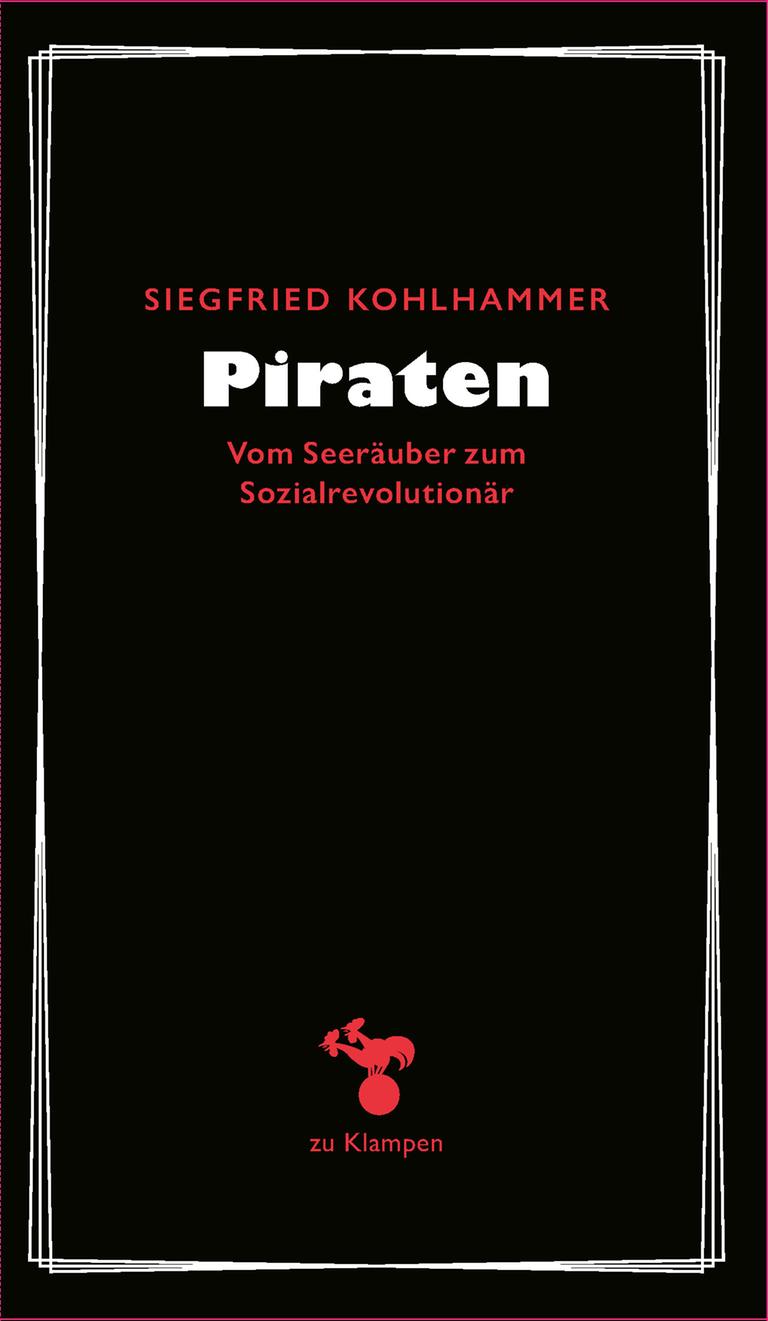
Siegfried Kohlhammer
Piraten. Vom Seeräuber zum Sozialrevolutionärzu Klampen Verlag, Springe 2022168 Seiten
16,00 Euro
Piraten? Das sind doch die fröhlichen Gesellen aus "Fluch der Karibik"! Falsch, meint Siegfried Kohlhammer. Mit seinem neuen Buch tritt er romantischen Vorstellungen vom Seeräuberdasein entgegen und beschreibt Piraten schlicht als Gewaltverbrecher zur See.
Als Held der Popkultur hat der Pirat in einem erstaunlichen Maß die öffentliche Vorstellungskraft gekapert. Sportvereine segeln unter seiner Flagge, Totenkopf-T-Shirts sind Verkaufsschlager, und wenn Hollywood gar nichts mehr einfällt, muss eben Captain Jack Sparrow nochmal ran.
Aber auch die sozialhistorische Forschung ist vom Bild des gemeinen Seeräubers abgerückt und feiert den Piraten als Freigeist und Sozialrevolutionär avant la lettre. Eine Adelung, die dem Autor und Übersetzer Siegfried Kohlhammer gar nicht schmeckt.
Bereits die ersten Zeilen seines jüngsten Buchs machen unmissverständlich klar, wo er das Piratenwesen verortet: beim organisierten Verbrechen, das, Seuchen und Hungersnöten vergleichbar, von alters her als Geißel über die Menschheit kam.
Kohlhammers Anliegen ist die Entromantisierung eines blutigen Gewerbes. Seine Ausführungen als schlichten Beitrag zur Aufklärung zu verstehen, wäre trotzdem untertrieben. Es handelt sich vielmehr um eine Streitschrift, die den diversen Formen der Piratophilie entgegentritt und nicht selten die scharfe Klinge der Polemik nutzt.
Kein Robin Hood, nirgends
Die angeblich freie Luft zur See etwa: für Kohlhammer pures Wunschdenken. Die zahlreichen Versuche, im piratischen Treiben herrschaftskritische, gar egalitäre Motive auszumachen: ein bemühtes Missverständnis.
Die marxistische Vision vom Beutezug als Umverteilungsmaßnahme von unten wiederum geißelt er als sämtlichen Tatsachen zuwiderlaufende Ersatzutopie. Man muss zugeben, dass unter ideologiekritischen Aspekten einiges für diese Sichtweise spricht. Seit die Arbeiterklasse in den Konsum entschwunden ist, gehört es zu den Spezialitäten linker Theoriebildung, widerständige Subjekte am Horizont auszumachen, die sich in schöner Regelmäßigkeit als Hirngespinste erweisen.
Aber auch hinsichtlich der sozialgeschichtlichen Hintergründe entwirft Kohlhammer ein wenig anheimelndes Bild. Die stolzen Piratenschiffe und ihre Besatzung: eine in Lumpen gehüllte Ansammlung menschlichen Mülls. Der Alltag: eine endlose Abfolge von Suff, Prügelei und Laster.
Selbst mit der vielbeschworenen Staatsferne kann es nicht weit her gewesen sein, häufig fungierten Freibeuterbanden als informelle Krieger, die die jeweiligen Regierungen bei ihren Expansionsplänen unterstützten. Am Ende ist die Beweislast erdrückend: So wie der Cowboy jenseits seiner Mythen ein Leiharbeiter zu Pferde war, wird der Pirat wohl am ehesten eine Art Gewaltdienstleister der Weltmeere gewesen sein.
Im Clinch mit dem Geist der Achtundsechziger
So weit, so erhellend. Dass man das Buch trotzdem mit einem gewissen Unbehagen beiseitelegt, hat mehr mit der Form zu tun als mit dem Inhalt, und wer Kohlhammers Gesamtwerk kennt, weiß auch, wo es herrührt. Als Publizist ohne institutionelle Bindung befindet sich der Autor im Dauerclinch mit dem Geist der Achtundsechziger – oder was er dafür hält.
Wäre der Begriff nicht so restlos diskreditiert, man würde ihn einen Querdenker nennen.
Für alles Elend der Welt sind allerdings selbst die vielgescholtenen Achtundsechziger nicht verantwortlich zu machen. Doch das ist eine andere Geschichte.