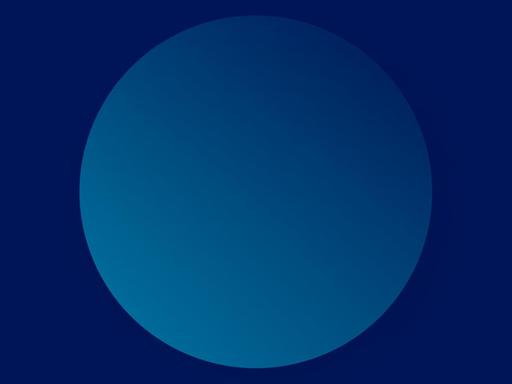Kommentar zur Verkehrswende

Elektroautos sollten in Zukunft nur eine Option unter anderen klimafreundlicheren werden, argumentiert Heike Buchter. Sie seien nicht die Zukunft unserer Mobilität. © picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow
E-Autos lösen das Verkehrsproblem nicht

Die Nachfrage nach Elektroautos sinkt seit Längerem. Statt E-Autos mit vielen Milliarden zu fördern, sollte grundlegend umgedacht werden. Klimafreundliche Mobilität beginnt mit der Stadtplanung.
Der jüngste Nachfrageeinbruch - nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und Großbritannien - könnte eine Gelegenheit sein, den Glauben an das E-Auto als die Zukunft unserer Mobilität zu überdenken.
Unbestreitbar ist: Nach der Stromerzeugung ist der Bereich Transport mit 20 Prozent die zweitgrößte Quelle von Treibhausgasen weltweit und wiederum knapp die Hälfte der Emissionen des Sektors bläst aus den Auspuffanlagen von Autos. Die scheinbare Lösung für das Problem: Man ersetzt die Verbrennerfahrzeuge durch elektrische Modelle und reduziert so drastisch die Verkehrsemissionen. Das hat für Regierungen und Politiker im Allgemeinen einen wichtigen Vorteil. Denn es gaukelt vor, dass wir unser bisheriges Mobilitätsmodell beibehalten können, nur eben batteriebetrieben.
Leider ist das eine teure und gefährliche Utopie. Nehmen wir die USA – der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen und eine Nation, in der das Auto die unbestrittene Hauptrolle im Transport spielt. Dort sind rund 300 Millionen Pkw auf der Straße. 3 Millionen davon sind derzeit E-Autos, also 1 Prozent. Um die Klimaziele einzuhalten, müssten jedoch 90 Prozent der Autos in den USA bis 2050 elektrisch betrieben werden. Das wäre nur mit drastischen Maßnahmen möglich. Billionen Dollar an Fördermitteln und/ oder ein knallhartes Verbot der Verbrenner spätestens ab 2038, wie Studien zeigen. Beides ist unrealistisch. Die EU hat zwar jüngst beschlossen, dass ab 2035 keine Modelle mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden sollen. Schon jetzt ist klar, dass die meisten Mitgliedstaaten mit der Umsetzung überfordert sein dürften. Vor allem, wenn der Widerstand der eigenen Wähler wächst.
Neue Umweltprobleme und Kosten für die Bürger
Selbst wenn die Umstellung in dieser Größenordnung gelingen sollte, schafft das neue Umweltprobleme. Denn für die E-Autos werden in nie dagewesenem Maße Rohstoffe wie Nickel, Lithium und Kobalt benötigt. Diese werden zum größten Teil im globalen Süden gewonnen, wo Menschenrechtler Kinder- und Zwangsarbeit und verheerende Umweltverschmutzung anprangern. Drei Viertel der weltweiten Kobaltproduktion etwa stammt aus dem Kongo. Die Minen und auch die Weiterverarbeitung sind überwiegend in der Hand chinesischer Unternehmen, die sich die Vorkommen schon vor Jahrzehnten gesichert haben.
Sicher, es gibt Vorkommen der Rohstoffe auch in den USA oder in Deutschland. Etwa Lithium am Oberrhein oder im sächsischen Erzgebirge. Doch Pläne für den Abbau stoßen auf den erbitterten Widerstand der Anwohner dort. Auch sonst dominieren die Chinesen. Ihre günstigeren E-Modelle drohen die westliche Konkurrenz drastisch zu unterbieten. Die Lösung der EU und der USA: Hunderte Milliarden, um heimische Lieferketten, vor allem bei Batterien, aufzubauen. Mit hohen Zöllen sollen chinesische Hersteller daran gehindert werden, den Markt aufzurollen – US-Präsident Biden hat Einfuhrzölle für chinesische E-Autos von bis zu 100 Prozent angekündigt. Letztlich zahlen Verbraucher und Steuerzahler für all diese Maßnahmen.
Grundlegendes Umdenken nötig
Statt Abermilliarden in die Förderung von Elektroautos zu stecken, sollten lieber Alternativen für das Auto gefördert werden. Die Akzeptanz des öffentlichen Nahverkehrs leidet nicht zuletzt darunter, dass er seit Jahrzehnten nicht modernisiert und weiterentwickelt wird. Dabei könnte die Digitalisierung neue Potenziale erschließen. Das E-Auto ist letztlich nur der Versuch, weiter an unserer Autokultur festzuhalten, koste es, was es wolle. Um das zu ändern, bedarf es nicht nur funktionierender Alternativen wie ein modernes Bus- und Bahnsystem oder ausgebaute Radwege für Fahrräder und E-Bikes.
Es muss grundlegender umgedacht werden. Ein Beispiel dafür ist das Konzept der “15 Minutes City” bei der Stadtplanung: Alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs sollen innerhalb einer Viertelstunde zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Einen Abschied vom Auto wird es nicht geben. Aber es sollte nur eine Option unter anderen klimafreundlicheren werden.