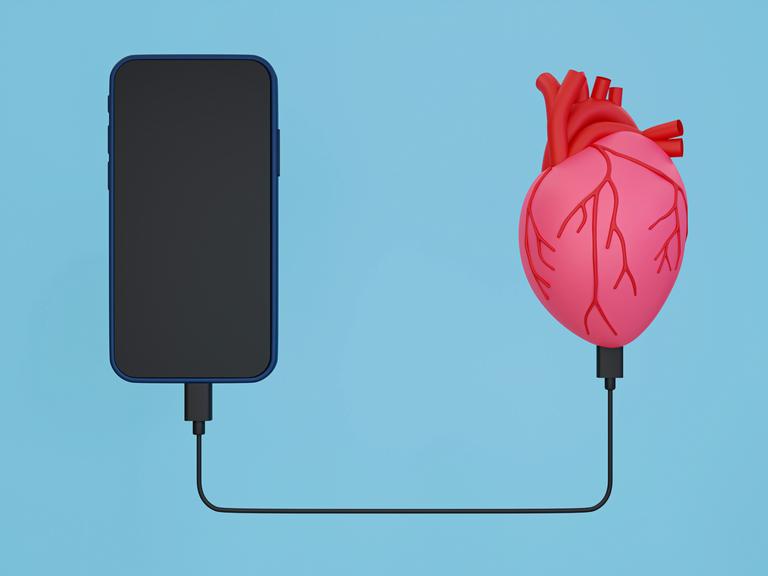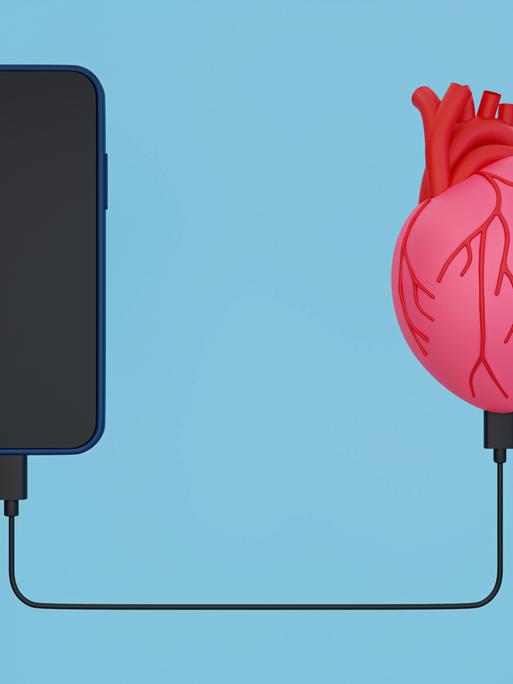Plädoyer für die Langeweile

Scheinbar langweilige Momente sind für das Gehirn gesund - man muss sie nur aushalten können. © imago / fStop Images / Malte Mueller
Pause fürs Gehirn
08:02 Minuten

Langeweile ist negativ konnotiert - zu Unrecht, sagt die Psychologin Sabrina Krauss, denn sie habe durchaus positive Aspekte. Zwar fällt es in der modernen Welt schwer, Langeweile auszuhalten. Doch auch das kann man wieder lernen.
"Das unangenehme Gefühl, eine zufriedenstellende Aktivität ausführen zu wollen, aber nicht zu können”: So definiert die Psychologie Langeweile. Und die muss nicht immer negativ sein, sondern hat auch positiven Seiten, meint Sabrina Krauss, Professorin für Psychologie an der SRH Hochschule Nordrhein-Westfalen.
Aus Langeweile könne Negatives entstehen, wie beispielsweise "selbstzerstörerische Gedanken", sagt Krauss. Es könne aber auch sein, "dass daraus prosoziales Verhalten erwächst oder irgendetwas, was wir sehr gut finden".
Fehlende Zwangspausen
Früher sei nur in die Richtung "Langeweile gleich negativer Output" geforscht worden. Mittlerweile wisse man, dass die Langeweile einen innerlich auch antreibe, zum Beispiel bei der Sinnsuche, erklärt die Psychologin.
In der heutigen Gesellschaft gebe es keine Zwangspausen mehr, so wie ehemals das Testbild nachts im Fernsehen. Das führe dazu, dass man die Langeweile immer weniger gewöhnt sei. Langeweile gebe es inzwischen schon, wenn keine "actiongeladenen Tätigkeiten auf uns warten", sagt Krauss. Das habe negative Konsequenzen - wenn man zum Beispiel nervös werde, weil man sich mit sich selbst beschäftigen müsse.
Langeweile neu lernen
Eintönige Arbeit wie Wäsche zusammenlegen kann also durchaus zuträglich sein, weil das Gehirn dann eine Pause bekomme: "Genau in diesen Momenten können wir nachweisen, dass sich neuronal die Hirnstruktur verändert."
Wer schnell unruhig und nervös werde, könne im Übrigen auch wieder lernen, Langweile auszuhalten, sagt Krauss - zum Beispiel, in dem man sich einfach nur aufs Sofa setzt und nichts tut.
(nho)