Krankheit und Heilung quergedacht
Er betrachtete die Medizin gleichsam aus philosophischer Höhe: Georges Canguilhelm ging es in seinen "Schriften zur Medizin" um den Arzt und seine Rolle in der Gesellschaft. Unter anderem problematisierte er Therapieverfahren, die den Kranken zum medizinischen "Objekt" degradieren.
Georges Canguilhelm, ein französischer Theoretiker, Mediziner und einflussreicher Philosoph, der von 1904 bis 1995 lebte und Professuren in Straßburg und an der Pariser Sorbonne inne hatte, unterwarf als Wissenschaftstheoretiker die Medizin, Biologie und Psychologie einer strengen philosophischen Analyse, weil es dort fortwährend um eine Neubestimmung unserer Auffassungen von Leben und Tod, von neu zu formulierenden Werten und Normen des Machbaren geht. Denken wir nur an die diffizile Bestimmung des Todeszeitpunktes eines Menschen, des sogenannten Gehirntods, in der hitzig geführten Diskussion um Organtransplantationen.
In den nun vorliegenden "Schriften zur Medizin" sind fünf Texte aus den 1970er und 1980er Jahren von Georges Canguilhem versammelt, in denen er zum Naturbegriff, zur Definition von Krankheit, zur "Pädagogik der Heilung" und zur "Regulation im Organismus und in der Gesellschaft" Stellung bezieht. In dem Kapitel "Gesundheit" beschreibt er diese als "das Schweigen der Organe", über welches wir nicht nachdenken. Oder:
Der Körper ist zugleich eine Gegebenheit und ein Produkt. Seine Gesundheit ist zugleich ein Zustand und ein Gebot. (….) Frei, nicht-konditioniert, nicht berechnet und bilanziert.(…) Gesundheit ist nicht nur das Leben in der Stille der Organe, sie ist auch das Leben im Verborgenen der gesellschaftlichen Verhältnisse.
In den nun vorliegenden "Schriften zur Medizin" sind fünf Texte aus den 1970er und 1980er Jahren von Georges Canguilhem versammelt, in denen er zum Naturbegriff, zur Definition von Krankheit, zur "Pädagogik der Heilung" und zur "Regulation im Organismus und in der Gesellschaft" Stellung bezieht. In dem Kapitel "Gesundheit" beschreibt er diese als "das Schweigen der Organe", über welches wir nicht nachdenken. Oder:
Der Körper ist zugleich eine Gegebenheit und ein Produkt. Seine Gesundheit ist zugleich ein Zustand und ein Gebot. (….) Frei, nicht-konditioniert, nicht berechnet und bilanziert.(…) Gesundheit ist nicht nur das Leben in der Stille der Organe, sie ist auch das Leben im Verborgenen der gesellschaftlichen Verhältnisse.
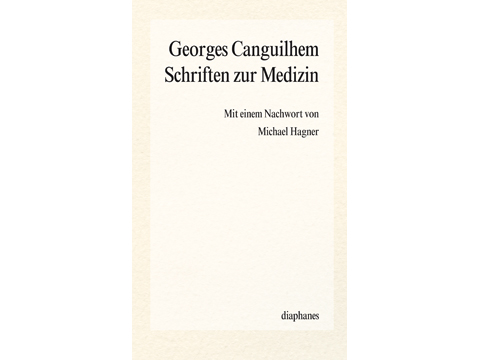
Georges Canguilhem: "Schriften zur Medizin"© Diaphanes-Verlag
Der Mensch verschwindet hinter der Krankheit
Demgegenüber verlangt und bekommt der Kranke Aufmerksamkeit, ist jedoch auch abhängig vom medizinischen Apparat. Georges Canguilhem denkt Dinge zusammen, die auseinander driften – zum Beispiel bei der Interpretation der Kranken und ihrer Krankheiten. Seine Grundannahme lautet:
Die Natur macht nichts Mutwilliges. Krankheit und Gesundheit haben ihre Ursache, und unter allen lebendigen Wesen ist keins, dessen Befinden nicht so wäre, wie es sein soll.
Diese Rede zielt gegen die seit den Griechen bis in die Aufklärung vorherrschende Auffassung, dass Kranke unrein, deviant, besessen oder vom "Bösen" befallen seien, demzufolge nur die Götter, Gott oder die Priester sie heilen könnten. Heute wird – unter der Diktatur von Wellness, Anti-Aging & Co. – erneut der Kranke für seine Krankheiten verantwortlich gemacht:
Die heutige Medizin, mit der ihr zu bescheinigenden Wirksamkeit, beruht auf der fortschreitenden Trennung der Krankheit vom Kranken. Sie lernt den Kranken durch die Krankheit zu charakterisieren, statt eine Krankheit durch das Bündel der vom Kranken spontan aufgewiesenen Merkmale zu identifizieren. Krankheit (…) verweist nun weniger auf das Übel (…) als auf die Medizin. Wenn der Arzt von der Basedow’schen Krankheit spricht (…) ist damit eine endokrine Störung gemeint, deren Symptomatik, ätiologische Diagnostik, Prognose und Therapie auf einer Reihe von klinischen und experimentellen Untersuchungen beruhen, in denen die Kranken nicht als Subjekte ihrer Krankheit, sondern als Objekte behandelt werden. (…) Krankheit ist die Gefahr, die dem Lebendigen als solchem droht.
Die Natur macht nichts Mutwilliges. Krankheit und Gesundheit haben ihre Ursache, und unter allen lebendigen Wesen ist keins, dessen Befinden nicht so wäre, wie es sein soll.
Diese Rede zielt gegen die seit den Griechen bis in die Aufklärung vorherrschende Auffassung, dass Kranke unrein, deviant, besessen oder vom "Bösen" befallen seien, demzufolge nur die Götter, Gott oder die Priester sie heilen könnten. Heute wird – unter der Diktatur von Wellness, Anti-Aging & Co. – erneut der Kranke für seine Krankheiten verantwortlich gemacht:
Die heutige Medizin, mit der ihr zu bescheinigenden Wirksamkeit, beruht auf der fortschreitenden Trennung der Krankheit vom Kranken. Sie lernt den Kranken durch die Krankheit zu charakterisieren, statt eine Krankheit durch das Bündel der vom Kranken spontan aufgewiesenen Merkmale zu identifizieren. Krankheit (…) verweist nun weniger auf das Übel (…) als auf die Medizin. Wenn der Arzt von der Basedow’schen Krankheit spricht (…) ist damit eine endokrine Störung gemeint, deren Symptomatik, ätiologische Diagnostik, Prognose und Therapie auf einer Reihe von klinischen und experimentellen Untersuchungen beruhen, in denen die Kranken nicht als Subjekte ihrer Krankheit, sondern als Objekte behandelt werden. (…) Krankheit ist die Gefahr, die dem Lebendigen als solchem droht.
Kritik am Größenwahn von technikverliebten Medizinern
Dem stellt Georges Canguilhem die Auffassung entgegen, dass eigentlich jeder, "mit dreißig Jahren (…) sein eigener Arzt sein könne, (…) nachdem er hinreichende Erfahrung auf dem Gebiet von Ernährung, Hygiene und Lebensweise" gemacht habe, für ihn also Unterscheidungen zwischen dem Nützlichen und dem Schädlichen möglich sind:
Wir können also noch immer, auch im Zeitalter der industriellen Pharmakodynamik, der Herrschaft des biologischen Labors, der elektronischen Verarbeitung diagnostischer Daten, von der Natur sprechen, um das Ausgangsfaktum lebendiger Selbstregulierungssysteme zu bezeichnen, deren Dynamik genetisch kodiert ist. Und wir müssen notfalls tolerieren, dass bei den Kranken das Vertrauen in die Kraft der Natur die Form des mythischen Denkens annehmen kann – die des Ursprungsmythos, des Mythos der Vorgängigkeit des Lebens vor der Kultur.
Natürlich ist es nicht verwunderlich, dass durch die fortschreitenden Untersuchungs- und Diagnosetechniken "die Krankheit sukzessive im Organismus, im Organ, im Gewebe, in der Zelle, in den Genen oder in den Enzymen lokalisiert" wird. Doch auch mit den von Canguilhem frühzeitig vorausgesagten, bis heute nicht in den Griff zu bekommenden Folgen, "eines vermehrten Versagens des inneren biologischen Abwehrsystems", sind wir heute konfrontiert, wie es die sogenannten hochresistenten Krankenhauskeime zeigen.
In einer nur schwer zu lesenden Diktion kritisiert Canguilhem viele Aspekte der Medizin, die mittlerweile zur Diskussionskultur in den Lebenswissenschaften gehören. Seit den 1950er Jahren war er ein unbequemer Querdenker, der die Medizintechnologie und den sich rasch steigernden Größenwahn von technikverliebten Medizinern durch philosophische Fragestellungen problematisierte, indem er in seiner lebendigen Philosophie mit einer "konstitutiven Naivität" bohrende Fragen stellte.
Wir können also noch immer, auch im Zeitalter der industriellen Pharmakodynamik, der Herrschaft des biologischen Labors, der elektronischen Verarbeitung diagnostischer Daten, von der Natur sprechen, um das Ausgangsfaktum lebendiger Selbstregulierungssysteme zu bezeichnen, deren Dynamik genetisch kodiert ist. Und wir müssen notfalls tolerieren, dass bei den Kranken das Vertrauen in die Kraft der Natur die Form des mythischen Denkens annehmen kann – die des Ursprungsmythos, des Mythos der Vorgängigkeit des Lebens vor der Kultur.
Natürlich ist es nicht verwunderlich, dass durch die fortschreitenden Untersuchungs- und Diagnosetechniken "die Krankheit sukzessive im Organismus, im Organ, im Gewebe, in der Zelle, in den Genen oder in den Enzymen lokalisiert" wird. Doch auch mit den von Canguilhem frühzeitig vorausgesagten, bis heute nicht in den Griff zu bekommenden Folgen, "eines vermehrten Versagens des inneren biologischen Abwehrsystems", sind wir heute konfrontiert, wie es die sogenannten hochresistenten Krankenhauskeime zeigen.
In einer nur schwer zu lesenden Diktion kritisiert Canguilhem viele Aspekte der Medizin, die mittlerweile zur Diskussionskultur in den Lebenswissenschaften gehören. Seit den 1950er Jahren war er ein unbequemer Querdenker, der die Medizintechnologie und den sich rasch steigernden Größenwahn von technikverliebten Medizinern durch philosophische Fragestellungen problematisierte, indem er in seiner lebendigen Philosophie mit einer "konstitutiven Naivität" bohrende Fragen stellte.
Georges Canguilhem: Schriften zur Medizin
Mit einem Nachwort von Michael Hagner
Diaphanes-Verlag, Zürich 2013
143 Seiten, 16,95 Euro
Mit einem Nachwort von Michael Hagner
Diaphanes-Verlag, Zürich 2013
143 Seiten, 16,95 Euro
