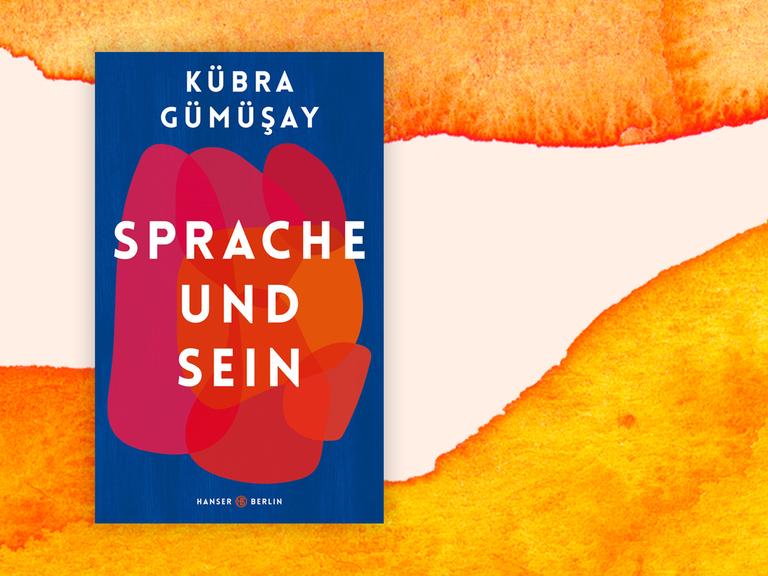Von "Gutmenschen" und "alten weißen Männern"
12:47 Minuten

Sprache kategorisiert Menschen, und Kategorien können zu Käfigen werden, sagt die Aktivistin und Autorin Kübra Gümüşay. Sie plädiert deshalb für ein freies Sprechen, das sich der eigenen Fehlbarkeit und der eigenen Macht bewusst wird.
Maike Albath: Wie reden wir miteinander und in welcher Sprache. Kübra Gümüşay ist als Bloggerin und Kolumnistin der "taz" bekannt geworden. Sie kommt aus Hamburg, wo sie 1988 geboren wurde und hat die Londoner School of Oriental and African Studies absolviert. Jetzt liegt ihr erstes Buch vor, "Sprache und Sein". Sie ist in der "Lesart" auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast und sitzt in Hamburg im Studio. Guten Tag!
Kübra Gümüşay: Hallo, schönen Tag!
Albath: Wie haben Sie Sprache denn als Kind erlebt, Frau Gümüşay? Die Allgegenwart verschiedener Sprachen gab es bei Ihnen, nehme ich an.
Gümüşay: Ja, ich glaube, das allererste Mal, als ich mir der Sprache bewusst geworden bin, war ich sehr frustriert, weil ich nicht verstanden worden bin und mich nicht verständigen konnte. Und zwar habe ich zuallererst Türkisch gelernt und konnte sehr, sehr früh lesen und schreiben. Sprache hat eine sehr große Rolle für mich gespielt, und dann erinnere ich mich an die Vorschulzeit, wo mein ganzes Lesenkönnen und all das Wissen, was ich dann unbedingt natürlich mit meinen Mitmenschen teilen wollte, nicht ankam, weil sie mich nicht verstanden haben und ich sie auch nur begrenzt verstanden habe. An diese Zeit kann ich mich gut erinnern. Das war so eine Art Brückenfunktion, die ich dann plötzlich leisten musste und übersetzen lernen musste.
"Sich Sprache wie ein Museum vorstellen"
Albath: Haben Sie da denn schon eine Wertung von Sprache auch erlebt?
Gümüşay: Damals nicht. Das fing dann aber in den Jahren danach stark an, als immer wieder auf dem Schulhof zu hören war, Türkisch wird hier nicht gesprochen oder explizit das Türkische verboten worden war, und mit den Jahren etablierte sich dann bei mir als Jugendliche beispielsweise der Glauben, die türkische Sprache sei weniger wert.
Albath: Sie operieren ja in Ihrem Buch mit Begriffen, die sich auch darauf beziehen. Sie sprechen von Benannten und Unbenannten. Können Sie erklären, was Sie damit genau meinen?
Gümüşay: Ja, ich schlage vor, Sprache sich wie ein Museum vorzustellen. Was ist die Aufgabe eines Museums, die große Welt dort draußen mit Ideen, Konzepten, mit fernen Ländern und nahen Ländern, unterschiedlichen Regionen der Welt, unterschiedlichen Tierarten werden in diesem Museum benannt, sie bekommen einen Namen und werden dort definiert und ausgestellt. In diesem Museum der Sprache gibt es zwei Typen von Menschen. Der erste Typus Mensch in diesem Museum, das sind die Unbenannten.
Das sind diejenigen Menschen, die so sehr einer Norm entsprechen, dass es für sie keinen eigenen Namen braucht, und sie können sich ganz frei durch dieses Museum bewegen und die ganze Welt sozusagen durch diese Sprache in diesem Museum ergründen. Die zweite Kategorie Mensch in diesem Museum, das ist der Typus Benannte. Das sind diejenigen Menschen, die aufgrund irgendeines Faktors von der Norm abweichen, und deshalb braucht es einen Namen für sie, und ihr Name ist ihre Kategorie, und die Definition bestimmt die Weitläufigkeit ihrer Kategorie, also ihres Käfigs.
Sie sind nicht frei in diesem Museum, sie müssen bezeichnet werden. Das sind dann zum Beispiel sehr enge Kategorien wie: der geflüchtete Mann, und die Stereotype sind aggressiv, sexistisch, übergriffig, eine Bedrohung, und das sind aber manchmal weitläufigere Kategorien wie: die Powerfrau, die dann Klischees hat wie, na ja, dass sie nicht so weiblich sei. Was ich versucht habe, mit Unbenannte und Benannte aufzuzeigen, ist, dass bestimmten Worten eine Perspektive innewohnt und dass bestimmte Menschen unserer Gesellschaft immer wieder gezwungen sind, sich zu einer Kategorie zu verhalten, also nicht als Individuen auftreten, die für ihr individuelles Verhalten belangt werden und beurteilt werden, sondern Rechenschaft ablegen müssen für eine gesamte Kategorie, der sie grob zugeordnet werden.
"Brauchen Kategorien, um uns durch die Welt zu navigieren"
Albath: Nun ist es aber so, Sie haben ja einen sehr sprachphilosophischen Titel, "Sprache und Sein", da fahren Sie ganz schön schwere Geschütze auf. Ich hatte mir auch, ehrlich gesagt, erst mal was ganz anderes erwartet, dass Sie ja auch Sprachkritik üben, aber eine Eigenart der Sprache ist, dass man in Kategorien auch denkt und operiert. Da scheint es mir doch grundlegend zu sein, auch feststellen zu müssen, dass Normen und Kategorien auch sinnvoll sind, dass wir Zuordnungen treffen. Das ist doch grundlegend, um überhaupt miteinander sprechen zu können.
Gümüşay: Ja, da haben Sie recht. Wir brauchen diese Kategorien, um uns durch die Welt zu navigieren, um uns über die Welt zu verständigen. Deshalb geht es auch nicht darum zu sagen, nein, wir müssen jetzt alle Kategorien über Bord werfen und quasi uns in eine sprachliche Anarchie stürzen, sondern es geht vielmehr darum, zu ergründen, weshalb werden bestimmte Kategorien zu Käfigen, und wie können wir es hinkriegen, dass Menschen nicht eingekäfigt werden durch eine Zuschreibung, sondern dies einfach nur neutrale oder überhaupt Beschreibungen sind.
Albath: Können Sie mal ein Beispiel geben?
Gümüşay: Ein Beispiel, um einmal zu erläutern, wie eine Kategorie zu einem Käfig werden kann, ist, wenn wir den Blick einmal umdrehen. Wenn wir zum Beispiel von alten weißen Männern sprechen, denen ja pauschale Zuschreibungen jetzt nun gegenwärtig zugeordnet werden, zum Beispiel, dass sie rassistisch seien, dass sie privilegiert seien, dass sie ignorant seien, konservativ und viele, viele andere Dinge- Und die Reaktionen darauf zeigen uns, wie einengend es ist, wenn ein Mensch nicht mehr als Individuum auftreten darf, sondern sich zu seiner Kategorie verhalten muss, also beispielsweise nachweisen muss permanent, dass er nicht rassistisch ist, nicht sexistisch ist, nicht konservativ ist oder nicht übermäßig privilegiert ist.
Diese Reaktionen zeigen, wie einengend diese sprachlichen Zuschreibungen sein können. Wie wir aber nun aus diesen Käfigen Räume machen können, also wie wir Türen einbauen können in die Räume im Museum der Sprache, das fängt an bei einer gewissen Haltungsfrage, und das ist der Absolutheitsglauben, der an diese Zuschreibungen gekoppelt ist, also der Irrglauben, man hätte einen Menschen abschließend verstanden, weil man dieser Person einer Kategorie grob zugeordnet hat. Ah ja, alter weißer Mann, ich weiß jetzt, wer du bist. Ah ja, geflüchteter Mann, ich weiß jetzt, wer du bist. Ah ja, ostdeutsche Frau, ich weiß jetzt, wer du bist. Diese Haltung von nicht mehr Nuancen zulassen, nicht mehr Komplexität zulassen, nicht mehr auch die Ambiguität zulassen.
"Respektvolles Zusammenleben als Gemeinschaftsaufgabe"
Albath: Ja, ich denke, das ist alles sehr überzeugend, wie Sie das darstellen, aber es gibt natürlich dann auch extreme Entwicklungen oder zumindest die Gefahr einer extremen Entwicklung, wenn sich zum Beispiel eine Art Opfernarrativ zu sehr etabliert, wenn man sich immer nur so versteht und diesen Käfig nicht selber durchbricht oder darauf aufmerksam macht, indem man einen anderen Sprachgebrauch auch selber etabliert, dann kann man sich immer wieder zurückziehen auf diese Kränkung und kann sagen, ihr versteht mich nicht, weil ihr mich wahrnehmt zum Beispiel als geflüchtete muslimische Frau, oder ihr versteht mich nicht, weil ich als westliche Frau auf ein bestimmtes Klischee festgelegt werde.
Es ginge doch darum, das zu durchbrechen. Sehen Sie die Gefahr nicht, dass, wenn Sie verlangen, dass auf eine bestimmte Art und Weise gesprochen wird und dass jemand, der dann zum Beispiel nicht von Schriftsteller_innen spricht, schon gar nicht mehr ernstgenommen wird, weil er nicht die richtige Sprache verwendet, dann gibt es keine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Gümüşay: Ich sehe, dass diese Art von Diskurs natürlich herrscht, aber was ich im Buch probiere, ist ja nicht, mit einem erhobenen Zeigefinger diese Themen zu besprechen, sondern gemeinsam mit den Menschen, die dieses Buch lesen, die sprachliche Architektur zu ertasten, zu ergründen und ein paar Schritte zurücktreten und zu schauen, sind wir einverstanden mit der Art und Weise, wie Sprache unser Denken formt und verändert und diese Herausforderung als gemeinsame Herausforderung zu sehen und nicht in einem anklagenden Ton, ihr seid die Bösen, und ihr habt jetzt bitte das zu ändern, sondern das gerechte, gleichberechtigte und friedliche, respektvolle Zusammenleben als Gemeinschaftsaufgabe zu sehen.
Für mich war das eine große Bereicherung, zum Beispiel von James Baldwin zu lernen, der ein afroamerikanischer Schriftsteller war, der im sprachlichen Exil und überhaupt im Exil in Frankreich gelebt hat in den 60er-Jahren, der sich genau mit dieser Frage befasst hat, das heißt, der Herausforderung, dass seine Erfahrungen, sein Leben im Englischen nicht Platz fand und er sich darin nicht wiedersah und hat dann gesagt, ja, das kann natürlich das Problem und die Schuld der Sprache sein, aber es kann auch meine Schuld sein, weil ich habe die Verantwortung, aber auch die Möglichkeit, meine Erfahrungen in die Sprache hineinzutragen.
Albath: James Baldwin hat sich bezogen auf die literarische Tradition, und zwar auch auf die weiße und die schwarze, also auf beides.
Gümüşay: Richtig.
"Die Suche nach Antworten ist eine Verantwortung für uns alle"
Albath: Ich will noch mal ein bisschen klarer machen, was ich meinte. Sie plädieren für dieses menschlichere, freie Sprechen – das ist sicherlich zentral –, aber wenn jetzt zum Beispiel Identitätspolitik in der Sprache an Gewicht gewinnt oder Überhand nimmt, dann könnte das ja neue Barrieren erzeugen, wie zum Beispiel bei diesen Triggerwarnungen, die es gibt in den USA, wenn gesagt wird, in diesen Büchern werden Frauen misshandelt, und das müssen Sie bedenken, wenn Sie das lesen.
Gümüşay: Mir geht es primär eigentlich darum, den Menschen, die das Buch lesen, die Augen dafür zu öffnen, wie viel in unserer Sprache nicht Platz findet und wie bestimmten Worten auch eine Perspektive innewohnt, die auch eine gewaltvolle Perspektive sein kann, wenn man beispielsweise immer wieder auf Wörtern beharrt, die uns eigentlich dazu zwingen, durch eine blutige Geschichte auf eine Menschengruppe zu schauen.
Albath: Was meinen Sie da zum Beispiel?
Gümüşay: Vielleicht ein aktuelles Wort wäre Gutmensch. Wen bezeichnen wir als Gutmenschen. Das ist eigentlich eine sehr breite heterogene Masse an Menschen, die konservativ und liberal und reich und arm und unterschiedlichste Menschen sein können, die aber alle vereint sind in ihrem vielleicht humanistischen Weltbild oder in einem Punkt, nämlich dass man Menschen in Not hilft. All diese Menschen wurden dann in den vergangenen Jahren als Gutmenschen bezeichnet, wurden also einer Kategorie zugeordnet. Und die Frage ist bei einem solchen Wort: Wer spricht dieses Wort, durch welche Augen schauen wir auf all diese Menschen?
Und das Zweite ist: Was passiert mit all den Menschen, wenn sie so bezeichnet werden? Ihnen werden bestimmte pauschale Zuschreibungen angehängt wie: realitätsfern, gutgläubig, naiv und links-grün versifft et cetera. Und was machen Menschen? Sie verhalten sich dazu, also versuchen zu beweisen, dass sie natürlich nicht gutgläubig und naiv sind und legen eine besondere Härte an den Tag, weil sie nicht noch mal als Gutmenschen betitelt werden wollen.
Dieses ist ein schönes Beispiel, um aufzuzeigen, dass bestimmten Worten eine Perspektive innewohnt. Das heißt, in dem Fall schauen wir auf diese heterogene Masse von Menschen durch die Augen von solchen, die anscheinend nicht den Impuls haben, Menschen in Not zu helfen. Wenn wir dieses Bewusstsein für Sprache entwickeln, wie mächtig Sprache sein kann, wie Sprache uns ermöglichen kann, Dinge wahrzunehmen und zu sehen, aber auch verhindern kann, Dinge zu sehen, dann, finde ich, entwickeln wir einen bewussteren Umgang damit.
Auch um das vielleicht mal klarzustellen: Mir geht es nicht darum zu sagen, das ist die politisch korrekte Herangehensweise und so müssen jetzt alle sprechen, und wer jetzt nicht so spricht, ist ein schlechter Mensch. Sondern es geht mir vielmehr darum, ein Bewusstsein für die Architektur unserer Sprache zu entwickeln, wie mächtig Sprache ist, um dann einen konstruktiven Umgang damit zu finden. Ich möchte keine Antworten vorgeben, aber ich finde, dass die Suche nach diesen Antworten eine Verantwortung für uns alle ist.
Albath: Sprache prägt das Bewusstsein, das ist ganz klar. Sie plädieren ja für ein freies Sprechen. Wann gelingt das?
Gümüşay: Freies Sprechen ist dann möglich, wenn wir einander Entwicklung zugestehen, Raum für Fehler schaffen und Fehler als Gewinn für alle sehen, und wenn wir im Bewusstsein für die eigene Fehlbarkeit, aber auch die Macht, die unseren Möglichkeiten innewohnt, begreifen.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.