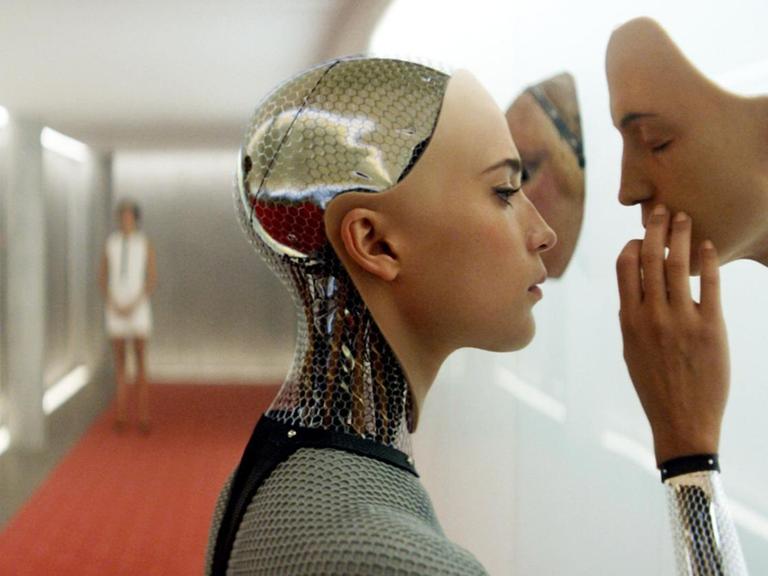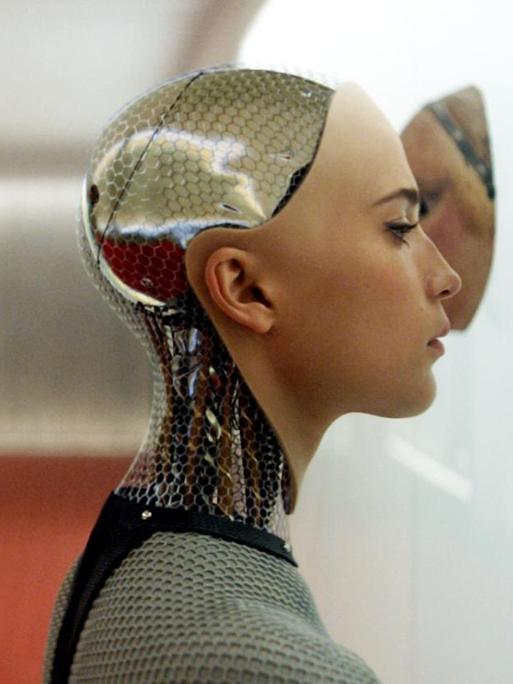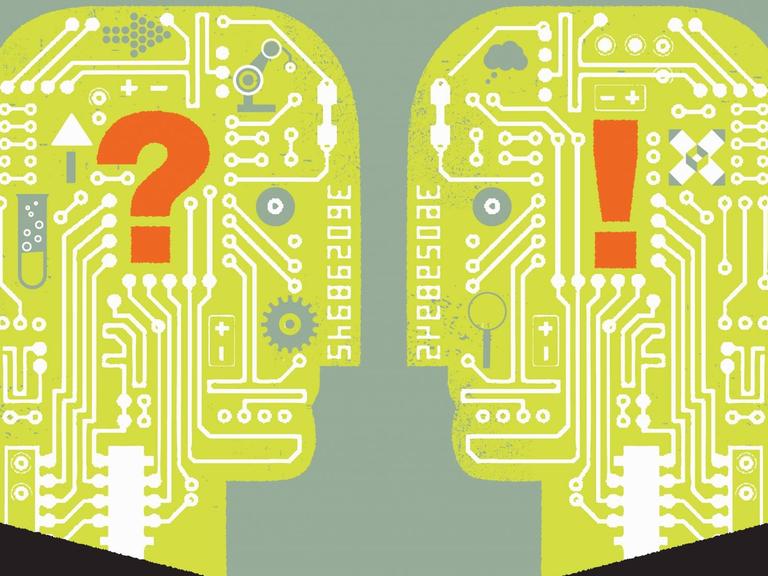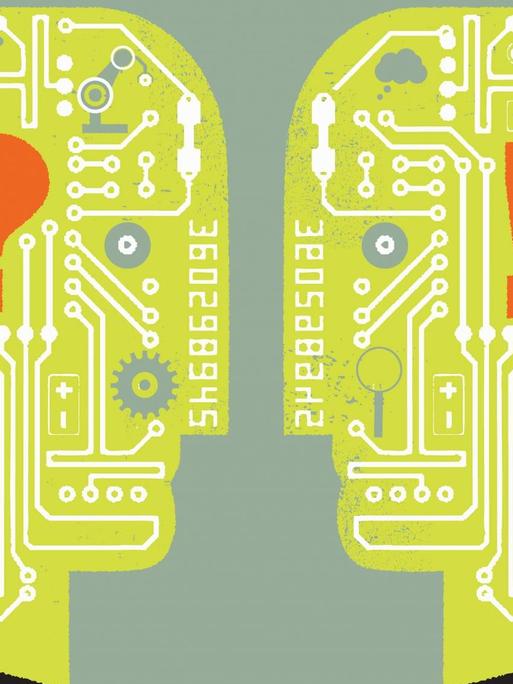Christian Maté: "Medizin ohne Ärzte. Ersetzt künstliche Intelligenz die menschliche Heilkunst?" Residenz-Verlag 2020, 176 Seiten, 22 Euro
"Es kommt darauf an, dass Arzt und Maschine ein gutes Team bilden"
13:16 Minuten

Ersetzt künstliche Intelligenz bald menschliche Heilkunst? Das fragt der Arzt und Autor Christian Maté in seinem Buch "Medizin ohne Ärzte". Ganz so weit wird es wohl nicht kommen. Aber beim Arzt der Zukunft werden andere Fähigkeiten wichtig sein als heute.
Christian Rabhansl: Unser Gesundheitssystem gilt eigentlich als sehr gut. Trotzdem: Wer an einer seltenen Krankheit leidet, der muss mitunter eine Odyssee durch Arztpraxen und Kliniken antreten bis zur richtigen Diagnose, weil Ärzte natürlich nicht alles Spezialwissen über jede noch so seltene Krankheit im Kopf haben können. Wie praktisch wäre da eine Art medizinisches Hologramm wie auf der Enterprise, das dank künstlicher Intelligenz über das gesammelte medizinische Wissen der Menschheit verfügt. Der Wiener Mediziner Christian Maté hat eine solche Vision in seinem Buch "Medizin ohne Ärzte" entworfen. Bei diesem Titel habe ich mit einem Loblied auf die Künstliche Intelligenz gerechnet. Dann lese ich aber ein Loblied auf den Menschen. Kann das sein? Was macht denn heute eine gute Ärztin aus Fleisch und Blut aus?
Christian Maté: Das war mir wichtig, das als Einstieg in das Thema zu nehmen, weil wenn wir darüber nachdenken, was kann KI ersetzen, dann sollten wir zuerst darüber nachdenken: Was haben wir eigentlich an den menschlichen Ärzten, wenn sie wirklich einen guten Job machen? Das sind ganz unterschiedliche Qualitäten.
Es ist interessant: Wenn man sich das an der internen Kompetenzbörse der Ärzte anschaut, dann gilt immer jemand als guter Arzt unter den Ärzten, der sehr viel weiß, also der unglaublich viel Wissen präsent hat, sich natürlich auch laufend fortbildet und immer die letzten Studien zitieren kann. Dieses zweite, ganz wichtige Feld der Empathie und der Beziehungsgestaltung, Kommunikation mit dem Patienten, das ist eigentlich unter Medizinern überhaupt kein Kriterium für gut oder schlecht. Es ist aber meiner Ansicht nach etwas, was ganz zentral ist und das wahrscheinlich durch die Technisierung auch mehr in den Fokus rücken wird.
Viele Dimensionen bleiben auf der Strecke
Rabhansl: Das heißt, das ist eigentlich die menschliche Schlüsselkompetenz, sich in Patienten hineinversetzen zu können. Warum ist das so wichtig?
Maté: Das ist deshalb so wichtig, weil wir es mit einem lebenden Individuum zu tun haben. Die ganze Krankheitslehre und die Hypothesen über die Wirksamkeit von Therapien wird über dieses einzigartige Individuum drübergelegt. Das stimmt natürlich dann teilweise, aber das stimmt nicht zur Gänze. Das ist immer wichtig, sich nicht nur damit zu beschäftigen, was dieser Mensch jetzt objektiv gesehen aus Sicht der Medizin braucht, sondern auch damit, was er will. Letztendlich diese beiden Dimensionen zu verbinden, macht dann aus meiner Sicht einen erfolgreichen therapeutischen Vorgang.
Aber wenn ich mich nur damit beschäftige, was braucht der, wenn ich jetzt alle Informationen aus ihm rausziehe, die ich brauche, um ihn in mein Modell hineinzusetzen, dann entgeht mir was ganz Entscheidendes. Das merkt man einfach auch, wenn man, wie ich jetzt, selbst im Spital tätig ist, dass hier immer im täglichen klinischen Alltag sehr viel in dieser Dimension auf der Strecke bleibt.
Rabhansl: Andere Sachen kann eine Künstliche Intelligenz, kann eine Software vielleicht wirklich besser. Ich denke da an so etwas wie Röntgenbilder auslesen, CT auslesen, MRT, all diese Befundungsvorgänge, das schreiben Sie auch. Was könnte man sinnvollerweise an eine KI abgeben, dass der menschliche Arzt, die menschliche Ärztin das nicht mehr machen muss?
Maté: Im Grunde genommen natürlich genau diesen Prozess der Diagnostik. Ich gehe schon davon aus, dass, wenn es zu einer größeren Generalisierung in den Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz kommt, eigentlich die Zusammenschau aller Daten durchaus auch möglich ist. Es wird irgendwann auch natürlich möglich sein, dass die KI eine Art von erster rudimentärer Anamnese führt und auf dieser Basis dann schon die ersten diagnostischen Hypothesen erstellt und in dieser Form an den menschlichen Arzt übergibt. Der kann dann wesentlich effizienter einerseits seinen wirklich kognitiven Prozess anwerfen.
Auf der anderen Seite kann er sich einfach auch wirklich aufs Individuum und auf die Kommunikation konzentrieren, weil natürlich gerade jetzt, wenn wir über Anamnese reden, die Anamnese einerseits natürlich dazu dient, dass eine diagnostische Hypothese gemacht werden kann. Aber sie ist gleichzeitig ein Prozess der Beziehung mit dem Patienten, der beunruhigt ist, dem ich in irgendeiner Weise ständig auch Signale setze, der selbst auch immer seine Fantasien hat: Warum stellt der Arzt jetzt diese Frage? Um ihn hier besser abholen zu können, da halte ich es für gut, wenn der Arzt schon mit etwas Fertigem, was die Maschine ihm zusammengebaut hat, operieren kann - was er sich dann natürlich aber noch mal kritisch anschauen muss.
Rabhansl: Damit sind wir schon so ein bisschen bei den Vorteilen, bei dem Mehrwert aus Patientensicht. Können Sie das noch genauer erklären: Was ist für Patienten und Patientinnen gut?
Maté: Wenn ich das jetzt ein bisschen in die Zukunft verlege, dann würde ich sagen, kommen wir sicher an den Punkt, dass wir einfach diagnostische Maschinen haben, denen einfach nichts entgeht. Wir wissen, dass in vielen Fällen natürlich Diagnosen erst vielleicht beim dritten, vierten Anlauf gestellt werden.
Ich habe letztens gerade wieder das Beispiel von einem Patienten gehört, der ist drei Mal von einer Spitalsambulanz weggeschickt worden; beim vierten Mal haben sie dann die Lungenembolie diagnostiziert, was natürlich wirklich eine problematische Angelegenheit ist. Oder wenn ich an die seltenen Erkrankungen denke, da kann man keinem Mediziner der Welt einen Vorwurf machen. Aber diese seltenen Krankheiten auf dem Radar zu haben, ist natürlich für einen Algorithmus ungleich einfacher. Das ist der Benefit früherer Diagnostik, was dann die Prognose entscheidend verbessert.
Patienten und Ärzte reden aneinander vorbei
Rabhansl: Ich habe Sie als allererstes gefragt, was denn heute eine gute Ärztin aus Fleisch und Blut ausmacht. Springen wir mal zehn Jahre in die Zukunft: Was wird in zehn Jahren einen guten Arzt ausmachen?
Maté: Da könnte es tatsächlich so sein, dass, indem uns einfach die Maschinen dann täglich beweisen, dass sie sich in diesen kognitiven Feldern wesentlich leichter tun, dass Ärzte einfach schon mal nach anderen Kriterien ausgewählt werden. Jetzt sind es die Merkweltmeister, die sich hier hervortun können. Aber vielleicht sind es in Zukunft eben genau die Menschen, die besonders empathisch sein können, die eine gute Gesprächstechnik beherrschen. Vielleicht verlegt sich dann auch die Medizinerausbildung verstärkt auf dieses Feld, weil hier noch sehr viele Feinheiten sind, die einfach wirklich nicht ordentlich unterrichtet werden - so weit ich es aus der österreichischen Praxis zumindest kenne - da ist noch unglaublich viel drin.
Ich finde es immer faszinierend, wenn man bei einer Visite mitgeht und einfach mal nur zuhört, wie oft Patienten und Ärzte aneinander vorbeireden. Da würde ich nicht sagen, dass das primär der Job des Patienten ist, sondern das ist der Job des Arztes, dieses Vorbeireden zu verhindern. Mediziner der Zukunft sind einerseits auf Empathie und Gespräch geschult, andererseits aber auch auf die Zusammenarbeit mit den Maschinen geschult, weil darauf kommt es eben an, dass Arzt und Maschine ein gutes Team bilden.
Rabhansl: In Ihrem Buch "Medizin ohne Ärzte" malen sie sich eine Medizin der Zukunft mit einem medizinischen Superhirn in der Cloud aus, eine Künstliche Intelligenz. Das klingt gut, das geht aber nur, wenn diese Medizin-KI auch mit gigantischen Datenmengen gefüttert wird. Gerade jetzt in der Coronakrise sehen wir vielleicht erste Schritte in diese Richtung. In Österreich wird heiß über eine Corona-App diskutiert, die Abstand messen soll. In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut jetzt eine Datenspende-App veröffentlicht, so nennt sie das, die schon zehntausendfach runtergeladen wurde, wo die Daten aus Fitnessarmbändern und Trackern hochgeladen und ausgewertet werden. Ist das ein erster Schritt, den wir jetzt in der Krise unternehmen, in die Zukunft, die Sie sich vorstellen?
Maté: Ja, ich glaube, das könnte durchaus so sein, weil, wir haben bisher einfach immer nur diese Dichotomie, einerseits meine Privatsphäre, meine Daten, mein Eigentum, und durch die Coronakrise entsteht schon eine gewisse neue Form des kollektiven Umgangs mit den Dingen, die hier und jetzt passieren.
Wenn das vielleicht dazu führt, dass man auch ein bisschen spürt, dass meine Daten auch helfen können, dann könnte das durchaus ein Schritt in die richtige Richtung sein, dass man wirklich ordentlich reguliert, in einem vernünftigen Rahmen, in einem vernünftigen Setting auch sagt: Hey, wir legen das zusammen, weil unsere Daten gemeinsam ganz einfach einen Mehrwert schaffen.
Rabhansl: Auch da diskutieren wir jetzt schon heftig, ob mit solchen Apps ganze Bewegungsprofile erstellt werden oder eben tatsächlich nur, wie es gesagt wird, geguckt wird, wer mit wem zusammengetroffen ist. Die Vision, die Sie malen, die zeichnet aber noch viel mehr Datenerfassung, Selbstvermessung, die Smart-Watch, das schlaue Klo im Zweifelsfall, die intelligenten Kontaktlinsen, wir könnten Sensoren haben, die wir uns per Creme auf die Haut schmieren, Sensoren haben, die wir schlucken, vielleicht misst auch der Kühlschrank, was wir denn so essen. Ist das ein Zukunftstraum oder irgendwie dann doch eine Horrorvision?
Maté: Es ist ein bisschen beides. Wenn man sich mit Technologie beschäftigt, dann sieht man natürlich die Möglichkeiten, eindeutig, unglaubliche Möglichkeiten. Gerade bei einem Bereich, der vielleicht noch am meisten spooky erscheint, die Geschichte mit der Nanotechnologie, mit den Nanosensoren, die dann durch meinen Blutkreislauf fließen und ständig Daten übermitteln, das klingt wirklich am Übelsten. Aber ich muss auch sagen, aus Sicht eines Spitalsarztes, der Tag für Tag erlebt, dass die Menschen einfach ständig perforiert werden müssen, um ihnen Blut abzunehmen, um in der Lage zu sein, sie vernünftig zu monitoren – was auf der einen Seite für viele Patienten heißt, sie müssen im Spital sein, auf der anderen Seite natürlich eine unglaubliche Quälerei für viele Patienten, und außerdem sind es immer nur Momentaufnahmen –, wenn ich das nur mal herausnehme, was vielleicht so spooky ist, finde ich als Mediziner, wäre das ein gewaltiger Fortschritt und könnte auch dazu führen, dass man wirklich diese sogenannte Echtzeitmedizin realisiert.
Gefahren der Drei-Klassen-Medizin
Rabhansl: Ich verstehe, dass das aus Medizinersicht sehr verlockend und auch für Patienten wahrscheinlich durchaus hilfreich wäre. Aber das Gehirn, dieses Supermedizinergehirn, das läge nicht bei Ihnen im Spital, sondern doch mutmaßlich in der Cloud eines der bekannten Tech-Konzerne wie Google, Amazon, Microsoft. Was für Folgen hätte das für Datenschutz, aber eben auch Gesundheitsvorsorge?
Maté: Das halte ich natürlich für sehr problematisch. Wenn wir jetzt sehen, dass es gerade in Amerika eine Kooperation zwischen Google und einem der größten Klinikbetreiber gibt, wo es eigentlich drum geht, dass dort Google ein cloudbasiertes Krankenhausinformationssystem etabliert, was natürlich dazu heißt, dass die Daten von all diesen Millionen Patienten an Google als Dienstleister übermittelt werden, dann läuft es einem schon kalt den Rücken runter, auch wenn Google sagt, wir verknüpfen das nicht mit den Consumer-Daten, die wir über andere Applikationen haben.
Aber letztendlich, ich schreibe das auch an einer Stelle, ist es nicht so, dass diese Patienten drauf vertrauen können, sondern sie müssen drauf vertrauen. Hier können natürlich alle möglichen Prozesse ablaufen. Vor allen Dingen, wenn ich sage, okay, dann habe ich vielleicht eine Drei-Klassen-Medizin, ich habe auf der einen Seite, die Patienten, die wirklich für solche Services zahlen. Auf der anderen Seite Patienten, die nicht mal dafür zahlen können, sondern die mit ihren Daten zahlen. Die dritte Klasse wären dann die, die sich noch menschliche Ärzte leisten können. Hier können sich einige Dystopien daraus ableiten. Hier ist eindeutig die staatliche Regulierung gefordert.
Rabhansl: Alles, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten im ganzen Technologiebereich erleben, deutet aber immer darauf hin, dass wenige große Player marktbeherrschend sind und noch so oft erzählen, wir verknüpfen die Daten gar nicht, aber es dann eben doch tun. Wie optimistisch sind Sie, dass wir in der positiven Zukunftsvision enden und nicht in der Dystopie, wo wir zwar gesund, aber alle überwacht sind?
Maté: Das ist eine richtig schwierige Frage, weil das können Sie mich an verschiedenen Tagen fragen, da gebe ich Ihnen wahrscheinlich unterschiedliche Antworten drauf.
Daten müssen reguliert werden
Rabhansl: Welche geben Sie heute?
Maté: Von der Technologie her, glaube ich, kann einfach niemand mithalten. Es ist sicher so, dass der europäische dritte Weg, also wenn ich sage, ich habe auf der einen Seite die komplette Entgrenzung, wie es vielleicht in Amerika der Fall ist, ich habe auf der anderen Seite die eher totalitär gesteuerte Massendatenverarbeitung, wie es in China der Fall ist, und ich habe den europäischen Weg, der irgendwo in der Mitte geht und ein vernünftiges Modell aufzeigt, dann kann das schon ein Vorbild sein.
Ich sage es jetzt mal optimistisch: Ich glaube, dass das schon dazu führen wird, dass ein Bewusstsein dafür entstehen wird, was eigentlich der Wert der individuellen Daten ist, dass es ganz einfach nicht mehr so einfach sein wird, solche Deals abzuschließen. Die sind jetzt so einfach, weil es kein Gefühl dafür gibt, was die wert sind. Wenn das mal auf der einen Seite entsteht, ein Bewusstsein der Zivilgesellschaft, was Daten eigentlich wert sind, auf der anderen Seite eine möglichst weitgreifende Regulierung, dann kann schon was Vernünftiges dabei rauskommen.
Aber was man heute sieht, ist, dass es in der Vergangenheit ein großer Vorteil für die Entwicklung von AI-Applikationen war, wenn man viel Daten zur Verfügung hatte. Das hat Player wie Google ganz einfach groß gemacht.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.