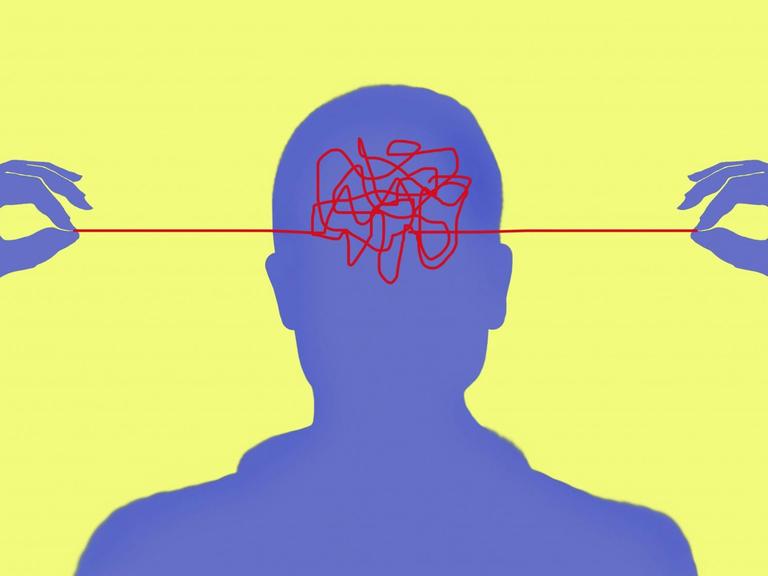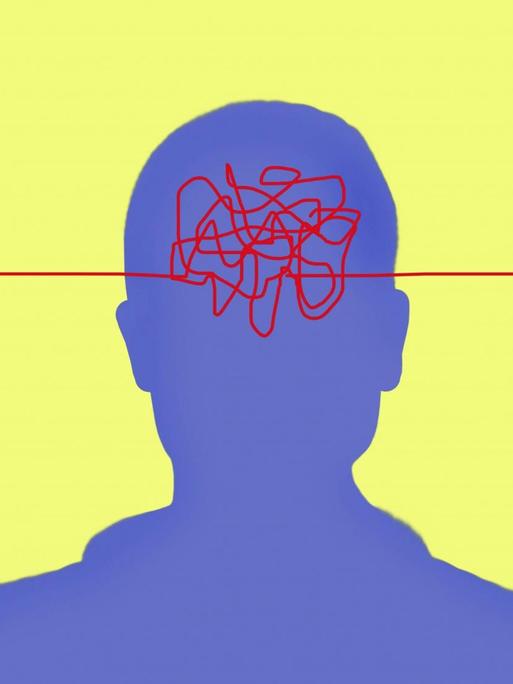Die Erstausstrahlung des Features war am 26. Juli 2021.
Die Kunst des Helfens

Die Geschichte der menschlichen Zivilisation sei immer schon eine der Kooperation gewesen, sagt der Historiker Tillmann Bendikowski. © imago / Ikon Images / Eva Bee
Von der Herausforderung, für andere da zu sein
29:51 Minuten

Auch die Pandemie hat es gezeigt: Menschen brauchen gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Wie sehr also schätzen wir es wert, das Helfen – und all jene, die sich ihm verschrieben haben? Was braucht es dafür und welche Schwierigkeiten liegen darin?
"Das Helfen ist eine anthropologische Grundkonstante. Der Mensch ist nolens volens ein helfendes Wesen, weil er anders nicht existiert", sagt Tillmann Bendikowski.*
"Wenn ich das Wort 'helfen' mal mit 'gegenseitiger Unterstützung' ersetze, dann gibt es so viele Projekte, wo man sehen kann, wie selbstverständlich gegenseitige Unterstützung passiert", sagt Christine Ordnung.
"Prinzipiell ist es ein Kreislauf: Ich komme auf die Welt, ich bin ein Kind und ich brauche Hilfe, ohne die Erwachsenen läuft es nicht. Dann geht man durch die Welt, braucht ab und zu Hilfe, gibt ab und zu auch Hilfe. Und im Alter lässt die Kraft nach und, um rege am Leben teil zu nehmen, braucht es da schon Unterstützung. Sonst läuft es nicht", sagt Natalie Koperski.
"Homo homini lupus": Dass der Mensch dem Menschen ein Wolf sei, das behauptete im 17. Jahrhundert der britische Philosoph Thomas Hobbes. Er baute auf dieser Weltanschauung eine ganze Staatstheorie auf, in der es vor allem darum ging, die menschlichen Wölfe voreinander zu schützen und den nach persönlichem Profit und Vorteil gierenden Einzelnen in seine Schranken zu weisen. Vielleicht hat – um im Bild zu bleiben – Hobbes übersehen, dass Wölfe im Rudel leben und höchst kooperative Wesen sind.
"Alles, was im Leben zählt, ist, dass man Dinge teilt, mit Hingabe sich um andere kümmert", sagt der Intensivmediziner und Kardiologe Matthias Angres. Mit seiner Berufswahl hat er das Helfen zu seinem Lebensinhalt gemacht. Zudem geht er seit zwölf Jahren in die Krisengebiete dieser Welt, um dort Menschen in extremen Notlagen zu helfen: Er operiert herzkranke Kinder und betreut sie intensivmedizinisch.
Helfen als Lebensaufgabe
"Ich bin sehr geprägt von Albert Schweizer, einer der großen Deutschen, der damals als Theologe im Ersten Weltkrieg entschieden hat, ich werde Arzt und gehe nach Afrika. Von ihm stammt ein Satz, der mich bis heute prägt: Für jeden, der rausgeht, um Unheil zu machen, muss mindestens einer rausgehen, um Dinge besser zu machen, um Gutes zu bringen."
Matthias Angres war Direktor einer Hamburger Klinik, als er das erste Mal zu einem medizinischen Einsatz nach Afghanistan flog. Das Erlebte prägte ihn dermaßen, dass er beschloss, sich ganz der Arbeit in Kriegsgebieten zu widmen und die gut bezahlte Klinikleitung dafür aufgab. Er, der heute mit Menschen verschiedenster Religionen und Kulturen zusammenlebt und arbeitet, ist selbst überzeugter Christ.
"Für mich hat das immer eine große Rolle gespielt, der Hintergrund, dem ich entstamme, aus einer Familie, die sehr ‚committed‘ war, sich immer auch um andere zu bemühen. Für mich ist das eine der Grunderziehungssachen, dass man sich prinzipiell um andere kümmern muss", erzählt er.
Matthias Angres hat in vielen Ländern gearbeitet unter anderem in Syrien und Ruanda, wo er Herzzentren für Kinder aufbaute. Derzeit errichtet er mithilfe der von ihm gegründeten Organisation Robinaid ein Krankenhaus in Kamerun. Die jungen Patientinnen und Patienten müssen somit nicht mehr kostspielig nach Deutschland geholt werden.
"Wir haben eine privilegierte Situation"
Vor allem aber würden vor Ort andere Strukturen geschaffen, sagt Matthias Angres.
"Wir haben eine privilegierte Situation, dass wir etwas leisten können, das wir auch tatsächlich leisten, das wir auch leisten möchten, aber was wir tatsächlich auch in der ethischen Selbstverpflichtung zu leisten haben. Ich habe immer noch das Privileg, dass ich nach einem Einsatz nach Hause fliegen kann und es zu Hause anders aussieht."
Er selbst verdient kein Geld mehr mit seiner Arbeit, hat sich dafür finanziell sehr eingeschränkt. Seine Frau, ebenfalls Ärztin, und seine Tochter, unterstützen seine Arbeit. "Man lebt auch nicht allein. Selbst eine gute Motivation kann man nicht komplett egozentrisch für sich ausleben und sagen, der Rest kümmert mich nicht. Ich habe Familie, ich habe Verantwortung und gemeinsam haben wir das besprochen, wenn mir etwas passiert, dass dann meine Stiftung meine Familie mit absichert."
Selbstlosigkeit ist das Attribut, das einfällt, wenn man Matthias Angres zuhört. Sein Handeln lässt sich durchaus als heldenhaft bezeichnen. Er selbst würde das vehement von sich weisen und betonen, dass er lediglich ein Teil eines großen Teams ist. Doch wenn der Begriff des Helden zutrifft, dann doch wohl auf jemanden, der sich so konsequent dem Helfen verschrieben hat, oder?
Superhelden und die Sehnsucht nach Helfern
Helden gibt es zahlreiche, zumal in der Popkultur. Jener Superheld etwa, der als Batman den Gangstern von Gotham City das Handwerk legt und den Menschen zu Hilfe eilt. Ebenso wie sein Kollege der Spinnenmann. Im realen Leben ein Nerd, der unter den Bullies der Schule leidet, entwickelt er ungeahnte Kräfte, sobald er als Helfer und Retter im Einsatz ist.
Spiderman ist ganz wie Superman und Batman ein Waisenjunge. Sie alle sind jüdisch-christliche Archetypen. Die Geschichte von Superman, dem Vater aller Superhelden, erzählt ein biblisches Narrativ: Er ist Mensch und doch kein menschliches Wesen, der einzige Sohn, der vom Vater auf die Erde gesandt wird, um der Menschheit zu helfen, um sie zu retten.
Blickt man auf den Erfolg der Superhelden-Sagen, scheint die Sehnsucht nach Helfern groß. Die helfenden Helden retten uns, die Verlorenen, aus den ausweglosesten Situationen. Vielleicht entsteht mit dem Verlangen nach solchen Superhelden auch die Versuchung, Helferinnen und Helfer im realen Leben zu überhöhen?
Kein Superheld, aber ein sehr realer Alltagsheld ist der Intensivpfleger Ricardo Lange. Die Aufmerksamkeit, die er und seine Kolleginnen und Kollegen während der ersten Coronawelle bekamen, sah er schon damals skeptisch.
Ein Intensivpfleger wird zum Aktivisten
Ein Held will auch er nicht sein, stattdessen wünscht er sich den kritischen Blick auf das Gesamtgeschehen. "Dass man klatscht, war jetzt nicht das Schlimme, mich hat einfach gestört, dass es sonst niemanden interessiert hat. Die Intensivstationen waren ja vor Corona schon überlastet. Schon vor Corona mussten die Pflegekräfte viel mehr Patienten betreuen, als eigentlich gut wäre für die Patienten aber auch für die Pflegekräfte."

"Die Intensivstationen waren ja vor Corona schon überlastet", kritisiert Ricardo Lange.© imago / Jens Schicke
Einerseits bekamen sie Applaus, so der Krankenpfleger - andererseits fehlte es an Solidarität. Dann fing die Pandemie an und die Zeit, wo die Angehörigen und Verwandten bei uns auf Station die ganzen Masken und Desinfektionsmittel geklaut haben. Teilweise wurde Desinfektionsmittel gegen Wasser getauscht. Dann kam man nach Hause, wollte einkaufen gehen, die ganzen Regale waren leer gekauft.
Auf Facebook und Twitter fing Ricardo Lange an, von seinem Arbeitsalltag auf der Intensivstation zu berichten, und bekam viel Resonanz. Zunächst positive. Doch mit dem Rückgang der Fallzahlen und der Gefahr kippte die Stimmung.
"Umso mehr es mit Corona runterging, umso mehr änderte sich das Ansehen der Pflege", sagt er. "Also wo man am Anfang noch beklatscht und bejubelt wurde, war man auf einmal der Spinner, der Corona-Faschist – so eine Nachrichte habe ich tatsächlich bekommen, das Wort ist nicht von mir. Man würde von Frau Merkel bezahlt, damit man sich zu Corona so äußert."
Erst als Held gefeiert, dann das Ziel von Hatern
Seit April 2020 hat er eine wöchentliche Kolumne beim Berliner "Tagesspiegel" und erhält damit noch mehr Aufmerksamkeit und der vormals als Held gefeierte wird zur Zielscheibe des Hasses.
"Ich hatte mich im 'Tagesspiegel' ja auch emotional dazu geäußert, dass man die Verstorbenen ja aus Desinfektionsschutzgründen in schwarze Säcke packen muss. Auch da kam wieder Post, ich hätte den falschen Beruf, weil ein Müllmann, der Müll nicht in schwarze Säcke packen kann, hat halt den falschen Beruf. Und das sind so Dinge, die mir zu schaffen machen", erzählt er.
"Ich hätte nie gedacht, dass Menschen so über Schicksale reden. Zahlen bagatellisieren, entmenschlichen. Wenn andere von Zahlen sprechen, sind es bei mir Menschenleben, wo ich dann am Bett stehe. Und das ist dann, was mir zu schaffen macht. Arschloch darf mich ruhig jeder nennen, aber wenn jemand so abfällig über Menschen spricht, läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter."
Institutionalisiertes Helfen – ein Zeichen von Zivilisiertheit
"Eine Gesellschaft, in der das Helfen institutionalisiert – in Krankenhäusern, in Altenheimen nicht mehr wertgeschätzt wird, läuft Gefahr, dass ihre Zivilisiertheit erodiert", sagt der Historiker Tillmann Bendikowski. Er hat ein Buch über die Kulturgeschichte des Helfens geschrieben.
"In dem Moment, in dem Zivilisiertheit erodiert, erodiert auch immer mehr demokratische Kultur. Und der Firnis der demokratischen Kultur ist relativ dünn. Die Risse zeigen sich relativ schnell dort, wo eine Kritik an dem institutionalisierten Helfen, an den Schwachen, deutlich wird. Man darf eine solche Kritik, wenn sie lauter wird, wenn sie struktureller wird, wenn sie rhetorisch härter wird, nicht unterschätzen", sagt er.
Die Geschichte der menschlichen Zivilisation sei immer schon eine Geschichte der Kooperation gewesen und ohne diese gar nicht denkbar, sagt Tillmann Bendikowski. Er betont die Bedeutung des Christentums für den Umgang mit Mitleid in der christlichen Praxis von Barmherzigkeit und Nächstenliebe.
Eine kleine Kulturgeschichte des Helfens
"Ab dem Christentum unterscheiden wir eine qualitative Veränderung der Kultur des Helfens: Nämlich weil das Christentum das Mitleid – schon die griechischen Philosophen haben viel über das Mitleid nachgedacht – das Christentum akzeptiert jetzt kein Mitleid mehr ohne Helfen. Das ist jetzt die moralische Forderung, die Europa auch verändert", erklärt der Historiker.

"Die Fähigkeit, Mitleid zu empfinden, ist ja auch umstritten", erklärt Tillmann Bendikowski.© picture alliance / dpa / Jan Woitas
"Mitleid sei definiert als eine Art Schmerz über ein anscheinend leidbringendes Übel, das jemanden trifft, der es nicht verdient, ein Übel, das erwartungsgemäß auch uns selbst oder einen Unsrigen treffen könnte", heißt es schon bei Aristoteles.
Mitleid bedeutet hier Identifikation mit dem anderen und ist gekoppelt mit Furcht. Zudem wird nur mit demjenigen gelitten, der das Leid nicht verdient. Ein Affekt, aus dem Moral entspringt – Aristoteles maß der Tragödie besondere Bedeutung dabei zu, das Mitleid zu entwickeln und zu formen. Die Stoiker hingegen lehnten es - wie alle Gefühle ab: Als Affekt tauge es nicht, um ethische Entscheidungen hervorzubringen.
Mitleid, eine umstrittene Fähigkeit
"Die Fähigkeit, Mitleid zu empfinden, ist ja auch umstritten", sagt Bendikowski. "Entweder ist es die Grundlage aller Menschlichkeit oder – bei Nietzsche ganz stark, ein 'Mitleidverächter' – da ist Mitleid die Tugend der Freudenmädchen, ist das Mitleid eine Gefahr für die Ratio. Das ist uns erhalten geblieben aus dem historischen Diskurs: Die Verdächtigung, dass das Motiv zum Helfen letztlich unreflektiert, emotional, daherkommt, aber für die Lösung der großen, gesellschaftlichen Probleme letztlich unbrauchbar ist."
Die Frage, ob moralisch richtiges Handeln allein der Ratio oder nicht auch dem Gefühl – dem Mitleid, dem Mitgefühl, oder, modern gesprochen, der Empathie - zugerechnet werden kann, beschäftigt verschiedene Philosophen der Neuzeit. Interessant ist der Diskurs zwischen Immanuel Kant und Arthur Schopenhauer. Kant schlussfolgerte seinen kategorischen Imperativ aus dem Verstand.
Dass Moral reine Verstandessache sei, ist eine Idee, die sich auch bei Verfechtern des Utilitarismus, findet - jenen, die das Nützlichkeitsprinzip voranstellen. Moral und auch helfendes Handeln entspringen hier einer rein rationalen Abwägungslogik.
"Ich bin da skeptisch", meint Tillmann Bendikowski. "Es gibt Sachen wie diesen effektiven Altruismus, da sagt man dann, aha, es gibt Ungerechtigkeit auf der Welt, da sind Sachen ungleich verteilt, dann müssen wir etwas rechnen – das ist fast ein ökonomischer Ansatz: Wer müsste wie viel abgeben, damit wir so viel haben, dass es funktioniert. Das klingt auf den ersten Blick erst mal ganz vernünftig. Ich bin skeptisch, dass ein durchweg vernunftgesteuertes Helfen dann doch nicht existiert."
Welche Rolle spielt der Egoismus?
Auch Schopenhauer war skeptisch. Ausgerechnet der als Misanthrop verschriene Philosoph sah im Menschen nicht nur den Trieb zu Bosheit und die Anlage zum Egoismus, sondern ebenso die Fähigkeit zum Mitleid. Eine Mischung, die in jedem Einzelnen in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden sei.
Schopenhauer will, anders als Kant, in seinem Werk über die Mitleidsethik keinen normativen Imperativ aufstellen, sondern die Ursachen moralischen Handelns erforschen: "Dies sind die wahrhaft ehrlichen Leute, die wenigen Aequi unter der Unzahl Iniqui. Aber solche Leute gibt es", schreibt er.
Die wenigen Gerechten konkurrieren bei Schopenhauer mit der Unzahl Ungerechter und Egoismus und Bosheit konkurrieren in jedem Einzelnen mit dessen Mitleidsfähigkeit. Wahrhaft moralisches Handeln muss Schopenhauer zufolge daher frei von jeglichem Egoismus sein.
Dass dem Egoisten nicht nur bei Schopenhauer eine solch unethische Rolle zukommt, hält der Historiker Tillmann Bendikowski für falsch.
"Der Egoismus ist nicht der Gegenspieler vom Helfen. Der Gegenspieler vom Helfen ist Nicht-Helfen. Der Egoist ist der übliche Verdächtige, der verhaftet wird, wenn was nicht richtig funktioniert", sagt er.
"Das ist bei Kant schon anders, der bringt es auf den Punkt, dass er sagt: Es gibt unterschiedliche Formen von Egoismus: Den logischen, ästhetischen, moralischen Egoismus. Es ist wichtig, dass der Eigene sich zum Eigenen bekennt, als Einzelner sich identifiziert und nicht das tut, was andere tun."
Alles eine Frage der Beziehung
Mit der Praxis des Helfens kennt sich die Familientherapeutin Christine Ordnung aus. Neben ihrer therapeutischen Tätigkeit coacht sie Menschen in helfenden Berufen. Egoismus und Mitgefühl schließen sich nicht aus, sagt sie, mehr noch: Sie bedingen einander.

"Hilfe zu benötigen, ist ein schwieriger Zustand", erläutert Christine Ordnung.© imago / Roland Mühlanger
"Empathie ist für mich das zentrale Wort dabei, aber nur, wenn ich es in beide Richtungen verstehe. Also ich brauche Empathie für mich selber. Und erst, wenn ich ausreichend empathisch für mich selber bin, dann kann ich auch in einer authentischen Form empathisch für den anderen sein", erklärt sie.
"Hilfe zu benötigen, ist ein schwieriger Zustand. Und es ist noch schwieriger, wenn andere einem sagen: Du brauchst Hilfe!"
In ihrer Praxis als Familientherapeutin hat Christine Ordnung es mit Menschen zu tun, die bewusst Hilfe suchen. Um hilfreich sein zu können, sei noch etwas anderes entscheidend – die Würde des Helfenden und die der Hilfesuchenden.
"Da geht es eigentlich los: Wie viel Respekt habe ich vor Familien, die in eine Situation geraten, wo sie allein nicht mehr zurechtkommen. Und wie kann Hilfe aussehen, die ihnen die Würde belässt. Wie sehr stellen Sie sich als Helfer zur Verfügung oder wie bleiben Sie in ihrer Persönlichkeit auch in Ihrer eigenen Würde und geben dadurch die Würde der anderen", sagt sie. "Also wenn ich mich aufopfere für andere, dann müssen andere mir unendlich dankbar sein, die ganze Zeit."
Wachsam und achtsam helfen
Die Kölnerin Natalie Koperski arbeitet ehrenamtlich als Seniorenassistentin. "Für mich hat sich verändert, dass ich sehr wachsam und achtsam bin, was Hilfe angeht und nicht denke: Das ist gut für den und das mach ich jetzt. Sondern aus eigener Erfahrung, dass man im Austausch bleibt und mitbekommt: Möchte der Mensch das überhaupt?"
Nicht immer könne sie helfen, sagt sie und findet das nicht schlimm – in solchen Fällen holt sie selbst Hilfe anderer hinzu.
In allen Situationen, in denen Menschen auf Hilfe angewiesen sind, ist das Thema Gewalt und Missbrauch präsent - in der Alten- oder Krankenpflege und vor allem beim Umgang mit Kindern. Doch vielleicht ist der Weg zum Machtmissbrauch auch nur ein kleiner und der erste Schritt dahin schon getan, sobald wir beim Thema Helfen von asymmetrischen Machtverhältnissen ausgehen und unterscheiden zwischen denjenigen, die hilflos, passiv, willenlos sind und jenen, die sich herabbeugen und helfen.
Christine Ordnung vertritt einen grundsätzlich anderen Ansatz: Derjenige, dem geholfen wird, bleibt mit in der Verantwortung, gibt diese nicht an den Helfenden ab. Der Helfer wiederum wahrt seine eigenen Grenzen und sorgt sich immer auch um sich selbst.
"Dann bin ich nicht da und helfe dem Hilfsbedürftigen, sondern dann bin ich da und will eine gute Arbeit machen und sage: Wie kann ich hier so authentisch wie möglich mit meinem Gegenüber in Beziehung gehen und mich nicht drüber stellen – wohl wissend, dass ich Mehrverantwortung habe und dass mein Job hier ist, eine Qualität des Miteinanders zu finden", erklärt sie.
"Wenn Helfen zum Problem wird"
Schon der Psychologe Wolfgang Schmidbauer hatte in seinem Ende der 1970er-Jahre erschienenen Buch von den "hilflosen Helfern" gesprochen oder auch vom "Helfersyndrom", das viele Helfende quält und antreibt.
"Wenn Helfen zum Problem wird. Wenn Hilfe sich nicht an den Bedürfnissen der Hilfsbedürftigen orientiert, sondern eine Notwendigkeit für die Helfer selbst darstellt. Die Menschen wählen oft die professionelle Helferrolle, um die eigene Hilfsbedürftigkeit abzuwehren und Patienten oder Klienten eine fürsorgende Qualität zu bieten, die sie selbst so nie erfahren haben." Grob vereinfacht sagt Schmidbauer, dass jene hilflosen Helfer aus eigener Bedürftigkeit handeln.
Die Selbstfürsorge wird vernachlässigt, der Helfende gibt sich ganz im Gegenüber auf, weil er keinen Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen hat. Diese sowie die eigenen Gefühle werden dem Gegenüber zugeschrieben. Ist der Helfende also ein potenziell Kranker, dessen guten Motiven zu misstrauen ist?
Christine Ordnung möchte Helferinnen und Helfer nicht pathologisieren, sondern kritisch auf deren Rolle schauen – um sie zu unterstützen und ihren Blick für das eigene Selbst zu stärken.
"Es ist der Kontakt zum eigenen Wesenskern, der bedeutet, dass ich mich nicht zu groß und nicht zu klein mache. Dass ich ein nüchternes Verhältnis zu meinen Fähigkeiten habe, zu meinen Einschränkungen habe. Und dann muss ich mich über niemanden stellen oder niemandem unterwürfig sein", sagt sie.
"Dann bin ich in Kontakt mit meiner eigenen Würde und muss niemanden respektlos behandeln, sondern habe meine gesamten Ressourcen zur Verfügung."
"Teilen macht glücklich"
"Es macht glücklich", sagt Natalie Koperski. "Du siehst auf einmal die Augen strahlen oder der Mensch ist in Erinnerung eingetaucht, die er gern mit dir teilen möchte. Oder zeigt eine Fähigkeit, die lange keiner bei ihm abgerufen hat, und ist auf einmal ganz freudig, dass er das mit jemandem teilen kann. Es geht ums Teilen. Es mag ein bisschen kitschig klingen, aber Teilen macht glücklich."
Christine Ordnung ergänzt: "Das ist wieder das Phänomen Beziehung. Weil wenn ich mit mir gut in Einklang bin, dann kann ich den anderen einladen, auch mit sich in Einklang zu kommen, weil ich bin ein Vorbild, ich bin in der Beziehung präsent, authentisch und eben einfühlend und mitfühlend. Ich kann das dem anderen nur in dem Maße geben, wie ich es mir selbst auch geben kann."
Hört man der Seniorenassistentin Natalie Koperski zu, kommt man nicht in Versuchung, zu denken, sie leide an einem Helfersyndrom. Doch die Mischung aus genügender Selbstfürsorge, ausgeruhter Achtsamkeit und Dialog mit dem Gegenüber und sich selbst scheint noch relativ leicht dort zu gelingen, wo es sich um selbst gewählte Beziehungen handelt.
Die oft schwierigste und zugleich häufigste Situation ist wohl jene, in der Familienangehörige einander helfen. Alte Strukturen und Rollenmuster kommen ins Spiel und der Wunsch, diese im Guten zu erfüllen, ist besonders groß.
Krankenschwester, Mutter, Erzieherin – ist Helfen weiblich?
"Ich habe gemerkt, dass man das, was ich gemacht habe, auf keinen Fall machen sollte: Nämlich sich selbst vergessen, weil der Preis einfach zu hoch ist. Ich werde ewig brauchen, gesundheitlich wieder zu dem Punkt zu kommen, wo ich vorher war", sagt Claudia Göhlich.
Sie hat fast zehn Jahre ihre Eltern gepflegt. Zuerst die Mutter, dann den Vater. Die Mittfünfzigerin ist verheiratet, berufstätig, hat einen erwachsenen Sohn. Als ihre Mutter vor zehn Jahren aufgrund einer Demenz immer mehr zum Pflegefall wird, ist es für Claudia Göhlich selbstverständlich, dass sie hilft. Auch als der Vater nach dem Tod seiner Ehefrau immer mehr abbaut, fühlt sie sich zuständig.
"Ich habe es nie infrage gestellt, weil meine Eltern das auch immer gemacht haben und das auch so vorgelebt haben", erzählt sie. "Da waren nie so Sachen von meinen Eltern: Du musst das auch machen, das erwarten wir. Es kamen schon so Sachen von meinem Vater: Ja, früher war das normal, dass die Frauen gepflegt haben."
Der Bruder hingegen, der ebenfalls in derselben Stadt lebt, hilft nur aus der Ferne. Beim Sterben der Mutter erklärt er, dass er damit nicht umgehen kann, und hält Distanz. Auch zu dem immer hilfsbedürftiger werdenden Vater kommt er mehr zu Besuch, als dass er Aufgaben übernimmt, die für die Tochter hingegen immer zahlreicher werden.
Hat Claudia Göhlich ihn um Hilfe gebeten? "Das habe ich auch ganz oft gesagt, aber dann kam immer: Ja, aber du reißt das alles an dich und niemand macht das gut genug für dich", sagt sie. "Das stimmte zum Teil, auch beim Pflegedienst. Die durften die Tür aufmachen, dann haben sie die Zeitung hingelegt, dann wurden sie wieder weggeschickt."
"Ich kann ihn ja nicht hängen lassen"
Zuerst seien es nur kleine Dinge gewesen, dann wurden es mehr und Claudia Göhlich musste ihren Job reduzieren. Sie arbeitet als Kosmetikerin mit krebskranken Menschen.
"Ich glaube, ich habe oft genug gebeten, dass jemand kommt, es kam aber keiner. Ich habe dann zwar gemotzt und gemeckert, ich habe es aber gemacht, das war der Fehler. Statt zu sagen: Nein, ich mach es nicht mehr, bin ich immer wieder rein und hab gesagt: Okay, ich kann ihn ja nicht hängen lassen, außer mir geht ja keiner hin", erzählt sie.
"Mein Vater hat das auch immer ganz gut gekonnt. Nicht dass er jetzt Ansprüche hatte: 'Du musst mich pflegen.' Das war eher so: 'Naja, wenn dann keiner kommt, das ist ja nicht schlimm. Ich bin ja ein alter Mann, wenn ich jetzt hier umkippe, ist das nicht schlimm.' Diese Vorstellung, dass ihm was passiert und da geht keiner hin, war für mich unerträglich."
"Liebe" steht auf einem Bild im Wohnzimmer von Claudia Göhlich. Ohne Punkt, ohne Ausrufezeichen – eine einfache Tatsache, die keinen weiteren Kommentar benötigt. Doch ihre Liebe allein sei nicht der Grund gewesen, weshalb sie sich selbst in dieser Aufgabe so vergaß.
"Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich das Mädchen bin. Das ist ja generell in unserer Gesellschaft leider noch immer so, dass es eher eine Frauensache ist als eine Männersache", sagt sie.
Viele helfende Berufe bis heute weiblich besetzt
Dass sich diese Vorstellung auch im 21. Jahrhundert weiter hält, ist wohl mit ein Grund dafür, dass viele helfende Berufe bis heute weiblich besetzt sind. Und: Die vielen Altenpflegerinnen, die Krankenschwestern und Erzieherinnen gehören zu jenen, die für ihre Arbeit nicht nur chronisch unterbezahlt werden, sondern deren Arbeitsbedingungen schlecht und unwürdig sind.
Dabei ist die Geschichte der Krankenpflege auch eine der weiblichen Emanzipation. Dann jedenfalls, wenn man auf ihre wohl wichtigste Pionierin schaut: die Britin Florence Nightingale. Sie gilt nicht nur als die Reformerin des modernen westlichen Sanitätswesens, Nightingale war auch eine Rebellin, die sich ihren Platz gegen viele Widerstände erkämpfte.

Nicht nur die helfenden Berufe sind überwiegend weiblich besetzt, auch der überwiegende Teil jener, die Angehörige pflegen, sind Frauen.© picture-alliance/ gms / Patrick Pleul
Und heute? Der überwiegende Teil jener, die Angehörige pflegen, sind Frauen. Der Anspruch an sie ist hoch- oft auch der eigene.
"Ich habe immer gemacht und dann hatte ich immer das Gefühl: Ich hätte noch ein bisschen mehr machen können. Bei allen anderen wurde immer entschuldigt", sagt Claudia Göhlich.
"Ich hatte immer das Gefühl, bei allen anderen ist Verständnis, aber bei mir nicht. Weil du kannst das besser, du machst das nebenbei. Und ich habe immer gedacht, das ist so herabwürdigend, weil Pflege ist nicht nebenbei, niemand pflegt nebenbei."
Schließlich wird es seelisch und körperlich zu viel, sodass Claudia Göhlich bei der Arbeit zusammenbricht.
"Jetzt einfach mal Stopptaste"
"Beim Arzt hatten sie den Verdacht auf einen Herzinfarkt, weil mein Blutdruck so hoch war und ich so einen hohen Puls hatte und Aussetzer. Dann musste ich ins Krankenhaus zu einem Herzkatheter und da wurde dann der Verdacht auf einen Nierentumor geäußert", erzählt sie.
"Den hatte ich Gott sei Dank nicht, aber eine komplette Insuffizienz der Nebennieren. Die sind durch die Dauerbelastung und den Stress einfach zusammengeklappt. Und dann hat der Arzt gesagt, es wäre jetzt mal Zeit, sich selbst zu retten."
Unter großen Gewissensbissen und viele Tränen weist sie den Vater zunächst in ein Heim ein. Eine Entscheidung, die sie ganz allein trifft. "Ich habe gemerkt, der einzige Mensch, der das unterbrechen oder verändern kann, bin ich selbst, indem ich sagen: So, jetzt einfach mal Stopptaste. Jetzt drück ich sie, jetzt geht es nicht mehr."
Nach dem Tod des Vaters hat sie das erste Mal seit fast zehn Jahren wieder Zeit für sich und möchte wieder ganz gesund werden. Doch die lange, aufopferungsvolle Pflege ihrer Eltern hat Claudia Göhlich nicht nur gesundheitlich gefordert, sie hat ganz reale Folgen für ihre Altersvorsorge.
Denn für die geleistete Arbeit bekommt sie zwar Pflegepunkte und Rentenanteile - mit dem, was sie in ihrem Job verdient hätte, sei das aber nicht vergleichbar.
"Wir müssen mal ganz ehrlich sagen: 70 Prozent der Menschen, die pflegebedürftig werden, werden zu Hause von den Angehörigen gepflegt. Und die müssen viel, viel mehr unterstützt werden", fordert sie. "Weil es ganz oft Frauen betrifft so wie mich, die nicht so hohe Verdienste haben und die ganz oft verzichten, weniger arbeiten und das machen – und dann hinterher noch weniger Rente kriegen, um dann selber, wenn sie alt sind, ein Sozialfall zu sein. Dass es dann heißt: Ja, da hast du jetzt aber leider Pech gehabt."
Soziale Gerechtigkeit und karitatives Engagement
Nicht nur für die vielen privat Helfenden und Pflegenden braucht es größere soziale Unterstützung und andere Strukturen, sagt der Krankenpfleger Ricardo Lange und fordert von der Politik konkrete Maßnahmen.
"Was sich bei uns im Beruf ändern müsste, wäre zum einen, dass wir wieder Dienstpläne haben, die familientauglich sind. Also Dienstpläne, wo eine Kraft nicht drei oder vier Wochenenden im Monat arbeiten muss, um überhaupt auf Geld zu kommen. Um das zu realisieren, bräuchte man einfach mehr Personal", erklärt er.
Frühere Berentung für diese körperlich fordernden Berufe und Alterszuschläge sowie eine bessere Organisation der Schichtdienste schlägt er vor, um mehr Menschen für den Job zu gewinnen. Denn an dem Wunsch zu helfen mangele es in unserer Gesellschaft nicht – allein die große Zahl der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer scheint Ricardo Lange recht zu geben.
Soziale Gerechtigkeit ist das, was der intensivmedizinische Pfleger auch für seine Patientinnen und Patienten fordert. "Wenn man an der Basis arbeitet, am Menschen, dann sieht man, was für ein Nachteil es ist, wenn das Gesundheitssystem darauf ausgelegt ist, an dem Menschen Geld zu verdienen."
Die globale Dimension des Helfens
Die Forderung nach gerechter Versorgung ist eine globale, weiß der Kinderkardiologe Matthias Angres aus seiner Arbeit in Afrika und dem Nahen Osten.
"Wie hat ein armes Land eine Chance, ein Medikament zum gleichen günstigen Preis zu bekommen wie in Deutschland? Nicht für den 40-fachen Preis", kritisiert er. "Wie bekomme ich es hin, dass westliche Firmen, die Beatmungsgeräte oder Röntgengeräte bauen, das nicht für den 20-fachen Preis anbieten?"
Inwieweit unsere Gesellschaft Strukturen schafft, um Hilfe zu ermöglichen, daran lässt sich für den Arzt der Grad unserer Menschlichkeit und Zivilisiertheit ablesen. Als hilfloser Helfer fühlt er sich nicht aus innerer Not heraus, sondern dann, wenn er auf Strukturen stößt, die Hilfe verhindern.
"Wenn man dann spätestens dreimal enorme Frustration erlebt hat: Ich müsste diesem Kind helfen, aber ich kann nicht, weil wir gar nicht die Ressourcen haben. Das sind die tiefsten Punkte, an die man sich begeben kann, wenn man jemandem vor Ort die Hilfe nicht geben kann, die man geben müsste", sagt er.
*Redaktioneller Hinweis: Wir haben eine fehlerhafte Transkription des Audios korrigiert.
Autorin: Kai Adler
Ton: Christine Neumann
Regie: Stefanie Lazai
Redaktion: Martin Hartwig