Die Erstausstrahlung des Features war am 27. September 2021.
Leipziger Hausprojekt 1989/90

Bis heute verbunden: Für eine Gruppe Jugendlicher in Leipzig brachte der Herbst 1989 eine sehr intensive Lebensphase. © Michael Zettler
Zwischen den Fronten im Jahr der Anarchie
29:58 Minuten

Alles war möglich: Nach dem Zusammenbruch der DDR besetzt ein Freundeskreis in Leipzig drei Häuser, gründet eine Galerie und ein Café. Keiner redet ihnen auf ihrer kleinen Kulturinsel rein. Wie blickt jede und jeder Einzelne auf die Zeit zurück?
Gerade Abitur, dann überschlagen sich die Ereignisse in Leipzig. Der Aufbruch in die Freiheit im Herbst 1989 kommt für eine Gruppe Jugendlicher genau zur richtigen Zeit.
"Wir sind zum Glück gerade so davongekommen. Aber je länger wir in der DDR gelebt hätten, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kompromisse bei vielen immer größer geworden wären. Ein Jahr später, und vieles wäre ganz anders gewesen. Dann hätten sich Lebensläufe schon extrem getrennt", erzählt Jan.
"Es war im besten Sinne, im allerpositivsten Sinne ein Experiment der Freiheit", meint Alex.
"Das war ja zu der Zeit so, dass gerade viele Jugendliche oder Leute in unserem Alter ein bissel orientierungslos waren, die wechselten munter zwischen rechtem und linkem Lager hin und her, zwischen weißen und roten Schnürsenkeln. Genau", erinnern sich Friedrich und Matthias.
"Das intensive Gemeinschaftsleben hat so tiefe Spuren hinterlassen, die man nicht wieder aus dem Leben wegwischt. Und die Spuren sind Gott sei Dank alle sehr, sehr positiv", sagt Kai.
Ein Raum ohne Kontrolle, der verbindet
Jedes Jahr zu Pfingsten kommen wir aus Liechtenstein, Essen, Oldenburg, Berlin und Leipzig zusammen. Zu unseren Pfingsttreffen. Die gibt es bereits seit über 30 Jahren, denn damals begann unsere gemeinsame Geschichte. Drei Häuser haben wir besetzt, mitten in Leipzig. Hier in der Sternwartenstraße, die bei uns bis heute Stewa heißt.
Kai wohnt wie ich bis heute in Leipzig. Ein Faible für Autos hatte er schon immer, vor 30 Jahren waren es die alten, runden 500er Trabis und 311er Wartburgs. Heute leitet er eine Autolackfirma mit mehreren Angestellten, die er von seinem Vater übernommen hat.
Eigentlich begann alles 1988, noch mitten in der DDR. Wir, das waren außer Kai und mir zehn weitere mehr oder weniger aufmüpfige Jugendliche. Wir hatten uns während der Abiturzeit an der Schule kenngelernt. Für unsere Treffen suchten wir einen Freiraum jenseits aller Kontrolle: fern von den Eltern, fern von der Schule und damit auch fern vom Staat.

Blick in die Leipziger Sternwartenstraße - vom Freundeskreis Stewa genannt.© Privatarchiv Ute Lieschke
"Dann kam, wer auch immer, auf die Idee, schauen wir doch mal, ob es nicht irgendwo in einem besetzten Haus freie Räume gibt. Dann haben wir einen Tipp bekommen und sind in die Stewa 25", erzählt Kai.
"Zufälligerweise kam dann sogar jemand aus der Tür, den wir fragen konnten, und der hat gesagt: Ja, klar, die Wohnung wird frei, könnt ihr rein, und hat uns reingelassen. Dann waren wir halt drin. Und wenn man einmal drin war in einer besetzten Wohnung, ist man in der Regel nicht wieder rausgegangen."
Stille Besetzungen – wegen Wohnungsnot in der DDR
"Schwarz wohnen" nannte sich das damals in der DDR. Im Gegensatz zu heute waren es stille, private Besetzungen. Man zog einfach in leer stehende Altbauwohnungen, weil die städtische Wohnungsverwaltung schlichtweg nicht hinterherkam. Das war zwar illegal, doch meist geduldet.
In der ersten "Kommune", wie wir sie alle nannten, ging es jedoch weniger ums Wohnen. Sie war vielmehr ein Begegnungsort, den wir dringend brauchten: für hitzige Diskussionen oder Partys mit lateinamerikanischer Musik, auf denen wir die Schritte aus der Tanzstunde ausprobierten.
Als dann ein großes Konzert mit der Ska-Band Messer Banzani stattfand, hätte das schiefgehen können. "Da waren dann auch mal richtig viele Leute, die Wohnung war voll. Das war auch das einzige Mal, wo es wegen Ruhestörungen Konflikt mit der damaligen Volkspolizei gab", erinnert sich Kai.
"Aber ein Konflikt war das eigentlich gar nicht, weil die Polizei war zwar in der Wohnung und hat geschaut, was wir da machen. Sie hat lediglich gesagt, wir sollen die Musik ein bisschen leiser stellen – was wir auch gemacht haben – und ist wieder gegangen. Das war's."
Wir hatten wohl einfach nur Glück. Denn tun und lassen, was man wollte, konnte man in der DDR natürlich nicht. 1989 nach dem Abitur war unsere erste Kommune vorbei. Am 1. September zogen die meisten unserer Jungs in die NVA-Kasernen.
Herbst 1989 aus unterschiedlichen Perspektiven
Für uns, die wir in Leipzig blieben, stand bald alles auf dem Kopf. Die Montagsdemonstrationen veränderten sich, es ging nicht mehr ums schnelle Ausreisen. Hinter dem neuen Ruf "Wir bleiben hier" stand der Wunsch nach Reformen. Das hatte plötzlich auch mit uns zu tun.
Während ich anfing, in einer Musikalienhandlung zu arbeiten, begann meine Freundin Verena nach dem obligatorischen Erntelager ein Dolmetscher-Studium. "Und als ich dann wiederkam, Mitte, Ende September, da merkte ich, dass sich in der Stadt was verändert hat", erzählt sie.
"Gleichzeitig war ich aber an einer sehr politisch eingestellten Universität eingeschrieben, die diese Demonstrationen natürlich nicht befürwortet hat. Auf der einen Seite wollte ich da gerne auch mitmachen, mit den Freunden auf die Straße gehen. Auf der anderen Seite war ich eben Student und hatte gesagt bekommen, wir sollen da nicht dran teilnehmen."
Während sich in Leipzig die Situation bis zum 9. Oktober immer mehr zuspitzte, saß die andere Hälfte unseres Freundeskreises hinter Kasernenmauern. Halb unwissend und mit dem mulmigen Gefühl, gegen die Bevölkerung oder sogar gegen uns auf den Montagsdemos eingesetzt werden zu können. "Wir haben mitbekommen, dass es irgendwie rumort", erzählt Kai.
"Wir hatten dann am Morgen des 9. Oktober zumindest auf dem Appellplatz anzutreten: Es gibt eine schwierige Situation, es kann sein, dass ihr das Land verteidigen müsst, et cetera … Und man hat uns aber gefragt: Wer will das nicht? Natürlich hat sich keiner getraut, vorzutreten, weil alle ja nur Angst hatten."
Menschenmassen und gespenstische Stille am 9. Oktober
Philipp musste erst später zur Armee und arbeitete zu jener Zeit in Leipzig als Praktikant in der Uniklinik. Dort machte man sich auf das Schlimmste gefasst.
"Das ganze Personal hat an dem Tag quasi keinen Feierabend bekommen. Die durften alle die Klinik nicht verlassen, nur ich durfte gehen. Weil man da wahrscheinlich mit Verletzten oder Schwerverwundeten gerechnet hat. Ja, das war die Situation. Also es war dort Alarmzustand", erzählt er.
Leipzig war an diesem 9. Oktober voller Einsatzwagen der Bereitschaftspolizei und Armeefahrzeugen. Nicht auf den ersten Blick sichtbar in den Nebenstraßen, doch überall spürbar. Gemeinsam fühlte es sich besser an. Verena war auch gekommen und zwei weitere Freunde, Friedrich und Jan.
"Also ich bin allein dorthin gefahren, meine Eltern wussten nichts davon. Und dann haben wir uns irgendwo in der Stadt getroffen oder bei dir. Ich weiß aber genau, dass wir uns die ganze Zeit untergehakt hatten", sagt der eine von beiden.
"Es war gespenstisch, weil man sich das gar nicht vorstellen kann: 70.000 Leute. Und es war total still. Es hatten alle Angst, ich auch, und man lief dort einfach und alle waren still, auch um zu horchen, ob da jetzt irgendwas passiert, ob irgendwo was losgeht", ergänzt der andere.
"Dass man so viele Momente, auch wichtige Momente, geteilt hat, die jetzt ´Weltgeschichte‘ sind, wenn man so möchte ... Wir sind an dem Tag untergehakt über den Ring gelaufen, das schmiedet zusammen. Das wird immer bleiben. Das ist wirklich etwas Besonderes. Das wird man auch nicht vergessen", sagt Jan.
"An jedem Tag ist etwas Neues passiert"
Verena erzählt. "Dann ging das alles ganz schnell. Also plötzlich – auch an der Uni – wurde alles etwas lockerer. Das heißt, bestimmte Dinge wurden nicht mehr verboten. Es wurden zum Beispiel diese marxistisch-leninistischen … diese Seminare haben nicht mehr stattgefunden. Und plötzlich war schon der Mauerfall. Im Nachhinein waren das ja Tage, in denen an jedem Tag irgendetwas Neues passiert ist. Die Veränderungen konnte man eigentlich gar nicht so verarbeiten."
Zu Silvester rebellierten die Soldaten in Beelitz. Philipp war dabei und stellte mit anderen einen Forderungskatalog auf. Für alle Soldaten der NVA wurde ein vorzeitiges Ende der Kasernenzeit ausgehandelt. Nicht nur die starren Strukturen der Armee brachen in kürzester Zeit zusammen, alle bisher in Stein gemeißelten Gesetze und Kontrollinstitutionen schienen sich aufzulösen.
Der Ruf nach "Deutschland einig Vaterland" auf den Montagsdemos wurde lauter. Der Traum von einer reformierten DDR zerplatzte viel schneller als gedacht. Ich erinnere mich noch an einen symbolischen Sarg, in dem die Reformideen nach den Wahlen im März zu Grabe getragen wurden.
Plötzlicher Freiraum, Rückkehr in die Sternwartenstraße
Doch neben der Wehmut spürten wir auch den Freiraum, der uns plötzlich die Möglichkeit bot, genau das zu tun, was wir gerade wollten. Diesmal ohne alle Beschränkungen.
Philipp erinnert sich: "Als wir dann viel früher als geplant zurückkamen, haben wir wieder was Neues gesucht und haben auch wieder angefangen, in der Sternwartestraße zu suchen. Wir trafen auf einen Mann in einem Kittel, in einer Art Hausmeisterkittel, der dort rumlief und sagte, ihr müsst unbedingt diese Häuser retten. Da sind jetzt die letzten Bewohner ausgezogen. Und wenn ihr nicht dort einzieht, dann wird das abgerissen."

"Ihr müsst unbedingt diese Häuser retten": Ein Mann mit Hausmeisterkittel hatte die Schlüssel.© Privatarchiv Ute Lieschke
So bekamen wir dann von Klaus, wie der Mann im Hausmeisterkittel hieß, zu jeder Wohnung die Schlüssel und zogen ein. Die Armeerückkehrer mit Philipp in die 39, Verena mit ihrem Freund in die 37. Und ich zog mit drei Freunden in die 35.
Bunte Parolen an abgebröckelten Fassaden
Alex lebt heute im Nordwesten Deutschlands und arbeitet dort als Journalist, ist zudem Historiker und leidenschaftlicher Jäger. Doch er verbringt auch viel Zeit in Leipzig, wo er nach wie vor einen zweiten Wohnsitz hat. Hier besuche ich ihn.
Die Häuser in der Sternwartenstraße hat Alex noch genau vor Augen. "Das waren ja innenstadtnahe Häuser, die im Grunde in einer sehr guten Gegend lagen, im 19. Jahrhundert, als sie erbaut worden sind. Deswegen waren diese Wohnung natürlich großbürgerlich, mit fünf, sechs, teilweise sieben Zimmern, einer großen Küche und DDR-Standard, der eben aus Kohlebadeöfen bestand, der natürlich abgewohnt war", erzählt er.
"Wir haben die Bude dann erst mal mit den Farben, die wir hatten, gestrichen und teilweise haben wir Möbel aus anderen Abbruchhäusern rausgeholt. Na, von außen sahen die Häuser eben so aus, wie sie in der DDR aussahen: also abgebröckelter Putz. Wir haben dann die Fassaden ein bisschen verschönert – mit Parolen."
An Alex‘ Wohnung gab es ein Anarcho-"A", im Treppenhaus ein Hausbesetzerzeichen, aber eine Hafenstraße, das waren wir nicht. Blickt man auf die Fotos, so zeigen sie viel mehr: Frieden steht in großen Buchstaben über dem Rollladen. An der Brandmauer des letzten Hauses hatte sich mein Mitbewohner Matthias den Liebeskummer von der Seele geschrieben.
"Tine, ich liebe dich", prangte über Jahre dort, später gab es sogar eine Postkarte davon. An Verenas Fenster klebte eine Freiheitsstatue, und bei Friedrich hielt sogar bereits der Wahlkampf für die ersten freien Wahlen Einzug. In roten Lettern hatte er "SPD" auf seine Tür gesprüht. So weit reichte der Freiraum, den wir uns untereinander einräumten. Später dominierte der Schriftzug der "Galerie Zone" die Häuser.
Der leerstehende Laden wird zum Szene-Café
Doch erst einmal eröffneten wir in einem ehemaligen Ladengeschäft unser Café. Für Peter, der heute eine psychiatrische Klinik leitet, war es ein Club, ein Ort des Austausches im besten Sinne.
"Das war keine räudige Atmosphäre, sondern es war ja schon eine verrauchte, verwinkelte Bude mit einzelnen Kompartimenten", erinnert er sich.
"Es gab drei Hinterzimmer. Die Freunde und Gäste saßen zusammen, haben sich die Köpfe heißgeredet und es war halt Open End: Manche saßen bis zum Morgengrauen. Es gab eine bescheidene, aber sehr gut funktionierende Bar. Ich glaube, zentral waren Kaffee, Mineralwasser und vielleicht ein Glas Bier."
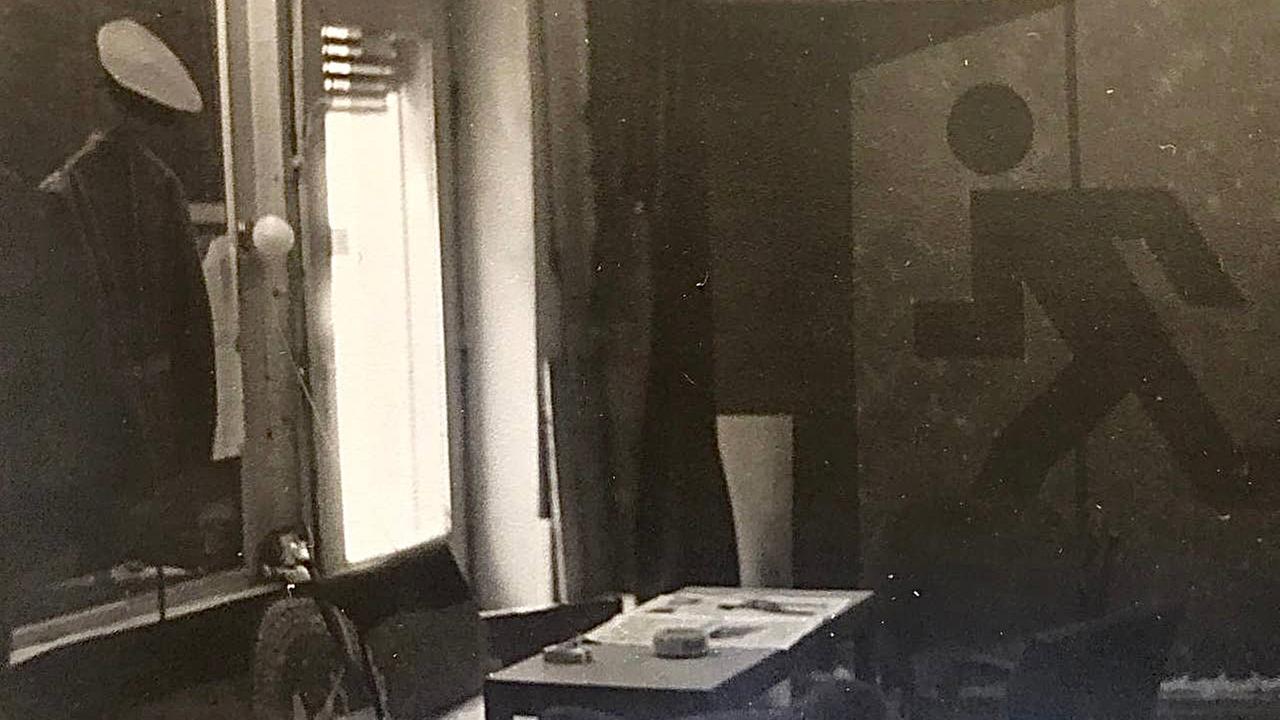
Jeder hatte reihum Schicht: Das Café sprach sich schnell herum und wurde ein kultureller Experimentierraum.© Privatarchiv Ute Lieschke
Es war im Jahr der Anarchie ganz einfach: Es gab keine Szenekneipen, also eröffneten wir eine. Ohne Papiere, ohne Genehmigungen. Illegal, schon das Wort hörte sich falsch an, denn es schien keine Gesetze mehr zu geben. Wir besorgten Möbel aus Abrisshäusern und Kaffeemaschinen aus der aufgelösten Stasizentrale.
Ein Ort zum Experimentieren und Austauschen
Jeder hatte reihum Schicht. Das Café sprach sich schnell herum und wurde ebenso ein kultureller Experimentierraum. Mit eigenen Theaterinszenierungen und Gästen. Jeder nutzte seine Netzwerke oder die Künstler kamen von selbst. Denn auch freie Bühnen entstanden gerade erst.
An einem Abend kam der Liedermacher Jens Paul Wollenberg, an einem anderen die Folkband Dinner Ladies aus England, am dritten spielte eine Punkband.
"Im Grunde war diese Kneipe so eine Art politischer Berührungsraum zwischen auch vielen Leuten im Haus, die dort gewohnt haben, die eben damals wenig politisch waren: Für mich, wenn ich mich zurückerinnere, manchmal etwas zu wenig politisch. Aber diese Leute kamen dann eben von außen", erzählt Alex.
"Es wurde natürlich diskutiert, es wurde auch geschrien, es wurde mit Argumenten gekämpft, es gab auch mal eine Handgreiflichkeit, auch das gab es. Aber das waren ganz, ganz, seltene Sachen. Aber es wurde eben auch um Ansichten gekämpft, um Ansichten gestritten. Das war ja auch gar nicht anders möglich, denn es war ja eine Zeit der Umbrüche, wo sich jeder auch neu orientieren musste. Wir waren jung, also ohnehin schon in einer Orientierungsphase, und dann kam noch dieses dazu."
"Ich hätte es gern politischer gehabt"
Wir alle vertraten linke Ansichten, aber keine radikalen wie Alex. Doch wir tolerierten sie. Im Gegenzug vertrat er nach außen hin unseren Konsens. Sei es in einem Zeitungsinterview oder sei es auf dem Marktplatz, als wir mit einem kulturpolitischen Manifest an die Öffentlichkeit gingen.
"Wie gesagt, ich hätte es gern ein bisschen politischer gehabt", sagt Alex rückblickend. "Aber ich habe natürlich auch mitgemacht. Wir haben uns da auf dem Markt gestellt, einige haben mit Blockflöte und Klampfe Lieder gespielt. Wir haben dort sehr stark kulturell geprägte Programme verteilt, um auf uns aufmerksam zu machen."
Die beiden mit Blockflöte und Gitarre, das waren der spätere Galerist Jan und ich. Musik erschien uns der unverfänglichste Weg, um Leute für unser Hausprojekt zu gewinnen.
Der Kampf rechts gegen links brodelt
Doch dann gab es ein Ereignis, das unseren Platz, unsere kleine Kulturinsel, die wir gerade gefunden hatten, infrage stellte. Nicht von innen heraus, sondern von außen. An einem Samstagabend brannte nur im Haus Nummer 35 noch Licht. Ich selbst war nicht zu Hause.
Mein Mitbewohner Matthias, der heute Filmmusik schreibt, und Friedrich, heute Rechtsanwalt, erinnern sich noch genau an den Skinhead-Überfall. Zu unserem Treffen habe ich Fotos mitgebracht.
"Wir haben in der Küche gesessen und hatten irgendetwas gekocht, Nudeln. War ein schöner Abend gewesen. Und dann gab es Tumult auf der Straße. Durch geschlossene Fenster flogen Ziegelsteine, nein, Pflastersteine rein. Und dann haben wir schon gemerkt, dass da eine riesige Gruppe von Typen irgendwie die Treppe hochkommt, und die haben versucht, die Tür einzutreten. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach die Tür auf, weil wir waren ja vollkommen überfordert mit der Situation. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Ich mache die Tür auf, und da steht ein Bekannter aus meiner Nachbarschule und guckt mich an, und ich gucke den an. Der war auch total irritiert. Dann kam aber eben von hinten schon irgendjemand, hat sich vorbeigedrängt mit einem Stuhlbein. Dann hatte ich gleich einen über dem Schädel und habe mich instinktiv fallen lassen. Und dann sind die da durch die Wohnung. Also ich hatte große, große Angst", erzählt der eine von beiden.

"So etwas hatte ich noch nie erlebt": Die Küche nach dem Überfall der Skinheads.© Privatarchiv Ute Lieschke
"Dann flog alles durch die Gegend. Also ich hatte so einen kleinen Stereo Kassettenrekorder, der flog aus dem Fenster raus. Der Fotoapparat, den ich von meiner Oma gekriegt hatte, flog zum Fenster raus. Die haben einfach alles zerkloppt, kurz und klein geschlagen", erzählt der andere. "Ich bin nach unten auf die Straße gerannt, da ist mir nichts passiert, und habe versucht, eine Telefonzelle zu finden. Bestimmt mit einer halben bis einer dreiviertel Stunde Verspätung kam dann mal ein Polizeiauto langsam durch die Straße, sah dann, was da los ist, und fuhr gleich wieder weg. Also die konnten überhaupt nix machen."
Der Überfall der Skinheads – ein Schock
Warum hatten sich die Skinheads ausgerechnet unser Haus ausgesucht, war es nur rohe Gewalt nach einem Fußballspiel? Hatten wir mit unserem Aktivismus, der einen linken Stempel trug, provoziert?
Die Toleranz, mit der wir uns gegenseitig akzeptierten, so lernten wir, galt nicht für die gesamte Gesellschaft. Das Jahr der Anarchie gab auch extremistischen Einstellungen freien Lauf.
Die persönlich erlebte Gewalt bedeute für einige von uns den Anfang vom Ende. "Nach diesem Überfall habe ich dann dort auch emotional nicht mehr gewohnt", sagt Matthias.
Friedrich, dem körperlich nichts passiert war, sah das anders. "Wir waren natürlich erst mal irritiert, aber so eine richtig grundsätzliche Angst ist nicht eingezogen. Wir haben einen riesigen Riegel innen an unsere Wohnungstür gebaut, der wurde dann nachts einfach da vorgemacht."
In Ruhe weiterleben oder in den Kampf einsteigen?
Die Versuchung, eine radikalere Richtung einzuschlagen, lag kurz nahe. Denn die bereits erprobten Hausbesetzer aus der Stöckartstraße in Leipzig-Connewitz wollten uns bei einem Treffen unter die Arme greifen.
"Da ging es darum, wie man sich verteidigt, Gitter vor den Fenstern, Wachen auf den Dächern. Also die waren teilweise aus Westberlin und waren sozusagen richtige Hardcore-Hausbesetzer und wollten nun, dass wir den Hausbesetzerkampf dort übernehmen. Das war aber überhaupt gar nicht unser Interesse, wir wollten einfach nur dort in Ruhe wohnen", erinnert sich Friedrich.
Der doppelseitige Artikel, der nach dem Überfall in der "DAZ", der "Anderen Zeitung" erschien, beschreibt zumindest Philipp beim Vergittern der Fenster, eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Es blieb bei dem einmaligen Überfall, obwohl wir in Leipzig nun als Hausbesetzer bekannter waren als vorher.
Der Anspruch des Cafés versackt im Alkohol
Das Ende unseres Cafés hatte andere Gründe. Der intellektuelle Anspruch mit Gesprächen und Kleinkunstbühne scheiterte an der Realität frühmorgens um vier.
"Ich kann mich nur noch erinnern, wie du sicherlich auch, wie man da die Leute am Schlafittchen packen musste und vor die Tür werfen. Weil die nicht mehr gehen wollten und konnten. Sie waren nur zum Saufen da, und darauf hatten wir eigentlich keinen Bock mehr", erzählt Kai.
Zudem stand die Währungsunion am 1. Juli vor der Tür. Mit dem neuen Geld, so schien es uns, könnten wir nicht mehr so weitermachen wie bisher. Denn die D-Mark bedeutete den ersten Schritt in ein neues Land mit neuen Gesetzen.
Kurz zuvor kauften wir uns vom gemeinsam verdienten DDR-Geld einen blauen 311er Wartburg und fuhren zu Pfingsten in den Harz. Seitdem gibt es unsere jährlichen Pfingsttreffen.
"Galerie Zone" – ein Spielplatz für die Freiheit der Kunst
Bevor das Café ging, kam bereits etwas Neues, die "Galerie Zone". Für Jan, der mittlerweile mit seinem Partner in Berlin lebt und als Kunstpädagoge in Neukölln arbeitet, ist der spielerische Umgang mit Kunst von damals bis heute prägend. Ich bringe ihm einige Zeitungsartikel mit.

"Galerie Zone": Eine Performance gehörte zu jeder Ausstellungseröffnung.© Alexander Will
"Es war alles neu. Das war wirklich ein Spielplatz, und das hat es sehr attraktiv gemacht. Also, dass man überhaupt keinen Druck hatte, an nichts denken musste, weil es eigentlich nichts Vergleichbares gab", erzählt er.
"Es war nichts reglementiert, wir konnten machen, was wir wollten, und ob die Ausstellung jetzt gut war oder schlecht, das hat erst mal gar keine Rolle gespielt. Es war auch ein Ort, einfach zum Treffen, Leute kennenzulernen. Das war toll."
Zu jeder Ausstellungseröffnung eine Performance
Der Name der Galerie Zone entstand aus der damals gängigen, etwas abschätzigen Bezeichnung für das Land, aus dem wir kamen – und das gerade unterging.
"Das war ja auch so ein Freiraum, also Zone: Wirklich auch ein Niemandsland, das man ein bisschen unterschätzt, dem man nichts zutraut, wo man so ein bisschen eben abgeschottet, etwas machen kann. Das gefiel uns. Es gab da kein Konzept in dem Sinne, interessanterweise. Alles, was man so aufgeschnappt hatte, was man eben unter zeitgenössischer Kunst versteht, was zu DDR-Zeiten eben was ganz anderes war", erklärt Jan.
"Also es gab die Beuys-Ausstellung in Leipzig schon zu DDR-Zeiten, wir hatten schon eine Ahnung, dass es ganz andere Dinge gibt als den sozialistischen Realismus. Aber Performance hatten wir, glaube ich, noch nie live gesehen und haben sie dann bei der Eröffnung selbst gemacht. Wir haben uns wirklich ausprobiert, und das war ganz spielerisch und hemmungslos."
Eine Performance gehörte dann auch zu jeder Ausstellungseröffnung. Jeder von uns brachte sich mit Ideen ein, jeder machte mal mit.
"Die Eröffnungsperformance war die größte, die wir gemacht haben. Hinten im Hinterhof gab es eine Anstalt, Textil oder was das war: ‚Max H. Wolf‘ stand da noch verwittert dran. Das war dann sozusagen der Urahne, dessen Geist wir beschwören wollten. ‚Max H. Wolf lebt‘, wurde dann gerufen aus den offenen Fenstern, und dann wurde eben wirklich ein Fahrrad angezündet", erinnert sich Jan.
"Dann kam jemand, ich sehe es gerade hier, verkleidet mit Helm auf, mit Feuerlöscher und löscht das Fahrrad. Dann wird dieses Klo runtergeworfen und dann rief Robert auf einer Leiter stehend, ‚Kunst ist über alle Maßen sinnlos‘." Die Leute hätten dagestanden und sich gefragt, was ist das? "Aber wenn ich mir das Bild hier anschaue, wie alle so im Hof sitzen und stehen. Dass das plötzlich ging, das war Glück, das war wirklich absolute Freiheit."
Wie ging das Projekt zu Ende, was ist geblieben?
Wir begannen alle mit dem Studium, nach und nach zogen wir aus und gingen nach Frankreich, Spanien oder Israel. Das, was vorher in der DDR nie möglich gewesen wäre. Mit dem Blick von außen fiel es uns zunehmend leichter, das geeinte Deutschland als unser neues Land zu akzeptieren.
Micha blieb fast bis zum Ende in der Stewa wohnen. Die Verwaltungsgesellschaft sägte am Ende das Treppenhaus heraus, um das Haus zu räumen. Erst um die Jahrtausendwende wurden alle drei Häuser abgerissen.
Jan gründete weitere Galerien in Leipzig. Zuletzt gemeinsam mit Peter eine kommerzielle Galerie, unweit der Leipziger Spinnerei. Doch nach drei Jahren scheiterte das aus Freundschaft hervorgegangene Projekt und hat Narben hinterlassen. Peter führt die Galerie nun in anderer Konstellation weiter.
"Der Schutzschirm, der so auch unsere Freundschaften, die Zusammenarbeit behütet hat, der war immer sehr weit gespannt. Und in so einer engen Kooperation wurde er sehr eng", erzählt er.
"Mit anderen Worten, wir haben uns einfach nicht, wie es erforderlich ist, präzise über unseren Arbeitsstil, unsere konkret auch Ziele, ausgetauscht. Ich denke, das Problem an der Stelle war, dass wir einander begegnet sind, so wie wir uns auch in den 90ern kannten. Das ist nicht genug für ein Projekt dieser Größenordnung."

Pfingsttreffen 1991: Die alljährlichen Zusammenkünfte, die der Freundeskreis bis heute praktiziert, bleiben ein Experiment.© Privatarchiv Ute Lieschke
Alex beschäftigt sich heute als Journalist weiterhin intensiv mit Politik. Seine Ansichten haben sich stark gewandelt, doch er polarisiert nach wie vor gern.
"Es war eine Kritik an der DDR von links, die sich vor allen Dingen daran aufgehangen hat, dass die persönliche Freiheit so sehr eingeschränkt war. Das ging so in die Vorstellungen in Richtung Räterepublik, in Richtung eines sehr stark auf Basisdemokratie ausgelegten dritten Weges. Daran glaube ich heute schon lange nicht mehr", sagt er.
"Das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich irgendwann erkennen musste, dass so etwas immer im Kollektivismus endet und dass immer irgendwelche Leute in ihrer persönlichen Freiheit hinten runterfallen. Deswegen würde ich sagen, bin ich vielleicht heute ein Radikalliberaler, vielleicht schon ein Libertärer – und kann damit auch ganz gut meine Vergangenheit konstruieren."
Gemeinsamkeiten trotz großer Entfernung heute
Unser Freundeskreis hat sich bis heute eine gewisse Toleranz erhalten, auch wenn diese kleiner geworden ist. Das Jahr der Anarchie kannte keine fertigen Meinungen, jeder von uns war auf der Suche. Das ist heute anders. So bleiben unsere Pfingsttreffen ein Experiment: Wieweit reicht unsere Toleranz für den anderen und wo hört sie auf? Dabei spielt auch eine Rolle, welchen Platz jeder in der Gesellschaft gesucht hat.
Philipp hat sich nach dem Zahnmedizinstudium für ein neues Land entschieden, dort lockte eine Stelle in der Dentalindustrie. Liechtenstein ist ein winziges Land, das von einem Fürsten regiert wird, in dem wenig Steuern gezahlt werden und wo jeder jeden grüßt.
Anfangs wollte Philipp immer wieder zurückkehren, hatte Heimweh nach Leipzig, fuhr jedes Jahr mit seinen Kindern an die Ostsee, obwohl er von seinem Balkon auf die schönsten Berge schaute. Mittlerweile ist er angekommen. Aber seine Verbundenheit zu Leipzig, Ostdeutschland und zum Freundeskreis macht nach wie vor auch seine Identität aus:
"Wir haben uns manchmal wirklich bis aufs Messer gestritten. Wir hatten auch sehr konträre Lebensansichten oder Auffassungen, wie es jetzt weitergehen soll. Aber das war für uns kein Grund, dass wir nicht hinterher miteinander wieder reden können. Wir haben uns immer wieder zusammengerauft und auch unsere Gemeinsamkeiten wiedergefunden. Das schweißt uns auch zusammen."
Umsatteln mit einem Reisebüro für Ostdeutschland
Verena möchte noch einmal umsatteln. Während ich mir nach dem Jahr der Anarchie ein weiteres für die Suche nach einem passenden Lebensentwurf genommen habe, rutschte meine Freundin bereits 1989 ins Studium.
Mit ihrem DDR-Studiengang als Dolmetscherin konnte sie nach der Wiedervereinigung nur noch wenig anfangen. So studierte sie dazu BWL und bewarb sich in Essen, denn eine Stelle in der Wirtschaft zu bekommen, war in Leipzig damals aussichtslos.
Nach einer Scheidung, mit neuem Lebenspartner und drei Kindern sucht sie jetzt nach mehr beruflicher Sinnerfüllung. Als Quereinsteigerin würde sie gern in den Lehrerberuf wechseln oder in Essen ein Reisebüro für Ostdeutschland aufmachen:
"Ich würde auf jeden Fall anpreisen, wie viel die Menschen über die Geschichte von Deutschland erfahren würden, weil ja in Mitteldeutschland so viel passiert ist, dass man vielleicht viele Zusammenhänge erst mal besser verstehen würde. Denn das ist auch immer wieder interessant. Wenn die Menschen dann mal im Osten waren, sind sie eigentlich ganz erstaunt, was sie hier vorfinden", sagt sie.
Und ich selbst? Ich schaue auf meine große Tochter, die heute so alt ist wie ich damals. Die mit 19 kein Jahr des Aufbruchs erlebt hat, sondern ein Corona-Jahr in engen vier Wänden. Der ich aber wünsche, dass sie sich die Freiheit nimmt, ihren eigenen Weg zu finden. Dass sie sich an unserer Gesellschaft reibt, um sie zu einer besseren zu machen.
Für mich war die Zeit damals ein Geschenk. Eines, das genau an der Schwelle zum Erwachsensein für uns nach dem Abitur bereitstand. Oder mehr noch, wie haben es selbst mit angestupst.
Verschiedene Lebenswege, Geschichten die bleiben
Doch verbindet uns dadurch bis heute so viel, dass wir noch einmal unter einem Dach wohnen könnten?
"Ja selbstverständlich, mehr denn je. Was soll uns daran hindern. Man kann sich eigentlich nur noch in bester Vertrautheit zusammenfinden", sagt Peter.
Michael meint: "Nein, aber ich muss sagen, es gibt natürlich einen kleineren Kreis von Leuten, mit denen ich mir das sehr gut vorstellen könnte."
"Ich glaube, das ist eine Illusion. Dafür sind wir am Ende doch zu verschieden. Was sich damals eben nicht so gezeigt hat: Die Wege, die jemand geht: Das und die Prägung, die jeder hat, die werden, je älter wir werden, natürlich umso deutlicher", findet Jan.
Auf jeden Fall bleiben uns die jährlichen Pfingsttreffen. Neben den recht lauten Diskussionen über Weltpolitik werden dort zu später Stunde jedes Jahr die alten Geschichten herausgeholt. Die, die man sich wohl nur in kleiner Runde erzählen kann.
Regie: Beatrix Ackers
Technik: Ralph Perz
Sprecherin: Julika Jenkins
Redaktion: Carsten Burtke








