Sergej Lebedew: Stimmen gegen den Krieg
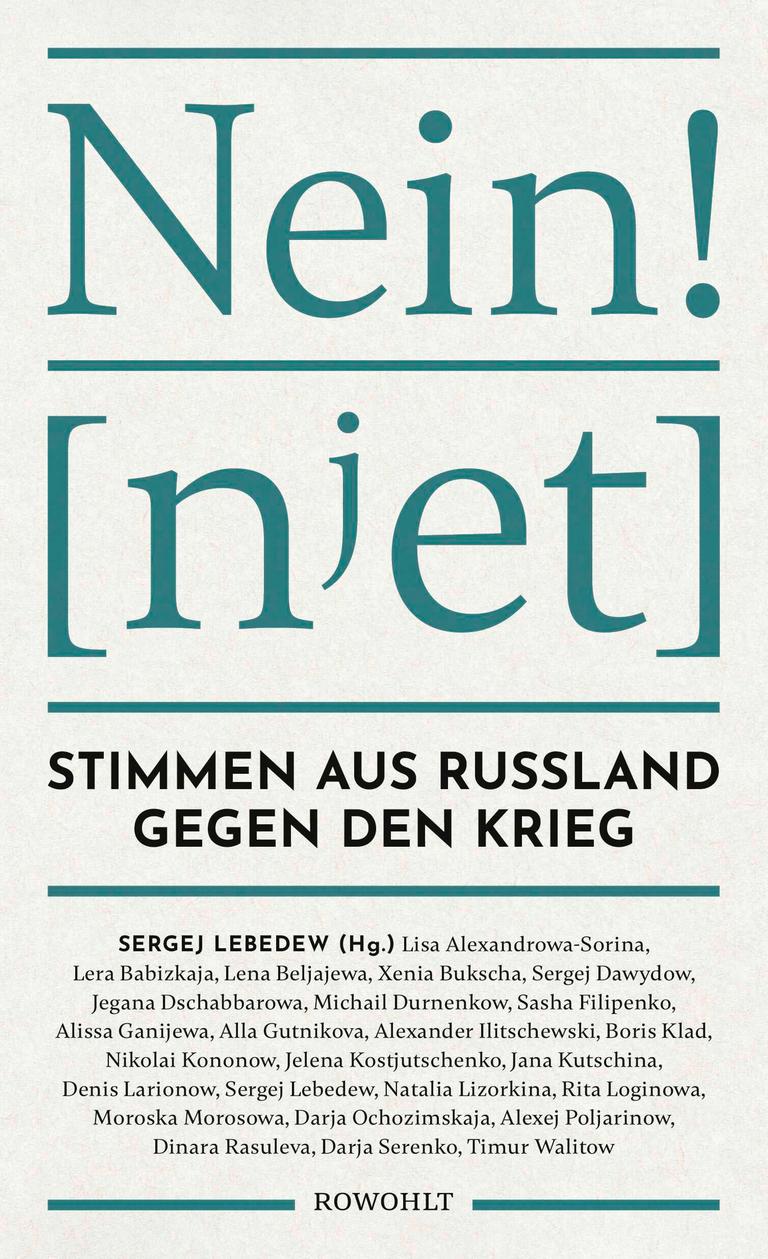
© Rowohlt Verlag Nein! Stimmen aus Russland gegen den KriegRowohlt Verlag, Hamburg 2025
Baba Jaga produziert Fake News
07:08 Minuten
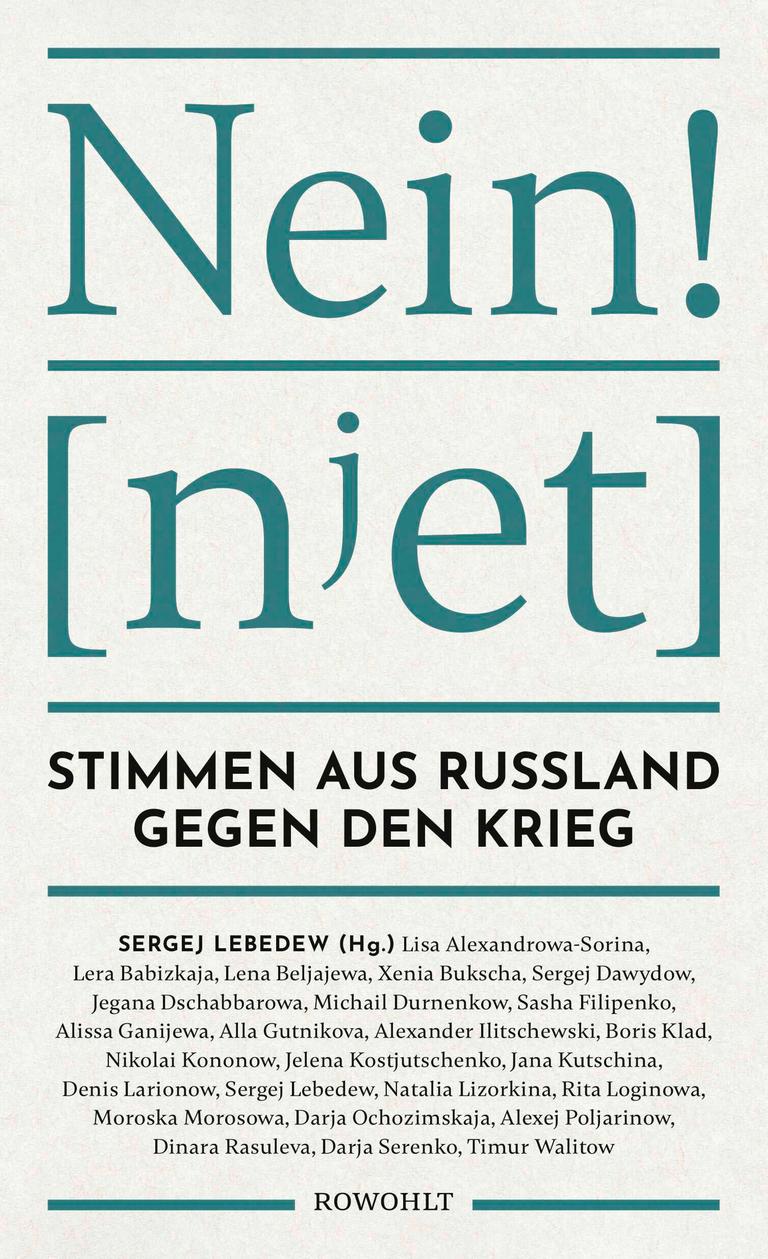
384 Seiten
28,80 Euro
Blumen an Gräbern von Ukrainern niederzulegen, wird in Russland mit jahrelanger Lagerhaft geahndet. Jede Opposition gegen den Ukrainekrieg wird gewaltsam unterdrückt. Aber es gibt Russen, die weiterhin protestieren.
Ein Njet ist in der Anthologie “Nein! Stimmen aus Russland gegen den Krieg“ durchaus zu vernehmen, aber nicht als flammender Appell. Das Nein grundiert vielmehr die Haltung der 25 mutigen Autorinnen und Autoren, die größtenteils im Exil leben oder sich in “Nein!“ mit Pseudonymen schützen. Sie ringen um Standpunkte, von denen aus der Propaganda, dem Nationalismus, den Repressionen und der virulenten Gewalt zu entkommen ist.
Schon die politische Opposition, klagt der “Nein!“-Herausgeber Sergej Lebedew im Vorwort, habe keine entschiedene Antikriegsposition eingenommen. Dabei hätte niemand überrascht sein dürfen: Die nach dem 24. Februar 2022 an ukrainischen Zivilisten verübten Grausamkeiten seien durchweg bekannt aus zwei langen Tschetschenienkriegen.
Noch immer überrascht?
Auch die von Lebedew versammelte, mehrheitlich zwischen 1980 und 2000 geborene literarische Opposition wirkt überrascht. Deutschsprachigen Lesern dürften neben Lebedew nur Alissa Ganijewa, Alexandar Ilitschewski sowie Darja Serenko bekannt sein, von ihnen sind Bücher übersetzt. Nicht vertreten in “Nein!“ sind die etwas älteren Schriftsteller Maria Stepanova und Michail Schischkin. Auch sie leben im Exil und haben sich so entschieden wie klug über das Imperium und seine Führung, über Identität und Mitverantwortung geäußert.
Die Autorinnen und Autoren der Anthologie schreiben weniger essayistisch, weniger unmittelbar politisch über viele andere Themen: Sie beklagen, dass sie aus dem Exil nicht zum ehemaligen, nun sterbenden Kindermädchen reisen können. Dass die Familie auseinandergerissen wird, Kinder wie Erwachsene gedankenlos krankenhausreif geschlagen werden oder eine Behinderung Hass hervorruft. Subjektive Blicke auf die russische Wirklichkeit herrschen vor.
Erst als eine Feministin die Hetze eines Söldners der Gruppe Wagner in den sozialen Medien gegen sie schildert, wird der Ukrainekrieg benannt. Das mag in einer Anthologie mit “Stimmen aus Russland gegen den Krieg“ irritieren. Vorwerfen kann man es Menschen, deren Leben eben dieser Krieg aus der Bahn geworfen hat, nicht.
Der Aufstand der Statuen
Viele Autorinnen und Autoren sind verstört. Ihre Texte sind fragmentiert, sie montieren Kleinanzeigen für Uniformen mit kurzen Geschichten, Lyrik mit Prosa, Fiktionales mit Autobiografischem. Auch über historische Traumata und Leiden wird nachgedacht – gern lyrisch und gleich so betroffen, dass der aktuelle Anlass dieser Reflexionen bestenfalls erwähnt wird.
Das ändert sich in der zweiten Hälfte der Anthologie. Groteske, absurde Töne nehmen zu: Ein Soldat ist tot, und niemand bemerkt es. Die mythologische Figur Baba Jaga wird angeklagt, viel höhere Zahlen für die von ihr ins Jenseits geleiteten Toten zu nennen als das zuständige Ministerium. Statuen sowjetischer Politiker steigen von den Sockeln und zetteln einen Aufstand an.
Rassismus des Imperiums
Außerdem wird geklagt, die Sprache nehme Schaden im Krieg. Das Thema ist bei Schreibenden weltweit beliebt, gewinnt aber in drei Texten an Schärfe. Sie beschreiben, wie die Russifizierung die Sprachen der Minderheiten in der Russländischen Föderation, ihr historisches Gedächtnis und ihre Traditionen beschädigt. Diese postkoloniale Kritik thematisiert den Rassismus des auf Russen zugeschnittenen Imperiums, das vermehrt Rekruten aus asiatischen Republiken in den Krieg schickt, allerdings nur am Rande. Auch hier scheint die literarische Opposition noch einen langen Weg vor sich zu haben.






