Lesart Spezial: Afrika
Afrika zwischen Aufbruchstimmung und Ausverkauf: Darüber und über sein Buch "Afrika vor dem großen Sprung" spricht Dominic Johnson. Der Historiker Andreas Eckert hat "Afrika - Der geplünderte Kontinent" von Helmut L. Müller kritisch gelesen.
Claus Leggewie: "Afrika vor dem großen Sprung" - einen schönen Sonntagmorgen zu einer neuen Ausgabe von Lesart Spezial in Deutschlandradio Kultur aus dem Grillo-Theater in Essen. Mein Name ist Claus Leggewie. Ich leite das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen und wir produzieren diese Sendung im Café Central des Essener Schauspiels, gemeinsam mit der Buchhandlung "Proust" und unserem Medienpartner, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.
Unser Thema ist heute "Afrika zwischen Aufbruchstimmung und Ausverkauf". Und diese Alternative bezieht sich auf die beiden Afrikabücher, die wir uns heute vornehmen wollen.
Dominic Johnson hat den Essay "Afrika vor dem großen Sprung" im Wagenbach Verlag veröffentlicht. Er war lange Afrika-Redakteur der "taz", der Tageszeitung, und hat den Kontinent vor allem in den Krisengebieten Zentralafrikas intensiv bereist. Heute ist er der Auslandschef der Tageszeitung. Herr Johnson ist hier. Herzlich willkommen zu unserer Sendung.
Wir haben neben einem Autor ja auch immer einen zweiten Gast, einen Kritiker. Das ist heute Andreas Eckert. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität Berlin. Und auch er ist ein jahrelanger intimer Kenner des Kontinents, Autor mehrer Bücher über die Geschichte einzelner afrikanischer Länder - zum Kolonialismus, zur Globalgeschichte und zuletzt von Überblicken über die afrikanische Geschichte zwischen 1500 und 1900. Und "Afrika seit 1850" wird demnächst im Fischer Taschenbuchverlag erscheinen.
Sie kennen ihn vielleicht auch als intensiven Rezensenten von Büchern, die meistens mit Afrika und dem Kolonialismus zu tun haben, aus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Und so sind wir sehr froh, dass wir heute einen Rezensenten da haben, der über ein Buch sprechen wird, das sozusagen das andere Extrem in unserer Wahrnehmung Afrikas spiegelt. Der Titel ist: "Afrika, der geplünderte Kontinent" von Helmut L. Müller. Das ist erschienen im Verlag Kremayr & Scheriau in Wien.
Aufbruchstimmung, Ausverkauf, das sind ja sehr konträre und plakative Ortsbestimmungen, Herr Johnson. Ich frage Sie aber zuerst mal: Afrika, gibt es das überhaupt jenseits unserer Projektionen vom Schwarzen Kontinent, vom Herz der Finsternis?
Dominic Johnson: Ja, natürlich gibt’s Afrika. Jeder Afrikaner fühlt sich zugehörig zu diesem Kontinent, vor allem gegenüber dem Rest der Welt. Und mir fällt auf gerade in den letzten Jahren, dass es eine sehr starke Hinwendung darauf gibt, dass es eine gemeinsame afrikanische Identität gibt, eine gemeinsame afrikanische Positionierung in der Globalisierung, die man versucht aufzubauen, die man versucht auch zu verteidigen und die man versucht zu gestalten. Von daher ist der Gegensatz, den Sie hier jetzt ein bisschen aufbauen – Ausplünderung und Aufbruch –, kein Gegensatz. Das ist Teil derselben Entwicklung. Dinge verändern sich.
Die Stellung Afrikas verändert sich. Der Umfang der Welt mit Afrika und der Umgang Afrikas mit der Welt, das ist alles in ganz tiefgreifendem Umbruch begriffen. Und das hat natürlich positive und negative Seiten. Die muss man beide sehen. Aber man muss erst mal sehen, dass das Afrika, das wir heute erleben und das sich in den nächsten Jahren herausbilden wird, sehr wenig damit zu tun hat mit dem, was wir gemeinhin kennen, dieses alte Afrikabild – der Elendskontinent, der Opferkontinent, das Opfer der Verhältnisse, der immer nur Böses erleidet und nichts selber hinkriegt.
Das ist nicht mehr, wenn es überhaupt je real war. Jetzt ist es noch weniger, als es je war, die Realität.
Claus Leggewie: Ich lese mal ein paar Überschriften aus Ihrem Buch vor, die natürlich sozusagen dem Stereotyp schon in den Überschriften widersprechen. Wir denken bei Afrika an Kolonialismus, Rassismus, Völkermord – Sie haben ein paar Stichworte gerade schon genannt –, an Aids, an Gewalt, an Bürgerkrieg.
Sie schreiben "asiatische Tiger, afrikanische Löwen, über die Ambitionen Afrikas". Sie schreiben über "Afrikas zweite Befreiung", da können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen, über die "neue afrikanische Ideologie und das Selbstbewusstsein" und über den "Aufbruch der Kinder der Moderne" in Afrika.
Hat Sie das Bild, was wir normalerweise über Afrika vielleicht in unseren Köpfen haben, hat Sie das geärgert?
Dominic Johnson: Ja, es hat mich geärgert. Es ist ja so: Ich hab jetzt 20 Jahre lang in der taz die Afrikaberichterstattung verantwortet. Ich habe sie nicht selber gemacht. Ich bin Redakteur, nicht Korrespondent, aber das macht es umso problematischer. Ich muss dann auswählen, was ist wichtig und was nicht? Wohin schicke ich Korrespondenten, wohin nicht? Welche Themen werden in welcher Weise aufbereitet? Und das ist ja so eine zweischneidige Sache.
Einerseits gibt’s ja den berechtigten Vorwurf, der ja gerade auch aus Afrika kommt, afrikanische Katastrophen und Kriege werden weniger wahrgenommen als die von woanders. Die Todeszahlen müssen schon dreistellig sein, bevor man drüber berichtet. Und das muss man ja ins Gleichgewicht bringen und die Probleme, die es in Afrika gibt, genauso ernst nehmen wie die Probleme anderswo.
Andererseits kann man dann auch nicht einfach nur, immer nur auf diese Entwicklungen gucken und immer nur die Leichen zählen und immer nur den Staatsverfall und die Bürgerkriege und eine Krise nach der anderen und den Scheinwerfer immer auf das Land, wo es gerade kracht, weil irgendwann – und das ist mir dann schon nach einiger Zeit auch selbstkritisch aufgefallen – stellt man sich dann die Frage: Ja, wieso gibt’s denn die Leute eigentlich noch? Die müssten doch eigentlich schon längst alle tot sein und der Kontinent müsste schon längst untergegangen sein.
Und wenn man hinfährt, merkt man ja, es ist nicht so. Selbst in Ländern, die ganz schlimme Dinge hinter sich haben, wenn man die heute besucht, es geht den Leuten besser als vor 20 Jahren. Es sind neue Generationen aufgewachsen, die neue Horizonte haben. Und Afrika ist ein Kontinent, der sich wahnsinnig schnell verändert, der sich wahnsinnig schnell auch selbst regeneriert und neue Wege findet. Und dem muss man auch irgendwie gerecht werden. Und das ist sehr viel schwieriger, als über Katastrophen zu berichten.
Wenn man nur das als Herausforderung nimmt, dann verlernt man irgendwann die eigentliche Herausforderung von journalistischer Berichterstattung – ob über Afrika oder einen anderen Teil der Welt –, deutlich zu machen, wie tickt ein Land, wie tickt eine Weltregion? Und die tickt eben nicht nur über ihre Probleme, sondern auch über ihre anderen Seiten.
Claus Leggewie: Herr Eckert, vor einigen Jahren gab es in der Afrika-Wissenschaft so eine Auseinandersetzung zwischen Pessimisten und Optimisten. An die kann ich mich noch erinnern. Hatten Sie damals Position bezogen in diesem Streit?
Andreas Eckert: Wir waren natürlich vermittelnd. Ich glaube aber, und das finde ich auch gut, dass Dominic Johnson dieses sehr schnittige Buch geschrieben hat, was doch zumindest am Anfang sehr positiv daherkommt. Am Ende wird es ja doch noch etwas unentschiedener.
Ich finde es eben wichtig, wie er sagt, die Krisen nicht zu verschweigen, aber zugleich, und das ist ja in Afrika gerade in diesen Jahren besonders sichtbar, auch die rasanten Veränderungen aufzunehmen und zu analysieren.
Natürlich könnte man jetzt anfangen, das machen wir ja gerne, mit der Detailkritik. Ich möchte allerdings vielleicht zwei Punkte doch noch mal ansprechen bzw. einfach noch mal genauer nachfragen.
Das Erste, was Dominic Johnson ja auch beschreibt, ist, dass gerade die Länder, die vielleicht ein besonders dynamisches ökonomisches Programm daher zaubern, und er nennt da Ruanda als Beispiel, auch eine Gegenseite haben, nämlich die Gefahr, dass gerade in diesen Ländern auch die politische Autorität oder – anders herum – ein autoritärer Politikstil greift und Oppositionen ja eigentlich nur stören bei diesem wirtschaftlichen Aufbruch, das heißt, Gegenstimmen, Dissidenten eher wieder weggedrängt werden. Das halte ich schon für ein relativ gewichtiges Problem. Und manchmal in der Feierlaune darüber, dass es jetzt auch wunderbare afrikanische Kapitalisten gibt, fällt das ein wenig vielleicht ab.
Und der zweite Punkt, auch der taucht in diesem Buch sporadisch auf, ist das Thema Staat. Es gibt weniger Staat, das finden offenbar die meisten auch ganz gut. Die Frage ist natürlich nur, wer – und da bleibt dieses Buch recht nebulös – übernimmt eigentlich die Aufgaben, die ein Staat normalerweise übernimmt und die mit dem Staat assoziiert werden? – Nämlich die Frage von sozialer Sicherung, von Wohlfahrt, von Infrastruktur. Es ist zwar von irgendwelchen tollen Straßen jetzt die Rede, die Afrika durchschneiden, aber wer die genau gebaut hat und – vor allen Dingen – wer die dann unterhält, das taucht nicht so genau auf.
Das heißt, ich würde schon noch mal fragen, was jetzt eigentlich – da ist ja in der Afrika-Forschung viel gemacht worden – die schwachen Staaten, die verschwindenden Staaten, wie es eigentlich sozusagen nach Ihrer Meinung dann mit dem Staat in Zukunft in Afrika aussieht, welche Rolle der eigentlich im neuen Afrika überhaupt noch spielen sollte und könnte.
Und vielleicht ein dritter Punkt, wenn ich noch darf – das ist ja auch Ihr Lieblingsthema –, ist die Umwelt. Gerade, weil die großen Städte hier auch als ganz dynamische Horte der Entwicklung zelebriert werden, sind es natürlich gleichsam auch die Orte, an denen sozusagen jeder Umweltfreund doch relativ hektische Flecken im Gesicht bekommt – wenn nicht von der Luft, dann von den Zuständen. Und da wäre doch auch die Frage, wie dieses Problem und die von vielen jedenfalls so bezeichnete "Verwundbarkeit" Afrikas in ökologischen Fragen eigentlich auch im Zukunftsoptimismus mitspielt.
Claus Leggewie: Ja, Herr Johnson, eine autoritäre Modernisierung auf Kosten der Umwelt und der unteren Schichten, die nicht mitgenommen werden – ich fasse es mal ziemlich plakativ zusammen. Was sagen Sie?
Dominic Johnson: Ja, das ist ja überhaupt nix Neues. Das ist ja seit 100 Jahren so. Das ist eben, wo die Terminologie auch ein bisschen verrutscht. Wenn Sie sagen, das, was ein Staat "normalerweise" macht, dann ist es das, was ein Staat hier normalerweise macht. Ein afrikanischer Staat macht das normalerweise sowieso überhaupt nicht – soziale Sicherung usw. Welcher afrikanische Staat hat das je getan? Kein einziger. Der Staat ist ein Autoritäts- und Erzwingungsinstrument. Das ist das Staatsverständnis aus der Kolonialzeit, was es bis heute gibt. Leute, die regieren, die sagen, so habt ihr zu leben. Wir organisieren das jetzt so. Daran habt ihr euch zu halten. Und wenn ihr nicht wollt, dann zwingen wir euch.
Das Risiko, was ja dann immer besteht, ist, dass die Leute, die das sagen, das aus ihrem privaten Interesse machen und nicht aus dem Interesse des Gemeinwohls. Das ist ja die Krise der Staatlichkeit, die wir in Afrika haben.
Das heißt, das, was Sie als Normalzustand darstellen, den gibt’s in Afrika gar nicht. Der wäre erst mal herzustellen. Das wäre natürlich schön, aber so weit sind wir eigentlich nicht, sondern wir sind erstmal in der Zeit, wo man anfängt, jenseits des Staates zu denken. Und das ist sehr wichtig, dass auch mal was erlaubt ist, wo nicht die Regierung erst sagt, das darfst du tun. Das ist ein unheimlich wichtiger Gedanke für das Vorankommen von Menschen in einer Gesellschaft, wo das Überleben schon eine große Herausforderung ist.
Wenn sich das verankert in der Gesellschaft – ja, ich kann auch was machen, ohne dass es mir ein Staat erlaubt, ich kann auch was machen, selbst wenn der Staat sagt, es geht nicht, aber das ist dann egal, sondern wir machen das einfach -, das ist ein Stück Aneignung des eigenen Schicksals. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig dafür, das gesellschaftliche Potenzial freizusetzen von dieser Milliarde Menschen, die ja ihren Kontinent gerade aufbauen.
Das ist was, was gerade in Ländern, die das Schlimmste schon hinter sich haben – jedenfalls hoffen wir, sie haben es hinter sich...
Claus Leggewie: Zum Beispiel?
Dominic Johnson: Zum Beispiel Ruanda nach dem Völkermord, zum Beispiel Nigeria nach der Militärdiktatur, zum Beispiel auch Süd-Sudan jetzt nach den Jahrzehnten Krieg, vielleicht auch irgendwann mal der Kongo, falls es sich irgendwann stabilisiert. Alle diese Länder haben gemein, dass die Leute sagen: Wir haben das durchlebt. Wir lassen uns nicht mehr einfach nur sagen, wir müssen das so und so machen, sondern wir haben unsere Zukunft unter großen Opfern selber in die Hände nehmen müssen.
Also, ich erinnere mich an Diskussionen mit Nigerianern noch zur Zeit der Militärdiktatur, als es ganz schlimm war unter Sani Abacha und die nigerianische Demokratiebewegung hier in Europa viel Lobbyarbeit gemacht hat. Und dann sagten die immer zu fortgeschrittener Stunde am Abend: Ihr werdet euch noch wundern! Wir wissen das doch schon alles. Wenn wir das einmal schaffen, dann werden wir den anderen zeigen, wie es geht. Wir haben doch schon diesen ganzen Scheiß erlebt. Uns wird keiner mehr reinreden. – Und das Gleiche jetzt ein bisschen zu sehr als offizielle Ideologie macht ja die ruandische Regierung, die sagt: Mit welchem Recht kommt irgendjemand und sagt uns, was wir zu tun haben, nachdem die zugeguckt haben, wie eine Million Menschen abgeschlachtet wurden? – Und das wenden sie natürlich auch gegenüber der eigenen Bevölkerung an, die ja da mitgemacht hat.
Der Punkt aber ist, dass – wenn sich mal die politischen Verhältnisse komplett aufgelöst haben und dann erst wieder neu aufgebaut werden – dann gibt es viel mehr Möglichkeiten für die Menschen selber auch zu sagen, wir könnten das ja so machen oder wir könnten es so machen. Es ist nicht einfach von der Geschichte vorgegeben, sondern man hat Möglichkeiten zu entscheiden.
Claus Leggewie: Herr Eckert, ist das gelebte Demokratie nach einer Katharsis, durchs Feuer gegangen zu sein?
Andreas Eckert: So tönt es ein wenig. Und, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht, das wäre auch nicht meine Rolle, den Afro-Pessimisten geben, aber doch noch mal nachfragen. Also, der Punkt, dass Leute jenseits des Staates agieren mussten, der ist ja nun schon länger da, weil der Staat, wie Sie richtig sagen, zwar am Anfang dieses Programm hatte, aber ja nie eingelöst hat. Das ist ja erstmal nichts Neues, dass sich Menschen in anderer Form organisieren müssen.
Und – das schreiben Sie auch selber in Ihrem Buch – es ist eine offene Situation. Es kann auch schief gehen. Und es können sich natürlich auch Entwicklungen oder Modelle durchsetzen, die wir nicht so freundlich fänden und die vielleicht für den Großteil der Menschen dort auch nicht besonders positiv daherkämen.
Da wäre zum Beispiel die Frage: Wer sind denn eigentlich die Leute, die diesen Aufbruch machen? Wen nehmen sie mit? Wen sprechen sie an? Sie haben selbst in Ihrem Buch kurz davon geschrieben, dass es auch natürlich Leute gibt, die abgekoppelt sind und immer stärker abgekoppelt sind, je größer auch etwa die Bedeutungen des Zugangs zu Kommunikation, zu Medien etc. werden.
Und der zweite Punkt, auch den sprechen Sie kurz an. Ich meine, da müsste man eben auch noch mal nachfragen. Wer kommt vielleicht jetzt mittelfristig in das Privileg? Wer kann Zugang finden? Das ist die Frage von Bildung und Universitäten. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, auch wenn man das gern möchte, mit den asiatischen Tigern oder mit anderen Regionen sich vergleicht, die Frage des Know-hows, der Technologie, der Bildung. Und da sehe ich zum Beispiel noch nicht so richtig, wie auch gerade die – sagen wir mal – dynamischen Kräfte und Politiker und Ökonomen oder Unternehmer in Afrika gerade diesen Bereich fördern.
Es schießen zwar immer mehr Privatuniversitäten aus dem Boden, aber teilweise noch mit einem relativ dünnen Fundament. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo sich vieles in Zukunft in Afrika entscheidet. Und ich sehe noch nicht so richtig sozusagen, wer da eigentlich von profitieren will. Das klingt bei Ihnen so die Afrikaner und breite Massen und Aufbruch. Aber könnte es nicht sein, dass es am Ende dann doch wieder eine relativ kleine Gruppe sein wird, die sozusagen diese Privilegien und dieses neue Afrika dann gestaltet und viele doch wieder hinten über kippen? Das wäre zumindest etwas, was in dieser offenen Situation droht. Und man kann ja an Ruanda und anderen sehen, dass der – wer irgendwie einen bestimmten Weg nicht mitmacht – auch relativ schnell außen vor bleibt.
Dominic Johnson: Natürlich ist es eine Minderheit. Die Mehrheit ist ausgeschlossen, nach wie vor. Das ist klar. 80 Prozent der Afrikaner, die arbeiten könnten, haben keine bezahlte Arbeit. Daran hat sich nichts geändert. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Der Unterschied ist, ich will da auch gar nix schön reden, ich denke, es geht auch um unseren Fokus, es gibt Akteure. Und die sind vor Ort. Sie sind nicht hier. Es ist nicht so, als ob man sagen müsste, die Bösen sitzen in Washington und Paris und Moskau und sonst was und ziehen die Fäden. Sondern die, die was bestimmen und gestalten können, sitzen in den eigenen Ländern. Das ist ja auch schon mal was. Und das muss man, glaube ich, erst mal sehen. Dann kommt man weiter.
Das heißt ja auch, dass sich im Laufe der Zeit eine Diskussion in den Ländern selber ergeben wird. Wenn sich eine Elite herausbildet in den Ländern, in manchen, in Südafrika ist das sehr sichtbar, in Nigeria ist das sehr sichtbar, in allen Ländern, wo sich ein freies Unternehmertum rausbildet, ist das jetzt die große Frage. Natürlich gibt es eine Klassenfrage jetzt in Afrika von dieser neuen Unternehmerschicht, die ganz viel Geld hat, aber auch das ist ein Fortschritt. Früher gab's die nicht. Es gab dieses Geld in Afrika nicht. Jetzt ist es da. So. Was macht man damit?
Es sind erst mal Leute da, die verfügen darüber. Die können Dinge tun. Es gibt ganz viele Leute, die verfügen darüber nicht und können nichts tun. Aber der Rahmen der politischen Debatte, der wandert zurück in die Gesellschaften. Ich finde das eine ganz spannende Entwicklung. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, was ist daran positiv, was ist daran negativ, sondern ich stelle es einfach fest.
Claus Leggewie: Es ist zunächst mal sozusagen gegen die antikoloniale Phrase gerichtet, wenn Sie sagen, nicht in Washington, nicht in Paris, die Entscheidungen fallen in Afrika selbst – so oder so. Und Sie haben vielleicht ein Beispiel mal aus Ihrer Beobachtung von einem Land. Sie sagen ja selber, der Prozess ist offen und ambivalent, aber wo funktioniert es denn so, wie Sie es gerne hätten?
Dominic Johnson: Ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt ein Erfolgsmodell. Ich sehe Entwicklungen, wie sie sich verändern. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Südafrika, wo ja auch die Entwicklung völlig offen ist und wo es ja berechtigte Kritik daran gibt, was der ANC macht und ob Zuma nicht auch so eine Art populistische Politik führt, die eigentlich nur einer kleinen Elite dient. Aber es gibt eben das, was es vor 20 Jahren nicht gab. Eine sehr mächtige, sowohl politisch als auch finanziell mächtige schwarze Mittelschicht, die hat das Land in der Hand. Das ist eine Veränderung.
Ich nehme ein anderes Beispiel – Nigeria: Das ist das Land, wo wahrscheinlich am meisten Geld von außen reinkommt, weil es die meisten Ölexporte hat. Milliarden fließen da rein. Es ist das bevölkerungsreichste Land. Es ist ein Land mit wahnsinnig vielen Problemen. Dabei ist es auch das Land mit den reichsten Privatunternehmern Afrikas, die riesige Projekte zur Umgestaltung von Lagos haben zum Beispiel, das ja die größte Stadt des Kontinents ist, vielleicht auch demnächst die größte Stadt der Welt. Diese Stadt wird ja gerade völlig umgekrempelt. Alle möglichen Dinge sind da im Gespräch, was man mit diesem Land von 150 Millionen Leuten machen soll.
Wir erfahren darüber hier relativ wenig – aus gutem Grund. Es wird darüber nicht hier befunden. Die Leute kommen nicht hierher und sagen, könnt ihr uns helfen, Lagos vorm Untergang ins Meer zu retten? Die sagen nicht, könnt ihr uns mal helfen, unser Stromnetz aufzubauen – und so? Die überlegen sich das selber. Wir erfahren darüber relativ wenig, aber es sind Diskussionen, die stattfinden.
Das Gleiche mit dem ersten Beispiel, was ich nannte, Südafrika: Die schwarzen Unternehmer, die der ANC herangezüchtet hat, die jetzt Zumas Basis sind, diese Bling-Kultur durch das black economic empowerment das ist ja irgendwie auch was ein bisschen Obszönes, aber gleichzeitig auch eine Bestätigung. Wir sind jetzt wer. Wir können uns das leisten. Wir leisten uns das auch. Es sind nicht mehr nur die Weißen, die damit protzen dürfen, dass sie Geld haben, sondern wir machen das auch. Und das ist selbst für die Leute, die kein Geld haben, wichtig, dass es das gibt.
Claus Leggewie: Wir sollten uns mal dem zweiten Buch zuwenden von Helmut Müller, einem Journalisten der Salzburger Nachrichten. Er hat ein Buch geschrieben, "Afrika – Der geplünderte Kontinent". Hat's Ihnen gefallen, Herr Eckert?
Andreas Eckert: Jein. Also, der Titel suggeriert ja wieder eher das negative Bild, gegen das Dominic Johnson und andere anschreiben, nämlich Afrika wird ausgeblutet, ausgebeutet von außen, hat nichts zu sagen, hat keine eigene Meinung. – Das wird im Buch dann doch sehr stark revidiert. Und im Grunde ist es so eine Art Analogie, Zusammenfassung verschiedener Positionen, die es zu Afrika in Wissenschaft und Politik und Medien gibt.
Also, wie Dominic Johnson auch, sieht Helmut Müller Afrika am Wendepunkt und sieht auch eine wichtige Transformationsphase in Afrika im Gange mit offenem Ausgang. Er ist, glaube ich, noch etwas kritischer bzw. die Stimmen, denen er Gehör verschafft, sind doch noch sehr oft im Sinne: Afrika ist ein Sozialfall, Afrika leidet unter seinem Ressourcenfluch, Afrika ist immer noch der Spielball äußerer Interessen. Was er aber eben auch betont, ist Ihre Eingangsfrage: Afrika gibt es vielleicht, aber Afrika ist äußerst vielfältig. Und wenn etwas in Somalia passiert, ist das nicht unbedingt ein Indikator für Entwicklungen in ganz Afrika.
Er spricht eben eine Reihe auch von Punkten an, die – das Buch ist auch etwas umfangreicher als das von Dominic Johnson – da nicht vorkommen, ein Thema, was ja vielfach bis heute auch die Öffentlichkeit bewegt, die Frage der Entwicklungshilfe. Ist das Fluch? Ist das Segen? Muss man die jetzt radikal abschaffen? Natürlich auch die selbstbewussten afrikanischen Politiker, wie Kagame, basieren ja ihr Projekt zu einem Großteil auch immer noch auf Entwicklungshilfe, selbst wenn es mittelfristig dann weniger werden soll und auch so festgeschrieben ist. Aber natürlich hat dieser Bereich für Afrikas Ökonomien immer noch eine ganz enorme Bedeutung. Das wird debattiert. Die Rolle Chinas, ebenfalls etwas, was sehr stark ja in der Öffentlichkeit hier diskutiert worden ist, kommt rein. Und er endet immer so mit einem "ja, aber" oder "das oder das", es könnte sozusagen beides sein.
Ein anderer wichtiger Punkt, der scheint mir wirklich sehr relevant, ist das, was man das land grabbing oder das Land-Raffen nennt, dass natürlich internationale Konzerne – nicht nur aus China, aus Europa, aber auch aus dem Nahen Osten – größere Landregionen einfach erst mal aufkaufen, und die Frage sozusagen, wer profitiert davon, das ist eben eine Frage, glaube ich, die offen ist, aber die man sehr sorgfältig beobachten muss.
Selbst wenn Afrika jetzt von den ökonomischen Daten her besser dastehen wird, die Frage, wer profitiert am Ende davon und wie wird organisiert, dass diese – es gab ja diesen schönen Roman – "My Mercedes is bigger than yours"-Leute eben nicht die einzigen sind. Und am Ende freuen sich dann die Leute nicht nur, weil ein paar Leute mit ihrem Mercedes protzen, sondern sehen auch, dass sie selbst dann nichts zu essen haben.
Und auch die Enttäuschung in Südafrika, Mittelschicht hin oder her, ist natürlich sehr, sehr groß bei vielen Leuten, bei denen die Verheißungen, die am Ende der Apartheid formuliert worden sind, nicht angekommen sind. Und dieses große Potenzial an Leuten, was Sie in Ihrem Buch auch mal kurz ansprechen, was hier auch angesprochen wird, wird eben auch die Zukunft Afrikas entscheiden und nicht nur die kleine dynamische Elite, die sich jetzt vielleicht neu und mit einem größeren Selbstbewusstsein formuliert.
Und ein letzter Punkt noch: Er geht natürlich auch auf ein Lieblingsthema von Wissenschaftlern ein, nämlich die Afrikaberichterstattung. Wir schieben uns ja immer gegenseitig dann gerne die Bälle zu. Die Journalisten sagen, die Historiker oder die Wissenschaftler können nicht schreiben und keinen einzigen geraden Satz formulieren, während wir immer sagen: Also, diese Verkürzungen und diese Plattitüden. Ich glaube, er beschreibt relativ gut – und lässt auch da unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen –, wie eigentlich auch Berichterstattung über Afrika entsteht. Sie haben das ja auch selber beschrieben, die Entscheidung, was kommt rein und was kommt nicht rein, wer ist überhaupt vor Ort und kann kompetent darüber berichten. Das finde ich eigentlich ein relativ gutes Kapitel.
Und er spricht auch noch mal kurz die Frage des Klimawandels an und dass das ein ganz entscheidender Punkt sein wird, der eben auch die Zukunft Afrikas mit entscheiden wird, auch der Umgang mit Ressourcen und was die radikale Ressourcenausbeutung, die vielen schönen Bodenschätze, für die sich alle interessieren, natürlich dann auch für die Umwelt bedeuten. Das wird alles relativ kurz angesprochen, aber ich glaube, es ist für jeden eine ganz gute Einführung in die verschiedenen Perspektiven, die man auf den Kontinent haben kann.
Der Autor selbst hält sich mit seiner Meinung sehr zurück. Und das ist dann auch der Vorteil. Dann können die Leserinnen und Leser sich ihr eigenes Urteil bilden.
Claus Leggewie: Stimmen Sie zu, Herr Johnson, in dem Urteil über das Buch Ihres Kollegen, so eine Art Afrika für Anfänger?
Dominic Johnson: Das ist es sicher. Es ist ein Überblick über die verschiedenen Probleme und die Meinungen dazu, die es hier so gibt.
Ich glaube, der Unterschied ist, was ich versucht habe stärker rauszuarbeiten, ist, wie die Sichtweise aus dem Kontinent sich auch verändert hat und nicht nur die Sichtweise von hier aus. Ich denke, das ist was, das muss hier vielleicht auch noch mehr rezipiert werden, dass es ja auch eine veränderte Sichtweise in vielen afrikanischen Ländern auf sich selbst gibt und auf die Art, wie über einen gesprochen wird, und dass man das weniger als früher einfach übernimmt, was von außen an Diskurs kommt, an Analyse, Mustern, an Ideologien usw. Die Zeit ist in Afrika eigentlich vorbei, dass man sich von außen sagen lässt, wie Afrika ist.
Und das, denke ich, wird einen Unterschied machen in den politischen Beziehungen. Dann wird man auch so nicht mehr reden können. Viele der Diskussionen, die wir jetzt führen, ob das Klimawandel oder land grabbing oder so sind, die sind ja immer noch sehr geprägt davon, wie sehen wir was. Und dann gucken wir mal, ist es in Afrika so. Und dann übertragen wir unsere Analyse dorthin. Ohne dass daran irgendwas im Detail falsch sein muss, wird es irgendwann nicht mehr sehr weit führen, weil die Voraussetzungen nicht akzeptiert werden vom Gesprächspartner. Und das wird ein Problem darstellen. Und dem muss man sich stellen.
Ich nehme einfach mal das Beispiel land grabbing. Da wird ja jetzt sehr viel drüber geredet. Ich hab damit zwei Probleme: Das eine ist, dass in der Realität sehr viel weniger passiert, als immer wieder geschrieben wird. Die meisten Projekte werden zwar verkündet, aber nicht umgesetzt. Mindestens drei Viertel von den Sachen, die die Regierungen sagen, die sie machen werden, tun sie dann nicht. Die Projekte kommen nicht zustande. Da guckt man also auch viel zu wenig genau hin, was eigentlich tatsächlich passiert, wenn was angekündigt wird, was ist der Unterschied.
Und das Zweite ist, dass natürlich dann immer wieder auch von afrikanischer Seite – ob zurecht oder nicht sei jetzt erstmal dahingestellt – der etwas verwunderte Vorwurf kommt: Naja, land grabbing, das kennen wir. Vor 100 Jahren gab's 100 Prozent land grabbing von Europa aus und ohne jede Gegenleistung. Es wurde einfach genommen. – Und jetzt verkaufen wir oder machen Investitionen in Partnerschaften mit asiatischen Ländern. Und jetzt kommen die Europäer und sagen, das ist aber ein Problem für die Entwicklung. – Wieso müssen wir uns diese Kritik reinziehen?
Das ist was, was dann von hier wiederum nicht gesehen wird, sondern dann wird auch nur wieder gesagt, na ja, das beweist ja die Abhängigkeit von den Chinesen usw. Das heißt, das Potenzial für Missverständnisse ist sehr groß geworden. Dem muss man sich stellen in der Diskussion.
Claus Leggewie: Der Kolonialismusexperte Eckert noch mal: Ist das denn jetzt eine Form von Neokolonialismus? Oder muss man da modifizieren, differenzieren?
Andreas Eckert: Da muss man sicher modifizieren. Ich wollte nur sagen, das ist alles ganz richtig, nur für den Bauern, der dann keinen Zugang zu Land hat – und die gibt’s natürlich dann auch –, macht das jetzt keinen Unterschied, wer wie darüber redet. Ich gebe ja völlig zu, dass diese ganze Debatte neu vermessen werden muss, dass sich auch afrikanische Intellektuelle und Politiker vielleicht eher Richtung Asien orientieren und dass Europäer ganz enttäuscht dastehen, weil eigentlich mit ihnen niemand mehr sprechen will. Trotzdem ist es ja so auch nicht.
Und natürlich geht immer noch vieles, gerade wenn wir etwa im Bereich Bildung und Ausbildung schauen, immer noch nach Amerika oder nach Europa – vielleicht jetzt verstärkt in einige asiatische Universitäten, aber ich glaube, ganz so außen vor ist selbst für diese Eliten Europa auch nicht.
Natürlich hat es auch schon früher sehr selbstbewusste Reden afrikanischer Politiker gegeben, dass sie Europa nicht brauchen und ihr Eigenes haben und so, aber dann doch sehr viel enger – wie Julius Nyerere, der zwar einen afrikanischen Sozialismus erfunden hat, der doch verdammt nach den Fabiern ausschaute und dem Fabier-Sozialismus. Ich glaube, das muss man alles dann auch sehr viel komplexer sehen.
Ich glaube, Neokolonialismus ist vielleicht dann der falsche Begriff, weil er sozusagen dann so tut, als sei es im Grunde eine gradlinige Fortsetzung des Kolonialismus vor 1960. Aber es gibt weiterhin Abhängigkeiten. Es gibt weiterhin Interessen. Und es gibt, wie damals auch, bestimmte Gruppen in Afrika, die davon profitieren, und eine große Menge, die davon nicht profitieren. Und ich glaube, daran entscheidet sich für mich der große Sprung.
Claus Leggewie: Wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Wir haben zwei Bücher besprochen: Helmut Müller, "Afrika – Der geplünderte Kontinent", und Dominic Johnson, "Afrika vor dem großen Sprung". Und in Lesart machen wir es immer so, dass die beiden Gäste immer noch Bücher vorschlagen, die sie gerade gelesen haben und empfehlen möchten. Herr Eckert, welches Buch möchten Sie gern empfehlen?
Andreas Eckert: Ich möchte ein Buch empfehlen von einem Journalisten wiederum, Heinrich Bergstresser. Das Buch heißt "Nigeria – Macht und Ohnmacht am Golf von Guinea". Für einen Journalisten, sage ich mal ganz keck, ist das Buch jetzt nicht besonders elegant geschrieben, aber es ist sehr informativ und bietet eine sehr, sehr gute Einführung in ganz verschiedene Aspekte der jüngeren Geschichte und Gegenwart Nigerias. Das heißt, dieses doch sehr unübersichtliche Geflecht zwischen Politik und Religion wird da eigentlich sehr gut aufgedröselt. Also, ich denke, für dieses Land, was so wichtig und hier doch sehr unbekannt ist, ist es eine exzellente Einführung.
Claus Leggewie: Herr Johnson, Sie haben auch einen Tipp.
Dominic Johnson: Ja, ich wollte Ihnen ans Herz legen die deutsche Übersetzung des Buchs von Michela Wrong über Kenia und den Kampf gegen Korruption dort, auf Deutsch herausgekommen unter dem Titel: "Jetzt sind wir dran. Korruption in Kenia – Die Geschichte des John Githongo". Das ist ein Buch, das handelt von dem letztendlich erfolglosen Kampf eines sehr mutigen Kenianers, die korrupte kenianische Politik aufzudröseln und daran etwas zu ändern.
Claus Leggewie: Und das Buch ist erschienen im Verlag Klaus Bittermann, das Buch von Herrn Bergstresser im Verlag Brandes & Apsel.
Das war eine Sendung über Afrika zwischen Aufbruchstimmung und Ausverkauf. Wir haben, glaube ich, es geschafft, das Afrikabild ein bisschen differenzierter darzustellen.
Das war eine neue Ausgabe von Lesart Spezial, eine gemeinsame Veranstaltung vom Deutschlandradio Kultur, dem Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, der Buchhandlung "Proust", dem Schauspiel Essen und unserem Medienpartner, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, Herrn Johnson, Herrn Eckert, bei Ihnen hier im Café Central und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
Dominic Johnson: Afrika vor dem großen Sprung
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2011
Helmut L. Müller: Afrika - Der geplünderte Kontinent
Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 2011
Unser Thema ist heute "Afrika zwischen Aufbruchstimmung und Ausverkauf". Und diese Alternative bezieht sich auf die beiden Afrikabücher, die wir uns heute vornehmen wollen.
Dominic Johnson hat den Essay "Afrika vor dem großen Sprung" im Wagenbach Verlag veröffentlicht. Er war lange Afrika-Redakteur der "taz", der Tageszeitung, und hat den Kontinent vor allem in den Krisengebieten Zentralafrikas intensiv bereist. Heute ist er der Auslandschef der Tageszeitung. Herr Johnson ist hier. Herzlich willkommen zu unserer Sendung.
Wir haben neben einem Autor ja auch immer einen zweiten Gast, einen Kritiker. Das ist heute Andreas Eckert. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität Berlin. Und auch er ist ein jahrelanger intimer Kenner des Kontinents, Autor mehrer Bücher über die Geschichte einzelner afrikanischer Länder - zum Kolonialismus, zur Globalgeschichte und zuletzt von Überblicken über die afrikanische Geschichte zwischen 1500 und 1900. Und "Afrika seit 1850" wird demnächst im Fischer Taschenbuchverlag erscheinen.
Sie kennen ihn vielleicht auch als intensiven Rezensenten von Büchern, die meistens mit Afrika und dem Kolonialismus zu tun haben, aus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Und so sind wir sehr froh, dass wir heute einen Rezensenten da haben, der über ein Buch sprechen wird, das sozusagen das andere Extrem in unserer Wahrnehmung Afrikas spiegelt. Der Titel ist: "Afrika, der geplünderte Kontinent" von Helmut L. Müller. Das ist erschienen im Verlag Kremayr & Scheriau in Wien.
Aufbruchstimmung, Ausverkauf, das sind ja sehr konträre und plakative Ortsbestimmungen, Herr Johnson. Ich frage Sie aber zuerst mal: Afrika, gibt es das überhaupt jenseits unserer Projektionen vom Schwarzen Kontinent, vom Herz der Finsternis?
Dominic Johnson: Ja, natürlich gibt’s Afrika. Jeder Afrikaner fühlt sich zugehörig zu diesem Kontinent, vor allem gegenüber dem Rest der Welt. Und mir fällt auf gerade in den letzten Jahren, dass es eine sehr starke Hinwendung darauf gibt, dass es eine gemeinsame afrikanische Identität gibt, eine gemeinsame afrikanische Positionierung in der Globalisierung, die man versucht aufzubauen, die man versucht auch zu verteidigen und die man versucht zu gestalten. Von daher ist der Gegensatz, den Sie hier jetzt ein bisschen aufbauen – Ausplünderung und Aufbruch –, kein Gegensatz. Das ist Teil derselben Entwicklung. Dinge verändern sich.
Die Stellung Afrikas verändert sich. Der Umfang der Welt mit Afrika und der Umgang Afrikas mit der Welt, das ist alles in ganz tiefgreifendem Umbruch begriffen. Und das hat natürlich positive und negative Seiten. Die muss man beide sehen. Aber man muss erst mal sehen, dass das Afrika, das wir heute erleben und das sich in den nächsten Jahren herausbilden wird, sehr wenig damit zu tun hat mit dem, was wir gemeinhin kennen, dieses alte Afrikabild – der Elendskontinent, der Opferkontinent, das Opfer der Verhältnisse, der immer nur Böses erleidet und nichts selber hinkriegt.
Das ist nicht mehr, wenn es überhaupt je real war. Jetzt ist es noch weniger, als es je war, die Realität.
Claus Leggewie: Ich lese mal ein paar Überschriften aus Ihrem Buch vor, die natürlich sozusagen dem Stereotyp schon in den Überschriften widersprechen. Wir denken bei Afrika an Kolonialismus, Rassismus, Völkermord – Sie haben ein paar Stichworte gerade schon genannt –, an Aids, an Gewalt, an Bürgerkrieg.
Sie schreiben "asiatische Tiger, afrikanische Löwen, über die Ambitionen Afrikas". Sie schreiben über "Afrikas zweite Befreiung", da können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen, über die "neue afrikanische Ideologie und das Selbstbewusstsein" und über den "Aufbruch der Kinder der Moderne" in Afrika.
Hat Sie das Bild, was wir normalerweise über Afrika vielleicht in unseren Köpfen haben, hat Sie das geärgert?
Dominic Johnson: Ja, es hat mich geärgert. Es ist ja so: Ich hab jetzt 20 Jahre lang in der taz die Afrikaberichterstattung verantwortet. Ich habe sie nicht selber gemacht. Ich bin Redakteur, nicht Korrespondent, aber das macht es umso problematischer. Ich muss dann auswählen, was ist wichtig und was nicht? Wohin schicke ich Korrespondenten, wohin nicht? Welche Themen werden in welcher Weise aufbereitet? Und das ist ja so eine zweischneidige Sache.
Einerseits gibt’s ja den berechtigten Vorwurf, der ja gerade auch aus Afrika kommt, afrikanische Katastrophen und Kriege werden weniger wahrgenommen als die von woanders. Die Todeszahlen müssen schon dreistellig sein, bevor man drüber berichtet. Und das muss man ja ins Gleichgewicht bringen und die Probleme, die es in Afrika gibt, genauso ernst nehmen wie die Probleme anderswo.
Andererseits kann man dann auch nicht einfach nur, immer nur auf diese Entwicklungen gucken und immer nur die Leichen zählen und immer nur den Staatsverfall und die Bürgerkriege und eine Krise nach der anderen und den Scheinwerfer immer auf das Land, wo es gerade kracht, weil irgendwann – und das ist mir dann schon nach einiger Zeit auch selbstkritisch aufgefallen – stellt man sich dann die Frage: Ja, wieso gibt’s denn die Leute eigentlich noch? Die müssten doch eigentlich schon längst alle tot sein und der Kontinent müsste schon längst untergegangen sein.
Und wenn man hinfährt, merkt man ja, es ist nicht so. Selbst in Ländern, die ganz schlimme Dinge hinter sich haben, wenn man die heute besucht, es geht den Leuten besser als vor 20 Jahren. Es sind neue Generationen aufgewachsen, die neue Horizonte haben. Und Afrika ist ein Kontinent, der sich wahnsinnig schnell verändert, der sich wahnsinnig schnell auch selbst regeneriert und neue Wege findet. Und dem muss man auch irgendwie gerecht werden. Und das ist sehr viel schwieriger, als über Katastrophen zu berichten.
Wenn man nur das als Herausforderung nimmt, dann verlernt man irgendwann die eigentliche Herausforderung von journalistischer Berichterstattung – ob über Afrika oder einen anderen Teil der Welt –, deutlich zu machen, wie tickt ein Land, wie tickt eine Weltregion? Und die tickt eben nicht nur über ihre Probleme, sondern auch über ihre anderen Seiten.
Claus Leggewie: Herr Eckert, vor einigen Jahren gab es in der Afrika-Wissenschaft so eine Auseinandersetzung zwischen Pessimisten und Optimisten. An die kann ich mich noch erinnern. Hatten Sie damals Position bezogen in diesem Streit?
Andreas Eckert: Wir waren natürlich vermittelnd. Ich glaube aber, und das finde ich auch gut, dass Dominic Johnson dieses sehr schnittige Buch geschrieben hat, was doch zumindest am Anfang sehr positiv daherkommt. Am Ende wird es ja doch noch etwas unentschiedener.
Ich finde es eben wichtig, wie er sagt, die Krisen nicht zu verschweigen, aber zugleich, und das ist ja in Afrika gerade in diesen Jahren besonders sichtbar, auch die rasanten Veränderungen aufzunehmen und zu analysieren.
Natürlich könnte man jetzt anfangen, das machen wir ja gerne, mit der Detailkritik. Ich möchte allerdings vielleicht zwei Punkte doch noch mal ansprechen bzw. einfach noch mal genauer nachfragen.
Das Erste, was Dominic Johnson ja auch beschreibt, ist, dass gerade die Länder, die vielleicht ein besonders dynamisches ökonomisches Programm daher zaubern, und er nennt da Ruanda als Beispiel, auch eine Gegenseite haben, nämlich die Gefahr, dass gerade in diesen Ländern auch die politische Autorität oder – anders herum – ein autoritärer Politikstil greift und Oppositionen ja eigentlich nur stören bei diesem wirtschaftlichen Aufbruch, das heißt, Gegenstimmen, Dissidenten eher wieder weggedrängt werden. Das halte ich schon für ein relativ gewichtiges Problem. Und manchmal in der Feierlaune darüber, dass es jetzt auch wunderbare afrikanische Kapitalisten gibt, fällt das ein wenig vielleicht ab.
Und der zweite Punkt, auch der taucht in diesem Buch sporadisch auf, ist das Thema Staat. Es gibt weniger Staat, das finden offenbar die meisten auch ganz gut. Die Frage ist natürlich nur, wer – und da bleibt dieses Buch recht nebulös – übernimmt eigentlich die Aufgaben, die ein Staat normalerweise übernimmt und die mit dem Staat assoziiert werden? – Nämlich die Frage von sozialer Sicherung, von Wohlfahrt, von Infrastruktur. Es ist zwar von irgendwelchen tollen Straßen jetzt die Rede, die Afrika durchschneiden, aber wer die genau gebaut hat und – vor allen Dingen – wer die dann unterhält, das taucht nicht so genau auf.
Das heißt, ich würde schon noch mal fragen, was jetzt eigentlich – da ist ja in der Afrika-Forschung viel gemacht worden – die schwachen Staaten, die verschwindenden Staaten, wie es eigentlich sozusagen nach Ihrer Meinung dann mit dem Staat in Zukunft in Afrika aussieht, welche Rolle der eigentlich im neuen Afrika überhaupt noch spielen sollte und könnte.
Und vielleicht ein dritter Punkt, wenn ich noch darf – das ist ja auch Ihr Lieblingsthema –, ist die Umwelt. Gerade, weil die großen Städte hier auch als ganz dynamische Horte der Entwicklung zelebriert werden, sind es natürlich gleichsam auch die Orte, an denen sozusagen jeder Umweltfreund doch relativ hektische Flecken im Gesicht bekommt – wenn nicht von der Luft, dann von den Zuständen. Und da wäre doch auch die Frage, wie dieses Problem und die von vielen jedenfalls so bezeichnete "Verwundbarkeit" Afrikas in ökologischen Fragen eigentlich auch im Zukunftsoptimismus mitspielt.
Claus Leggewie: Ja, Herr Johnson, eine autoritäre Modernisierung auf Kosten der Umwelt und der unteren Schichten, die nicht mitgenommen werden – ich fasse es mal ziemlich plakativ zusammen. Was sagen Sie?
Dominic Johnson: Ja, das ist ja überhaupt nix Neues. Das ist ja seit 100 Jahren so. Das ist eben, wo die Terminologie auch ein bisschen verrutscht. Wenn Sie sagen, das, was ein Staat "normalerweise" macht, dann ist es das, was ein Staat hier normalerweise macht. Ein afrikanischer Staat macht das normalerweise sowieso überhaupt nicht – soziale Sicherung usw. Welcher afrikanische Staat hat das je getan? Kein einziger. Der Staat ist ein Autoritäts- und Erzwingungsinstrument. Das ist das Staatsverständnis aus der Kolonialzeit, was es bis heute gibt. Leute, die regieren, die sagen, so habt ihr zu leben. Wir organisieren das jetzt so. Daran habt ihr euch zu halten. Und wenn ihr nicht wollt, dann zwingen wir euch.
Das Risiko, was ja dann immer besteht, ist, dass die Leute, die das sagen, das aus ihrem privaten Interesse machen und nicht aus dem Interesse des Gemeinwohls. Das ist ja die Krise der Staatlichkeit, die wir in Afrika haben.
Das heißt, das, was Sie als Normalzustand darstellen, den gibt’s in Afrika gar nicht. Der wäre erst mal herzustellen. Das wäre natürlich schön, aber so weit sind wir eigentlich nicht, sondern wir sind erstmal in der Zeit, wo man anfängt, jenseits des Staates zu denken. Und das ist sehr wichtig, dass auch mal was erlaubt ist, wo nicht die Regierung erst sagt, das darfst du tun. Das ist ein unheimlich wichtiger Gedanke für das Vorankommen von Menschen in einer Gesellschaft, wo das Überleben schon eine große Herausforderung ist.
Wenn sich das verankert in der Gesellschaft – ja, ich kann auch was machen, ohne dass es mir ein Staat erlaubt, ich kann auch was machen, selbst wenn der Staat sagt, es geht nicht, aber das ist dann egal, sondern wir machen das einfach -, das ist ein Stück Aneignung des eigenen Schicksals. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig dafür, das gesellschaftliche Potenzial freizusetzen von dieser Milliarde Menschen, die ja ihren Kontinent gerade aufbauen.
Das ist was, was gerade in Ländern, die das Schlimmste schon hinter sich haben – jedenfalls hoffen wir, sie haben es hinter sich...
Claus Leggewie: Zum Beispiel?
Dominic Johnson: Zum Beispiel Ruanda nach dem Völkermord, zum Beispiel Nigeria nach der Militärdiktatur, zum Beispiel auch Süd-Sudan jetzt nach den Jahrzehnten Krieg, vielleicht auch irgendwann mal der Kongo, falls es sich irgendwann stabilisiert. Alle diese Länder haben gemein, dass die Leute sagen: Wir haben das durchlebt. Wir lassen uns nicht mehr einfach nur sagen, wir müssen das so und so machen, sondern wir haben unsere Zukunft unter großen Opfern selber in die Hände nehmen müssen.
Also, ich erinnere mich an Diskussionen mit Nigerianern noch zur Zeit der Militärdiktatur, als es ganz schlimm war unter Sani Abacha und die nigerianische Demokratiebewegung hier in Europa viel Lobbyarbeit gemacht hat. Und dann sagten die immer zu fortgeschrittener Stunde am Abend: Ihr werdet euch noch wundern! Wir wissen das doch schon alles. Wenn wir das einmal schaffen, dann werden wir den anderen zeigen, wie es geht. Wir haben doch schon diesen ganzen Scheiß erlebt. Uns wird keiner mehr reinreden. – Und das Gleiche jetzt ein bisschen zu sehr als offizielle Ideologie macht ja die ruandische Regierung, die sagt: Mit welchem Recht kommt irgendjemand und sagt uns, was wir zu tun haben, nachdem die zugeguckt haben, wie eine Million Menschen abgeschlachtet wurden? – Und das wenden sie natürlich auch gegenüber der eigenen Bevölkerung an, die ja da mitgemacht hat.
Der Punkt aber ist, dass – wenn sich mal die politischen Verhältnisse komplett aufgelöst haben und dann erst wieder neu aufgebaut werden – dann gibt es viel mehr Möglichkeiten für die Menschen selber auch zu sagen, wir könnten das ja so machen oder wir könnten es so machen. Es ist nicht einfach von der Geschichte vorgegeben, sondern man hat Möglichkeiten zu entscheiden.
Claus Leggewie: Herr Eckert, ist das gelebte Demokratie nach einer Katharsis, durchs Feuer gegangen zu sein?
Andreas Eckert: So tönt es ein wenig. Und, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht, das wäre auch nicht meine Rolle, den Afro-Pessimisten geben, aber doch noch mal nachfragen. Also, der Punkt, dass Leute jenseits des Staates agieren mussten, der ist ja nun schon länger da, weil der Staat, wie Sie richtig sagen, zwar am Anfang dieses Programm hatte, aber ja nie eingelöst hat. Das ist ja erstmal nichts Neues, dass sich Menschen in anderer Form organisieren müssen.
Und – das schreiben Sie auch selber in Ihrem Buch – es ist eine offene Situation. Es kann auch schief gehen. Und es können sich natürlich auch Entwicklungen oder Modelle durchsetzen, die wir nicht so freundlich fänden und die vielleicht für den Großteil der Menschen dort auch nicht besonders positiv daherkämen.
Da wäre zum Beispiel die Frage: Wer sind denn eigentlich die Leute, die diesen Aufbruch machen? Wen nehmen sie mit? Wen sprechen sie an? Sie haben selbst in Ihrem Buch kurz davon geschrieben, dass es auch natürlich Leute gibt, die abgekoppelt sind und immer stärker abgekoppelt sind, je größer auch etwa die Bedeutungen des Zugangs zu Kommunikation, zu Medien etc. werden.
Und der zweite Punkt, auch den sprechen Sie kurz an. Ich meine, da müsste man eben auch noch mal nachfragen. Wer kommt vielleicht jetzt mittelfristig in das Privileg? Wer kann Zugang finden? Das ist die Frage von Bildung und Universitäten. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, auch wenn man das gern möchte, mit den asiatischen Tigern oder mit anderen Regionen sich vergleicht, die Frage des Know-hows, der Technologie, der Bildung. Und da sehe ich zum Beispiel noch nicht so richtig, wie auch gerade die – sagen wir mal – dynamischen Kräfte und Politiker und Ökonomen oder Unternehmer in Afrika gerade diesen Bereich fördern.
Es schießen zwar immer mehr Privatuniversitäten aus dem Boden, aber teilweise noch mit einem relativ dünnen Fundament. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo sich vieles in Zukunft in Afrika entscheidet. Und ich sehe noch nicht so richtig sozusagen, wer da eigentlich von profitieren will. Das klingt bei Ihnen so die Afrikaner und breite Massen und Aufbruch. Aber könnte es nicht sein, dass es am Ende dann doch wieder eine relativ kleine Gruppe sein wird, die sozusagen diese Privilegien und dieses neue Afrika dann gestaltet und viele doch wieder hinten über kippen? Das wäre zumindest etwas, was in dieser offenen Situation droht. Und man kann ja an Ruanda und anderen sehen, dass der – wer irgendwie einen bestimmten Weg nicht mitmacht – auch relativ schnell außen vor bleibt.
Dominic Johnson: Natürlich ist es eine Minderheit. Die Mehrheit ist ausgeschlossen, nach wie vor. Das ist klar. 80 Prozent der Afrikaner, die arbeiten könnten, haben keine bezahlte Arbeit. Daran hat sich nichts geändert. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Der Unterschied ist, ich will da auch gar nix schön reden, ich denke, es geht auch um unseren Fokus, es gibt Akteure. Und die sind vor Ort. Sie sind nicht hier. Es ist nicht so, als ob man sagen müsste, die Bösen sitzen in Washington und Paris und Moskau und sonst was und ziehen die Fäden. Sondern die, die was bestimmen und gestalten können, sitzen in den eigenen Ländern. Das ist ja auch schon mal was. Und das muss man, glaube ich, erst mal sehen. Dann kommt man weiter.
Das heißt ja auch, dass sich im Laufe der Zeit eine Diskussion in den Ländern selber ergeben wird. Wenn sich eine Elite herausbildet in den Ländern, in manchen, in Südafrika ist das sehr sichtbar, in Nigeria ist das sehr sichtbar, in allen Ländern, wo sich ein freies Unternehmertum rausbildet, ist das jetzt die große Frage. Natürlich gibt es eine Klassenfrage jetzt in Afrika von dieser neuen Unternehmerschicht, die ganz viel Geld hat, aber auch das ist ein Fortschritt. Früher gab's die nicht. Es gab dieses Geld in Afrika nicht. Jetzt ist es da. So. Was macht man damit?
Es sind erst mal Leute da, die verfügen darüber. Die können Dinge tun. Es gibt ganz viele Leute, die verfügen darüber nicht und können nichts tun. Aber der Rahmen der politischen Debatte, der wandert zurück in die Gesellschaften. Ich finde das eine ganz spannende Entwicklung. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, was ist daran positiv, was ist daran negativ, sondern ich stelle es einfach fest.
Claus Leggewie: Es ist zunächst mal sozusagen gegen die antikoloniale Phrase gerichtet, wenn Sie sagen, nicht in Washington, nicht in Paris, die Entscheidungen fallen in Afrika selbst – so oder so. Und Sie haben vielleicht ein Beispiel mal aus Ihrer Beobachtung von einem Land. Sie sagen ja selber, der Prozess ist offen und ambivalent, aber wo funktioniert es denn so, wie Sie es gerne hätten?
Dominic Johnson: Ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt ein Erfolgsmodell. Ich sehe Entwicklungen, wie sie sich verändern. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Südafrika, wo ja auch die Entwicklung völlig offen ist und wo es ja berechtigte Kritik daran gibt, was der ANC macht und ob Zuma nicht auch so eine Art populistische Politik führt, die eigentlich nur einer kleinen Elite dient. Aber es gibt eben das, was es vor 20 Jahren nicht gab. Eine sehr mächtige, sowohl politisch als auch finanziell mächtige schwarze Mittelschicht, die hat das Land in der Hand. Das ist eine Veränderung.
Ich nehme ein anderes Beispiel – Nigeria: Das ist das Land, wo wahrscheinlich am meisten Geld von außen reinkommt, weil es die meisten Ölexporte hat. Milliarden fließen da rein. Es ist das bevölkerungsreichste Land. Es ist ein Land mit wahnsinnig vielen Problemen. Dabei ist es auch das Land mit den reichsten Privatunternehmern Afrikas, die riesige Projekte zur Umgestaltung von Lagos haben zum Beispiel, das ja die größte Stadt des Kontinents ist, vielleicht auch demnächst die größte Stadt der Welt. Diese Stadt wird ja gerade völlig umgekrempelt. Alle möglichen Dinge sind da im Gespräch, was man mit diesem Land von 150 Millionen Leuten machen soll.
Wir erfahren darüber hier relativ wenig – aus gutem Grund. Es wird darüber nicht hier befunden. Die Leute kommen nicht hierher und sagen, könnt ihr uns helfen, Lagos vorm Untergang ins Meer zu retten? Die sagen nicht, könnt ihr uns mal helfen, unser Stromnetz aufzubauen – und so? Die überlegen sich das selber. Wir erfahren darüber relativ wenig, aber es sind Diskussionen, die stattfinden.
Das Gleiche mit dem ersten Beispiel, was ich nannte, Südafrika: Die schwarzen Unternehmer, die der ANC herangezüchtet hat, die jetzt Zumas Basis sind, diese Bling-Kultur durch das black economic empowerment das ist ja irgendwie auch was ein bisschen Obszönes, aber gleichzeitig auch eine Bestätigung. Wir sind jetzt wer. Wir können uns das leisten. Wir leisten uns das auch. Es sind nicht mehr nur die Weißen, die damit protzen dürfen, dass sie Geld haben, sondern wir machen das auch. Und das ist selbst für die Leute, die kein Geld haben, wichtig, dass es das gibt.
Claus Leggewie: Wir sollten uns mal dem zweiten Buch zuwenden von Helmut Müller, einem Journalisten der Salzburger Nachrichten. Er hat ein Buch geschrieben, "Afrika – Der geplünderte Kontinent". Hat's Ihnen gefallen, Herr Eckert?
Andreas Eckert: Jein. Also, der Titel suggeriert ja wieder eher das negative Bild, gegen das Dominic Johnson und andere anschreiben, nämlich Afrika wird ausgeblutet, ausgebeutet von außen, hat nichts zu sagen, hat keine eigene Meinung. – Das wird im Buch dann doch sehr stark revidiert. Und im Grunde ist es so eine Art Analogie, Zusammenfassung verschiedener Positionen, die es zu Afrika in Wissenschaft und Politik und Medien gibt.
Also, wie Dominic Johnson auch, sieht Helmut Müller Afrika am Wendepunkt und sieht auch eine wichtige Transformationsphase in Afrika im Gange mit offenem Ausgang. Er ist, glaube ich, noch etwas kritischer bzw. die Stimmen, denen er Gehör verschafft, sind doch noch sehr oft im Sinne: Afrika ist ein Sozialfall, Afrika leidet unter seinem Ressourcenfluch, Afrika ist immer noch der Spielball äußerer Interessen. Was er aber eben auch betont, ist Ihre Eingangsfrage: Afrika gibt es vielleicht, aber Afrika ist äußerst vielfältig. Und wenn etwas in Somalia passiert, ist das nicht unbedingt ein Indikator für Entwicklungen in ganz Afrika.
Er spricht eben eine Reihe auch von Punkten an, die – das Buch ist auch etwas umfangreicher als das von Dominic Johnson – da nicht vorkommen, ein Thema, was ja vielfach bis heute auch die Öffentlichkeit bewegt, die Frage der Entwicklungshilfe. Ist das Fluch? Ist das Segen? Muss man die jetzt radikal abschaffen? Natürlich auch die selbstbewussten afrikanischen Politiker, wie Kagame, basieren ja ihr Projekt zu einem Großteil auch immer noch auf Entwicklungshilfe, selbst wenn es mittelfristig dann weniger werden soll und auch so festgeschrieben ist. Aber natürlich hat dieser Bereich für Afrikas Ökonomien immer noch eine ganz enorme Bedeutung. Das wird debattiert. Die Rolle Chinas, ebenfalls etwas, was sehr stark ja in der Öffentlichkeit hier diskutiert worden ist, kommt rein. Und er endet immer so mit einem "ja, aber" oder "das oder das", es könnte sozusagen beides sein.
Ein anderer wichtiger Punkt, der scheint mir wirklich sehr relevant, ist das, was man das land grabbing oder das Land-Raffen nennt, dass natürlich internationale Konzerne – nicht nur aus China, aus Europa, aber auch aus dem Nahen Osten – größere Landregionen einfach erst mal aufkaufen, und die Frage sozusagen, wer profitiert davon, das ist eben eine Frage, glaube ich, die offen ist, aber die man sehr sorgfältig beobachten muss.
Selbst wenn Afrika jetzt von den ökonomischen Daten her besser dastehen wird, die Frage, wer profitiert am Ende davon und wie wird organisiert, dass diese – es gab ja diesen schönen Roman – "My Mercedes is bigger than yours"-Leute eben nicht die einzigen sind. Und am Ende freuen sich dann die Leute nicht nur, weil ein paar Leute mit ihrem Mercedes protzen, sondern sehen auch, dass sie selbst dann nichts zu essen haben.
Und auch die Enttäuschung in Südafrika, Mittelschicht hin oder her, ist natürlich sehr, sehr groß bei vielen Leuten, bei denen die Verheißungen, die am Ende der Apartheid formuliert worden sind, nicht angekommen sind. Und dieses große Potenzial an Leuten, was Sie in Ihrem Buch auch mal kurz ansprechen, was hier auch angesprochen wird, wird eben auch die Zukunft Afrikas entscheiden und nicht nur die kleine dynamische Elite, die sich jetzt vielleicht neu und mit einem größeren Selbstbewusstsein formuliert.
Und ein letzter Punkt noch: Er geht natürlich auch auf ein Lieblingsthema von Wissenschaftlern ein, nämlich die Afrikaberichterstattung. Wir schieben uns ja immer gegenseitig dann gerne die Bälle zu. Die Journalisten sagen, die Historiker oder die Wissenschaftler können nicht schreiben und keinen einzigen geraden Satz formulieren, während wir immer sagen: Also, diese Verkürzungen und diese Plattitüden. Ich glaube, er beschreibt relativ gut – und lässt auch da unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen –, wie eigentlich auch Berichterstattung über Afrika entsteht. Sie haben das ja auch selber beschrieben, die Entscheidung, was kommt rein und was kommt nicht rein, wer ist überhaupt vor Ort und kann kompetent darüber berichten. Das finde ich eigentlich ein relativ gutes Kapitel.
Und er spricht auch noch mal kurz die Frage des Klimawandels an und dass das ein ganz entscheidender Punkt sein wird, der eben auch die Zukunft Afrikas mit entscheiden wird, auch der Umgang mit Ressourcen und was die radikale Ressourcenausbeutung, die vielen schönen Bodenschätze, für die sich alle interessieren, natürlich dann auch für die Umwelt bedeuten. Das wird alles relativ kurz angesprochen, aber ich glaube, es ist für jeden eine ganz gute Einführung in die verschiedenen Perspektiven, die man auf den Kontinent haben kann.
Der Autor selbst hält sich mit seiner Meinung sehr zurück. Und das ist dann auch der Vorteil. Dann können die Leserinnen und Leser sich ihr eigenes Urteil bilden.
Claus Leggewie: Stimmen Sie zu, Herr Johnson, in dem Urteil über das Buch Ihres Kollegen, so eine Art Afrika für Anfänger?
Dominic Johnson: Das ist es sicher. Es ist ein Überblick über die verschiedenen Probleme und die Meinungen dazu, die es hier so gibt.
Ich glaube, der Unterschied ist, was ich versucht habe stärker rauszuarbeiten, ist, wie die Sichtweise aus dem Kontinent sich auch verändert hat und nicht nur die Sichtweise von hier aus. Ich denke, das ist was, das muss hier vielleicht auch noch mehr rezipiert werden, dass es ja auch eine veränderte Sichtweise in vielen afrikanischen Ländern auf sich selbst gibt und auf die Art, wie über einen gesprochen wird, und dass man das weniger als früher einfach übernimmt, was von außen an Diskurs kommt, an Analyse, Mustern, an Ideologien usw. Die Zeit ist in Afrika eigentlich vorbei, dass man sich von außen sagen lässt, wie Afrika ist.
Und das, denke ich, wird einen Unterschied machen in den politischen Beziehungen. Dann wird man auch so nicht mehr reden können. Viele der Diskussionen, die wir jetzt führen, ob das Klimawandel oder land grabbing oder so sind, die sind ja immer noch sehr geprägt davon, wie sehen wir was. Und dann gucken wir mal, ist es in Afrika so. Und dann übertragen wir unsere Analyse dorthin. Ohne dass daran irgendwas im Detail falsch sein muss, wird es irgendwann nicht mehr sehr weit führen, weil die Voraussetzungen nicht akzeptiert werden vom Gesprächspartner. Und das wird ein Problem darstellen. Und dem muss man sich stellen.
Ich nehme einfach mal das Beispiel land grabbing. Da wird ja jetzt sehr viel drüber geredet. Ich hab damit zwei Probleme: Das eine ist, dass in der Realität sehr viel weniger passiert, als immer wieder geschrieben wird. Die meisten Projekte werden zwar verkündet, aber nicht umgesetzt. Mindestens drei Viertel von den Sachen, die die Regierungen sagen, die sie machen werden, tun sie dann nicht. Die Projekte kommen nicht zustande. Da guckt man also auch viel zu wenig genau hin, was eigentlich tatsächlich passiert, wenn was angekündigt wird, was ist der Unterschied.
Und das Zweite ist, dass natürlich dann immer wieder auch von afrikanischer Seite – ob zurecht oder nicht sei jetzt erstmal dahingestellt – der etwas verwunderte Vorwurf kommt: Naja, land grabbing, das kennen wir. Vor 100 Jahren gab's 100 Prozent land grabbing von Europa aus und ohne jede Gegenleistung. Es wurde einfach genommen. – Und jetzt verkaufen wir oder machen Investitionen in Partnerschaften mit asiatischen Ländern. Und jetzt kommen die Europäer und sagen, das ist aber ein Problem für die Entwicklung. – Wieso müssen wir uns diese Kritik reinziehen?
Das ist was, was dann von hier wiederum nicht gesehen wird, sondern dann wird auch nur wieder gesagt, na ja, das beweist ja die Abhängigkeit von den Chinesen usw. Das heißt, das Potenzial für Missverständnisse ist sehr groß geworden. Dem muss man sich stellen in der Diskussion.
Claus Leggewie: Der Kolonialismusexperte Eckert noch mal: Ist das denn jetzt eine Form von Neokolonialismus? Oder muss man da modifizieren, differenzieren?
Andreas Eckert: Da muss man sicher modifizieren. Ich wollte nur sagen, das ist alles ganz richtig, nur für den Bauern, der dann keinen Zugang zu Land hat – und die gibt’s natürlich dann auch –, macht das jetzt keinen Unterschied, wer wie darüber redet. Ich gebe ja völlig zu, dass diese ganze Debatte neu vermessen werden muss, dass sich auch afrikanische Intellektuelle und Politiker vielleicht eher Richtung Asien orientieren und dass Europäer ganz enttäuscht dastehen, weil eigentlich mit ihnen niemand mehr sprechen will. Trotzdem ist es ja so auch nicht.
Und natürlich geht immer noch vieles, gerade wenn wir etwa im Bereich Bildung und Ausbildung schauen, immer noch nach Amerika oder nach Europa – vielleicht jetzt verstärkt in einige asiatische Universitäten, aber ich glaube, ganz so außen vor ist selbst für diese Eliten Europa auch nicht.
Natürlich hat es auch schon früher sehr selbstbewusste Reden afrikanischer Politiker gegeben, dass sie Europa nicht brauchen und ihr Eigenes haben und so, aber dann doch sehr viel enger – wie Julius Nyerere, der zwar einen afrikanischen Sozialismus erfunden hat, der doch verdammt nach den Fabiern ausschaute und dem Fabier-Sozialismus. Ich glaube, das muss man alles dann auch sehr viel komplexer sehen.
Ich glaube, Neokolonialismus ist vielleicht dann der falsche Begriff, weil er sozusagen dann so tut, als sei es im Grunde eine gradlinige Fortsetzung des Kolonialismus vor 1960. Aber es gibt weiterhin Abhängigkeiten. Es gibt weiterhin Interessen. Und es gibt, wie damals auch, bestimmte Gruppen in Afrika, die davon profitieren, und eine große Menge, die davon nicht profitieren. Und ich glaube, daran entscheidet sich für mich der große Sprung.
Claus Leggewie: Wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Wir haben zwei Bücher besprochen: Helmut Müller, "Afrika – Der geplünderte Kontinent", und Dominic Johnson, "Afrika vor dem großen Sprung". Und in Lesart machen wir es immer so, dass die beiden Gäste immer noch Bücher vorschlagen, die sie gerade gelesen haben und empfehlen möchten. Herr Eckert, welches Buch möchten Sie gern empfehlen?
Andreas Eckert: Ich möchte ein Buch empfehlen von einem Journalisten wiederum, Heinrich Bergstresser. Das Buch heißt "Nigeria – Macht und Ohnmacht am Golf von Guinea". Für einen Journalisten, sage ich mal ganz keck, ist das Buch jetzt nicht besonders elegant geschrieben, aber es ist sehr informativ und bietet eine sehr, sehr gute Einführung in ganz verschiedene Aspekte der jüngeren Geschichte und Gegenwart Nigerias. Das heißt, dieses doch sehr unübersichtliche Geflecht zwischen Politik und Religion wird da eigentlich sehr gut aufgedröselt. Also, ich denke, für dieses Land, was so wichtig und hier doch sehr unbekannt ist, ist es eine exzellente Einführung.
Claus Leggewie: Herr Johnson, Sie haben auch einen Tipp.
Dominic Johnson: Ja, ich wollte Ihnen ans Herz legen die deutsche Übersetzung des Buchs von Michela Wrong über Kenia und den Kampf gegen Korruption dort, auf Deutsch herausgekommen unter dem Titel: "Jetzt sind wir dran. Korruption in Kenia – Die Geschichte des John Githongo". Das ist ein Buch, das handelt von dem letztendlich erfolglosen Kampf eines sehr mutigen Kenianers, die korrupte kenianische Politik aufzudröseln und daran etwas zu ändern.
Claus Leggewie: Und das Buch ist erschienen im Verlag Klaus Bittermann, das Buch von Herrn Bergstresser im Verlag Brandes & Apsel.
Das war eine Sendung über Afrika zwischen Aufbruchstimmung und Ausverkauf. Wir haben, glaube ich, es geschafft, das Afrikabild ein bisschen differenzierter darzustellen.
Das war eine neue Ausgabe von Lesart Spezial, eine gemeinsame Veranstaltung vom Deutschlandradio Kultur, dem Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, der Buchhandlung "Proust", dem Schauspiel Essen und unserem Medienpartner, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, Herrn Johnson, Herrn Eckert, bei Ihnen hier im Café Central und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
Dominic Johnson: Afrika vor dem großen Sprung
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2011
Helmut L. Müller: Afrika - Der geplünderte Kontinent
Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 2011

Cover: "Dominic Johnson: Afrika vor dem großen Sprung"© Verlag Klaus Wagenbach Berlin
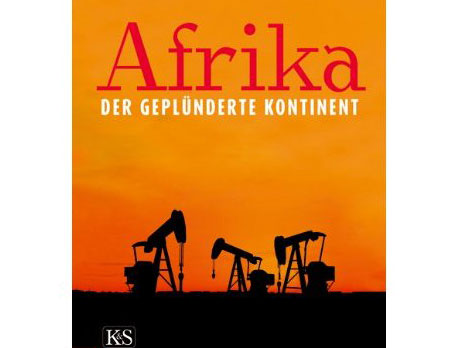
Cover: "Helmut L. Müller: Afrika - Der geplünderte Kontinent"© Verlag Kremayr & Scheriau
