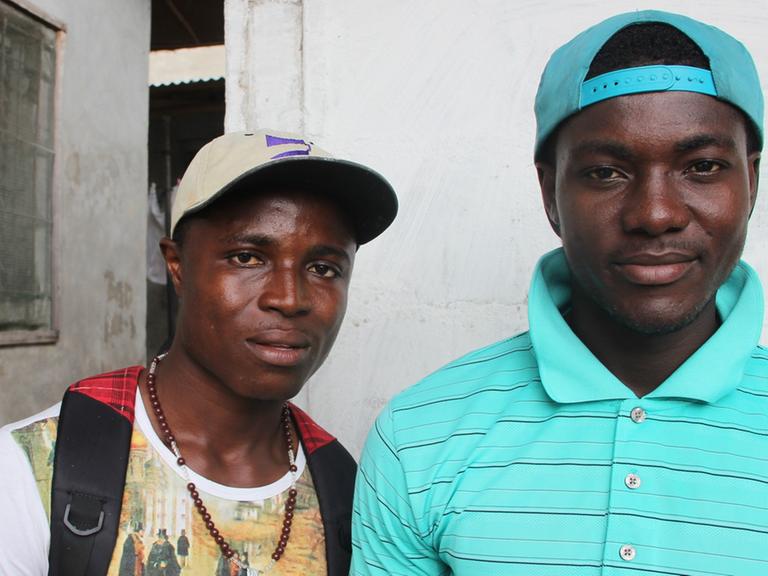Bessere Prävention, neue Probleme
21:33 Minuten

Seit 2016 gilt Ebola an Afrikas Westküste als besiegt. Rund 11.000 Menschen starben damals an dem Virus, besonders betroffen war Liberia. Vier Jahre später bleibt das Gesundheitssystem marode, der Wirtschaft geht es schlecht, die Helfer sind weg.
"Ich hatte Ebola und mein Mann hat mich nach dieser Ebola-Geschichte verlassen. Nach all dem hatte ich noch eine Operation, an der ich fast gestorben bin. Es ist ein Kampf. Aber ich kann hier auch nicht einfach nur rumsitzen und jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, jammern, dass ich eine Ebola-Überlebende bin. Das ist unser Problem hier."
Betty sitzt in ihrer kleinen Bar in Taylor Ta. Sie ist eine von zwölf Menschen dort, die Ebola überlebt haben. 14 Nachbarn aus dem abgelegenen Dorf im Norden Liberias sind gestorben. Angst, Misstrauen und Hass hatten die Gemeinschaft in Taylor Ta zerrüttet.
"Es gab hier Organisationen, die uns nach Ebola ein wenig geholfen haben. All das hat aufgehört. Vor allem für uns, die hier im Busch leben. Wenn wir nicht für uns selber kämpfen, ist es sehr schwer."
Nach der Epidemie kam die Wirtschaftskrise
Oft zu Besuch im Dorf Taylor Ta ist Viktor Padmore. Er ist Pastor und Seelsorger an einem Krankenhaus etwa eineinhalb Stunden Fahrt entfernt. Von 2014 bis 2016 grassierte das Virus in Liberia, insgesamt steckten sich im ganzen Land mehr als 10.000 Menschen an, fast die Hälfte davon überlebte es nicht. Der Pastor stand den Dorfbewohnern während des Ebola-Ausbruchs zur Seite, er vermittelte als Mediator und kümmerte sich um Waisenkinder. Nach langer Zeit ist er nun wieder einmal zu Besuch.

Während der Ebola-Krise bekam Liberia viel Unterstützung aus dem Ausland: Hilfsorganisationen verteilen Schutzkits an die Bevölkerung.© Getty Images / Anadolu Agency
Die Geschichten, die der großgewachsene Mann von den Überlebenden im Dorf hört, entmutigen ihn. Stigmatisiert werden sie nicht mehr – so wie anfangs, als sie aus den Behandlungszentren nach Hause kamen. Heute haben sie andere Probleme: Eine Frau erzählt von anhaltenden Schmerzen, seitdem sie Ebola hatte. Sie kann nicht mehr auf dem Feld arbeiten. Eine andere hat während der Epidemie ihre Tochter verloren und muss sich nun um die Enkelkinder kümmern. Sie hat kein Geld, um die Kleinen zur Schule zu schicken.
"Vielerorts herrscht Wirtschaftskrise, auch hier. Sicher, unsere Regierung wird schon ihr Bestes versuchen, aber es ist schrecklich. Erst haben die Menschen unter Ebola gelitten und jetzt haben wir diese wirtschaftliche Situation. Es ist ganz schön schwer. Wir versuchen damit zurechtzukommen, aber das ist nicht leicht. Es tut weh."
Nicht nur die Überlebenden, sondern alle hier fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Eine junge Frau, die Suppenwürfel, Chili und Seife an einem hölzernen Marktstand verkauft, nur ein paar Meter von Bettys Bar entfernt, ist aufgebracht.
"Ebola ist weg aus Liberia, aber uns geht es nicht gut! Wir sind krank in Liberia. Wenn ihr also wieder heimfahrt, dann sagt nicht, dass hier alles gut ist, nein! Ihr müsst Medikamente schicken. Es gibt keine Medikamente in Liberia! Versteht ihr mich? Der Hunger hier ist schlimm! Wir leiden hier unter den hohen Preisen! Wir leiden hier in Liberia!"
Zwei Bürgerkriege haben das Land verwüstet
An den Ebola-Ausbruch von damals denken die meisten hier nicht mehr. Aber nicht, weil sie ihre Toten, das Leid und die Angst vergessen hätten, sondern weil sie heute mit neuen Problemen konfrontiert sind. Eines davon ist das marode liberianische Gesundheitssystem. Nachdem zwei Bürgerkriege zwischen 1989 und 2003 das Land verwüstet hatten, war es langsam wieder bergauf gegangen. Doch dann kam Ebola:
"Der Kollateralschaden am Gesundheitssystem, am Bildungswesen, an der Wirtschaft kann mit nichts verglichen werden."
Tolbert Nyenswah war Vize-Gesundheitsminister und Leiter des Ebola Incident Management Systems, koordinierte alle nationalen und internationalen Teams im Kampf gegen das Virus. Ebola traf das Land damals völlig unvorbereitet, sagt er. Es hatte zuvor keine Ausbrüche in Westafrika gegeben. Die Menschen kannten das Virus nicht, Ärzte und Krankenschwestern steckten sich an. Das hatte fatale Folgen:
"Wir haben 179 Gesundheitsmitarbeiter verloren, darunter waren Ärzte, Spezialisten, Internisten, Gynäkologen, Chirurgen. In einem Land wie Liberia dauert es bis zu zehn Jahre, einen Arzt auszubilden. Wenn man also so viele Mitarbeiter inklusive Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen verliert, dann hat das Auswirkungen auf das Gesundheitssystem."
Während der Ebola-Epidemie fanden kaum Routineimpfungen statt. Die Immunisierungsrate im Land fiel von 65 auf weniger als 25 Prozent. Schwangere Frauen gebaren wieder in ihren Dörfern. Zu groß war die Angst, sich in einem Krankenhaus an dem Virus anzustecken, und so stieg die Muttersterblichkeit. Darüber hinaus waren während des Ausbruchs viele Krankenhäuser geschlossen oder wurden zu Ebola-Behandlungszentren umfunktioniert. Auch die Wirtschaft Liberias wurde schwer getroffen. Das Bruttoinlandsprodukt war vor dem Ausbruch am Wachsen. Dann kam die Epidemie und es fiel von 8,5 auf 0,5 Prozent.
Bessere Früherkennung von Epidemien
Zumindest, so glaubt Nyenswah, wäre man heute auf einen Ausbruch besser vorbereitet. Dabei soll auch das National Public Health Institute of Liberia helfen. Das Institut wurde kurz nach dem Ende Ebolas eröffnet und ist verantwortlich für die Früherkennung und Bekämpfung von Epidemien. Als das Virus ausbrach, gab es nicht einmal ein Labor, das die Blutproben von Patienten auf Ebola untersuchen konnte.
"Vor Ebola konnten wir drei Krankheiten testen, die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Heute testen wir elf oder zwölf, wie etwa Gelbfieber, Lassa-Fieber, Ebola, Masern, Cholera, Meningitis. Diese Krankheiten können wir jetzt in weniger als 24, oder 48 Stunden testen. Unsere Kapazität zu reagieren ist heute zehn Mal besser als vor Ebola, wegen all der Unterstützung und internationaler Zusammenarbeit."
So mag Liberia in punkto Prävention heute besser dastehen als vor Ebola, doch was die kurative Seite des Gesundheitssystem angeht, so sieht es weniger rosig aus.
Vor Ebola waren Medikamente da und kostenlos
"Vor zwei Tagen wurde ich krank und bin ins Krankenhaus gegangen. Ich bin schwanger und habe Magengeschwüre und die Ärzte sagen, ich habe Typhus. Die haben mich gestern aufgenommen, um mich zu beobachten."
Comfort Gbainsay hockt auf einem schmalen Bett unter einem Moskitonetz in einem fast leeren Saal des C.B. Dunbar Krankenhauses. Die Geburtenklinik liegt auf der Hauptstraße, die durch Gbarnga führt, eine chaotische Kleinstadt im Norden Liberias. Die 37-jährige Frau trägt ein weißes T-Shirt. Um ihre Hüfte hat sie ein buntes Tuch gewickelt. Unter ihren Augen sind dunkle Ringe. Sie wirkt erschöpft.
"Die haben mir ein Rezept geschrieben. Ich muss die Medikamente aber selber kaufen, weil die nicht alles hier haben."
Seitdem Comfort im Krankenhaus ist, hat sie schon mehr als 3000 Liberianische Dollar - umgerechnet etwa 14 Euro - für Medikamente ausgeben. Das ist ein Drittel ihres monatlichen Gehalts als Lehrerin. Eines der Medikamente ist in Gbarnga nirgendwo aufzutreiben, keine Apotheke hat es auf Lager. Nun ist ihr Mann auf dem Weg ins drei Stunden entfernte Monrovia, um es dort zu kaufen.
Comfort hat ihre ersten beiden Kinder hier im Krankenhaus bekommen. Damals sei alles noch besser gewesen. Heute müsse man für alles selber bezahlen. Dabei ist C.B. Dunbar ein öffentliches Krankenhaus und die meisten Behandlungen und Medikamente sollten kostenlos sein. So sei das zumindest vor dem Ebola-Ausbruch gewesen. Neben Comforts Bett steht Mabel Musa, leitende Schwester im Krankenhaus.
"In 2011, 2012, 2013, sogar bis 2014, vor dem Ebola-Ausbruch hatten wir alle Arten von Medikamenten. Da hatten wir einen Partner, der das Krankenhaus verwaltet hat. Wir hatten Medicin du Monde, die sich um das Krankenhaus gekümmert haben. Heute ist das nicht mehr so."
Auf der Station ist es stockdunkel. Mit einer Taschenlampe in der einen und einem Löffel in der anderen Hand isst die Patientin ihr Abendessen aus einer Plastikbox. Strom gibt es nur für ein paar Stunden am Tag, weil das Krankenhaus nicht genügend Geld hat, um den Generator 24 Stunden laufen zu lassen. Im Rest des Landes sieht es nicht besser aus. Immer wieder streiken Ärzte und Krankenschwestern gegen niedrige Gehälter, verspätete Zahlungen und schlechte Arbeitsverhältnisse. Schwester Mabel Musa:
"Eine Patientin hat lebensrettende Medikamente gebraucht. Sie war unter Schock, aber wir hatten diese Medikamente nicht. Wir haben im Krankenhaus danach gesucht und alle Schwestern gefragt. Aber bevor das Rezept geschrieben war, war sie schon tot. Das tut uns weh. Es ist eine riesige Herausforderung für das Personal und für die Patienten. Manche Patienten kaufen sogar ihre eigenen Handschuhe. Die kaufen die Handschuhe, fassen sie an – und dann müssen wir die tragen. Das ist gefährlich für uns."
Von Milliarden aus Ebola-Bekämpfung blieb wenig
Es fehlt nicht nur an Medikamenten und sterilen Einweghandschuhen. Eine lokale Zeitung berichtet von einem Fall, wo ein Patient nach einem Autounfall aufgefordert wurde, selber Nadel und chirurgischen Faden zu kaufen, um seine Wunden zu nähen. Schwangere gebären wieder in ihren Dörfern, diesmal nicht aus Angst vor Ebola, sondern weil sie das Vertrauen in das öffentliche Gesundheitssystem verloren haben. Patienten, die es sich leisten können, lassen sich im Ausland behandeln.
Einige Dinge waren während des Ebola-Ausbruchs sogar besser als heute, findet Krankenschwester Mabel Musa, die damals unermüdlich im Einsatz war. Sie arbeitete für eine internationale Organisation, brachte Ebola-Patienten in Behandlungszentren, überredete Familien ihre Kinder, Väter und Mütter gehen zu lassen, sprach Hinterbliebenen Mut zu.
"Damals gab es Krankenwagen, mit denen wir Ebola-Patienten in den Dörfern abgeholt haben. Ich weiß nicht, was los ist, weil: Eigentlich sollten diese Krankenwagen noch da sein. Aber jetzt sterben die Menschen, weil es zu Verspätungen kommt. Jemand ruft um neun Uhr abends einen Krankenwagen, der kommt dann aber erst um vier in der Früh. Manchmal gibt es auch kein Benzin. Während Ebola gab es Krankenwagen und wir hatten Partner hier."

Feiern auf den Straßen von Monrovia: Liberia ist frei von Ebola.© picture alliance / AP Photo / Abbas Dulleh
Aus Angst vor einer weltweiten Ausbreitung Ebolas ließ die internationale Gemeinschaft viel Geld in den Kampf gegen das Virus fließen. Rund 3,5 Milliarden Euro standen zur Verfügung. Doch geblieben ist davon kaum etwas, auch verließen mit dem Ende der Epidemie die meisten Hilfsorganisationen das Land. Die Patientin Comfort Gbainsay sagt:
"Es wird hier alles schwieriger. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an der wirtschaftlichen Situation oder am neuen Präsidenten. In allen Bereichen in diesem Land ist es schwieriger geworden: was die Gesundheit, die Bildung angeht. Alle Bereiche sind betroffen. Wenn man kein Geld hat, dann läuft einfach nichts mehr."
Präsident und Ex-Fußballstar George Weah ohne Erfolge
Viele schieben die Schuld für die katastrophale Situation nicht auf Ebola, sondern vielmehr auf die neue Regierung. Seit zwei Jahren ist George Weah Präsident von Liberia. Die Wähler hatten große Hoffnungen in den Ex-Fußball Star gesetzt. Er wollte der Korruption Einhalt gebieten, Investoren ins Land locken und das Gesundheitssystem wieder aufbauen. Aber bisher ist nichts geschehen.

Steht wegen schlechter Wirtschaftsdaten in der Kritik: Liberias Präsident George Weah.© Getty Images / Anadolu Agency
Im Gegenteil: Die Wirtschaft hat sich seit dem Amtsantritt Weahs dramatisch verschlechtert. Banken können kein Geld auszahlen, Gehälter bleiben aus und die Preise von Konsumgütern steigen. Mit jedem Tag wird die Stimmung im Land negativer, die Menschen sind entmutigt, gar hoffnungslos. Auch Tolbert Nyenswah hat vor der aussichtslosen Situation kapituliert und ist von seinem Job als Leiter des National Public Health Institute of Liberia zurückgetreten. Für ihn habe die Regierung an Glaubwürdigkeit verloren.
Die Krankenschwester Mabel Musa hat noch nicht aufgegeben. Sie geht gestärkt und mit mehr Selbstbewusstsein aus der Ebola-Krise.
"Wir sind dankbar dafür, dass die Erfahrung unseren Horizont erweitert hat. Wir haben jetzt größere Träume, wollen mehr erreichen. Es hat uns diesen großen Anstoß gegeben, hart zu arbeiten und vorwärts zu kommen."