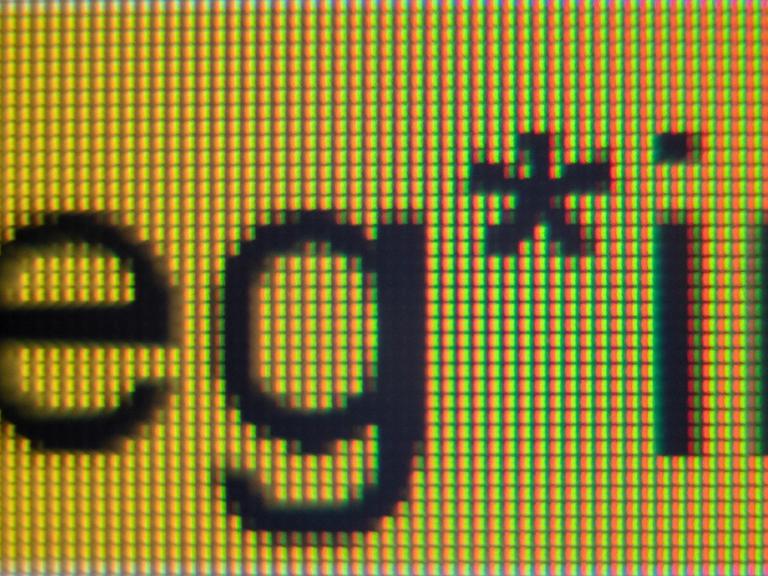Fabio De Masi, Die Linke, ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er hat sich vor allem als Finanzpolitiker einen Namen gemacht. Ende Februar gab er bekannt, dass er nicht erneut für den Bundestag kandidiert.
"Identitätspolitik stellt sich in ihrer Zuspitzung selbst ein Bein"
29:46 Minuten

Der Linken-Politiker Fabio De Masi befürchtet, dass die identitätspolitischen Debatten in seiner Partei zum Verlust von Wählerstimmen führen. Wer versuche, Politik nur über Betroffenheit zu machen, vernachlässige die Probleme der Bevölkerungsmehrheit.
Fabio De Masi (Die Linke) ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Ein zweites Mal wird er nicht antreten, gab er vor Kurzem bekannt, nicht zuletzt, weil er von Debatten in seiner eigenen Partei frustriert ist. Er bekomme zwar sehr viel Schulterklopfen für seine Arbeit als Finanzpolitiker, aber seine Partei wollten die Leute dann nicht wählen.
"Es färbt gar nicht auf die Partei ab, weil viele Leute sagen: 'Wir nehmen dich und deine Arbeit ganz anders wahr als die Schwerpunkte deiner Partei’."
Identitätspolitik könne wichtige Beiträge leisten und auf Diskriminierungen aufmerksam machen, räumt De Masi ein. "Wogegen ich mich nur wende, ist: Wenn wir unsere Anstrengungen, unsere Ressourcen, unsere Kraft nur noch darauf verwenden, bestimmte einzelne Interessen zu betonen und nicht mehr über gemeinsame Lösungen nachdenken. Das ist es, was mir negativ aufstößt."
Alle verdienen Respekt
Man dürfe auch nicht die Menschen vor den Kopf stoßen, die in Niedriglohnjobs arbeiten, mit Ungerechtigkeiten zu kämpfen haben, aber nicht "korrekt" sprechen. Auch deren Anliegen müsse die Partei Die Linke ernst nehmen:
"Auch die Menschen, die nicht gesehen werden in unseren medialen Diskursen - die auf Twitter oder in den sozialen Medien häufig keine Rolle spielen, weil sie keine Journalisten, Politiker oder andere Meinungsmacher sind - haben eine Identität. Und auch die wollen zum Beispiel Respekt für ihre Arbeit. Auch die wollen wahrgenommen werden."
Man dürfe nicht zu seinem Gegenüber sagen, "weil du ein alter weißer Mann bist, sind deine Argumente nichts wert". Das sei eine Strategie, sich einer rationalen Diskussion zu entziehen. "Das ist ungeheuer elitär und autoritär und hat eigentlich gar nichts mehr mit dem eigentlichen Anliegen zu tun, nämlich Menschen zusammenzubringen."
Identitätspolitik kann rechten Politikern nutzen
De Masi warnt auch davor, dass Identitätspolitik rechten Politikern in die Hände spielen könne. Schließlich seien es immer Rechte gewesen, die Menschen auf ihre äußeren Merkmale reduziert hätten. "Deswegen glaube ich, dass Identitätspolitik sich teilweise in ihrer Zuspitzung selbst ein Bein stellt."
So habe zum Beispiel Donald Trump Identitätspolitik gemacht. "Daran sieht man, wie verlogen auch Identitätspolitik sein kann, wenn sie an bestimmten Problemen vorbeigeht."
Sorgen macht De Masi der hohe Anteil an Nichtwählern in Deutschland. Er empfiehlt seiner Partei, auch in die sogenannten abhängten Stadtteile zu gehen, Präsenz zu zeigen, sich zu kümmern. "Aber es bringt alles nichts, wenn eine Partei zum Beispiel in ihrer ganzen Außendarstellung dann so auftritt, dass viele Menschen mit ihr nichts anfangen können."
(sf)
________________________________________________________________________________________________________
Das Interview in ganzer Länge:
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben vor Kurzem in einer persönlichen Erklärung bekannt gegeben, dass Sie nicht wieder für den Bundestag kandidieren werden, aus persönlichen Gründen, das Kind kommt zu kurz, aber offenbar auch aus Gründen, die mit Ihrer Partei zu tun haben und mit der Frage, in welchem Verhältnis linke Politik und Identitätspolitik stehen. Wenn ich Ihre Erklärung richtig gelesen habe, dann sehen Sie einen Widerspruch oder zumindest einen Konflikt zwischen Identitätspolitik und solidarischer Politik. Warum?
De Masi: Ich denke nicht, dass Fragen von Identität völlig unberechtigt sind. Das ist nicht meine Position. Aber ich glaube, dass es immer die Aufgabe linker Politik war, gemeinsame Interessen von Menschen zu betonen. Der Anspruch linker Politik war ja, wir vertreten zum Beispiel jene Menschen, die von ihrer Arbeit leben müssen. Das ist eine große Mehrheit in der Bevölkerung. Wir sehen eben nicht, wo kommt jemand her, wie sieht jemand aus, sondern: Welche gemeinsamen Interessen gibt es?
Wenn ich aber nur noch versuche, Politik über individuelle Betroffenheit zu machen und zu sagen, "ich fühle mich beleidigt, ausgegrenzt, weil nicht so gesprochen wird, wie ich mir das wünsche", dann verliere ich, glaube ich, Menschen für diese wichtige Aufgabe. Ich glaube, dass es zum Beispiel Millionen Menschen gibt, Millionen Frauen vor allem in Niedriglohnjobs, die auch nicht immer korrekt sprechen, die sich aber täglich zum Beispiel gegen Übergriffe von männlichen Chefs wehren müssen. Ich kann die nicht vor den Kopf stoßen und sagen, weil die nicht korrekt sprechen, nehme ich deren Anliegen nicht mehr ernst. Deswegen glaube ich, gibt es gewisse Übertreibungen der Identitätspolitik, die nicht weiterhelfen.
Deutschlandfunk Kultur: Das waren jetzt viele Punkte zusammengerührt. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich gern diesen Sprachstreit außen vor lassen. Das ist ein Thema, was auch wir hier im Programm ausführlichst und auch in der Redaktion thematisieren. Meiner Meinung nach hängt das nicht notwendig miteinander zusammen.
Sie haben gesagt, Sie wollen Politik für viele machen. Ich übersetze es mal so: und nicht für wenige. Das erinnert mich ein bisschen an die zweite Welle der Frauenbewegung in der Bundesrepublik, 60er-, 70er-Jahre, als die Frauen von den linken sozialistischen Genossen immer abgetan wurden: "Jetzt lasst mal, das ist ein Nebenwiderspruch. Wir klären jetzt erst mal den Hauptwiderspruch und führen erst mal den Sozialismus ein, dann kümmern wir uns um euch."
Politische Probleme lassen sich nicht mit Moral lösen
De Masi: Das ist absolut nicht meine Position. Mir geht es nicht darum, nicht die Interessen von Frauen zu vertreten oder nicht gegen den Klimawandel Politik zu machen. Mir geht es übrigens noch nicht einmal darum, dass man nicht darauf achten sollte, welche Sprache man verwendet. Die Frage ist nur, wie man ein Thema angeht und ob man bereit ist, auch zu versuchen, Menschen von unterschiedlichen Standpunkten und Erfahrungen abzuholen oder eben das Trennende zu betonen.
Ein Beispiel: Es gibt sicherlich Menschen, die über ein höheres Einkommen verfügen, sagen wir, ein Kunstprofessor. Die verfügen über ein hohes ökologisches Bewusstsein, haben aber trotzdem einen höheren ökologischen Fußabdruck als, sagen wir, irgendein Malocher, der sagt, "mir ist die Mülltrennung egal", weil sie öfter in den Urlaub fliegen.
Jetzt kann ich natürlich betonen, wie hoch und ausgeprägt das ökologische Bewusstsein des Professors ist. Er kann dem Malocher mit erhobenem Zeigefinger Vorträge halten. Oder ich kann mich darum bemühen, dass wir eine Wirtschafts- und Produktionsweise finden, die unser Klima schont. Oder ich kann jemandem einen Vortrag halten, weil er nicht mit dem Fahrrad fährt. Aber die betreffende Person kann sich vielleicht im Unterschied zum Professor die Miete in der Innenstadt nicht mehr leisten und hat keine guten Bus- und Bahnverbindungen auf dem Land. Dann ist es eine Aufgabe von Politik, die Gemeinsinn stiftet, dass ich dafür sorge, dass wir mit staatlichen Investitionen in Busse und Bahnen ein gutes Verkehrsangebot auf dem Land haben.
Ich kann dieses politische Problem des Klimawandels nicht allein über die Moral lösen, das dient mehr einer gewissen Selbstbefriedigung. Das ist meine Kritik an der Art und Weise, wie wir teilweise Diskussionen führen.
Identitätspolitik kann wichtigen Beitrag leisten
Deutschlandfunk Kultur: Okay. Da geht es um moralische Selbstgerechtigkeit, das soll ein Phänomen sein, das in Deutschland nicht ganz selten vorkommt. Ich verstehe Ihre Beispiele vollkommen. Natürlich, wer mit dem SUV vor den Bioladen fährt und meint, er sei jetzt ökologisch. Keine Frage, darüber kann man sehr viele lustige oder auch, je nach Perspektive, traurige Geschichten erzählen.
Sie haben von öffentlichen Verkehrsmitteln gesprochen. Ich nehme das mal auf und sage: "Super! Wir machen jetzt öffentliche Verkehrsmittel für alle und vor allen Dingen auch für die, die darauf angewiesen sind. Damit machen wir jetzt solidarische Politik für alle." Aber dann gibt es immer Gruppen, die vergessen werden, zum Beispiel in Deutschland sehr gern Menschen mit Behinderung. Ich weiß nicht, ob Sie mal versucht haben, im Rollstuhl in Berlin von Punkt A nach B zu kommen oder, wenn Sie Nachtschicht arbeiten, sich in Hamburg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen, ohne dass Sie eine Stunde auf den nächsten Nachtbus warten müssen.
Ich glaube, das ist auch ein Anliegen der Identitätspolitik: "Ihr sagt immer, ihr macht Politik für alle, aber ihr vergesst Leute. Deswegen müssen wir jetzt mal darauf hinweisen, dass ihr uns vergessen habt."
De Masi: Das ist auch ein wichtiger Beitrag, den Identitätspolitik leisten kann. Ich lehne ja nicht rundherum Debatten der Identitätspolitik ab. Ich könnte genauso darüber sprechen, dass auch die Menschen, die in unseren medialen Diskursen nicht gesehen werden - die auf Twitter oder in den sozialen Medien häufig keine Rolle spielen, weil sie keine Journalisten, Politiker oder andere Meinungsmacher sind - auch eine Identität haben. Auch die wollen zum Beispiel Respekt für ihre Arbeit. Auch die wollen wahrgenommen werden. Insofern bin ich nicht grundsätzlich gegen Identität. Ich habe zum Beispiel ein großes Verständnis dafür, dass es in den USA und auch anderswo die Black-Lives-Matter-Bewegung geben musste. Denn all das sind Themen und Probleme, wie Rassismus zum Beispiel, die real existieren.
Wogegen ich mich nur wende, ist: Wenn wir unsere Anstrengungen, unsere Ressourcen, unsere Kraft nur noch darauf verwenden, bestimmte einzelne Interessen zu betonen, und nicht mehr über gemeinsame Lösungen nachdenken. Das ist es, was mir negativ aufstößt. Ich kann bestimmte politische Probleme nicht nur auf dieser Ebene behandeln.
Ich glaube im Übrigen, dass eine bestimmte extreme Form der Identitätspolitik sogar eher ein rechtes Anliegen ist. Donald Trump zum Beispiel hat sehr stark Identitätspolitik gemacht. Das heißt, er hat Politik für sich selbst, für die Reichsten an der Wall Street gemacht, aber hat gleichzeitig versucht, durch seine Sprache zum Beispiel die sogenannten weißen Industriearbeiter im Rust Belt in den USA anzusprechen. Daran sieht man, wie verlogen auch Identitätspolitik sein kann, wenn sie an bestimmten Problemen vorbeigeht.
Das heißt zum Beispiel: Es ist legitim, auch Sprache kritisch zu reflektieren. Aber wenn wir am Ende all unsere Kraft darauf verwenden, uns nur noch über Sprache zu streiten, und uns am Ende vielleicht darüber streiten, ob die Anliegen der Gleichberechtigung der Frauen über Quoten in Aufsichtsräten geregelt werden, aber die Millionen Frauen in den Niedriglohnjobs vergessen, dann, glaube ich, hat auch Identitätspolitik ein Problem.
Deutschlandfunk Kultur: Ich komme zurück zu Ihrem Beispiel. Sie sagen, Sie finden Identität eigentlich eine gute Sache, und kommen dann sofort auf Black Lives Matter. Ich glaube, der Punkt, den Vertreterinnen und Vertreter der Identitätspolitik machen, ist, dass wir alle Identitäten haben, die mehrere und verschiedene sind. Sie schreiben in Ihrer Erklärung, Bernie Sanders ist ein alter weißer Mann, aber er hat sich immer für gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne eingesetzt.
Diese Bezeichnung "alter weißer Mann" ist für mich so etwas wie eine Umkehr. Man sagt damit: Guckt mal, Leute, ihr denkt immer, ihr seid die Normalen. Wolfgang Thierse sieht sich jetzt als Symbol für die normalen Menschen, der studierte Germanist und ehemalige Bundestagspräsident. Da muss ich wirklich kichern. Wir haben kein Problem damit, von "jungen Männern mit Migrationshintergrund" zu sprechen, aber alle reagieren beleidigt, wenn man sagt "alter weißer Mann".
Damit zeigt man erst mal nur: Auch ihr habt eine Identität. Ihr behauptet nur immer, ihr wärt die Normalen. Aber wir sind alle normal oder unnormal, je nachdem.
Diskurse über den "alten weißen Mann" führen nicht weiter
De Masi: Ja, aber ich glaube nicht, dass dies der Effekt dieser Debatten ist. Joe Biden hat die Wahl gewonnen, weil er auch in erheblichem Umfang alte weiße Männer angesprochen hat und sie zum Beispiel aus der Trump-Wählerschaft wieder herauslösen konnte. Wenn ich jetzt an diese Menschen herantrete und in einer abwertenden Form sage, "ihr seid eben alte weiße Männer", dann würde ich wahrscheinlich einem Donald Trump einen Gefallen tun.
Ich erinnere mich gut an ein Gespräch mit einer Bekannten. Damals, noch während der US-Wahlen, als Hillary Clinton die Gegnerin von Donald Trump um die Präsidentschaftskandidatur war, da hat sie gesagt: "Ich unterstütze Hillary Clinton, denn die tut etwas für die Frauen." Meine Position war, Hillary Clinton tut vielleicht eher etwas für die Frauen an der Wall Street als für die Millionen Frauen in den USA, die bei McDonalds arbeiten. Ich habe zum Ausdruck gebracht: Ich unterstütze Bernie Sanders. Da hat sie gesagt: "Bernie Sanders, das ist doch ein alter weißer Mann."
Ich glaube, dass in der damaligen Situation unter Umständen – das haben dann auch Nachwahlbefragungen gezeigt – Bernie Sanders in der Lage gewesen wäre, sich durchzusetzen. Es kommt hinzu: Bernie Sanders hat über viele, viele, viele Jahre für die Interessen von Latinos, von Afroamerikanern auf dem Arbeitsmarkt in den USA gestritten, die auch überwiegend Frauen sind. Deswegen finde ich, dass ein solcher Diskurs nicht weiterführt.
Gleichzeitig haben wir Unternehmen wie Amazon, die sich für ihre Diversität in Werbespots feiern, aber "Union Busting" betreiben, also Gewerkschaften bekämpfen und auch während der Coronakrise Menschen vor die Tür setzen, die überwiegend Frauen, Afroamerikaner, Latinos sind. Deswegen glaube ich, kommen wir mit diesen Schablonen nicht weiter, genauso wie wir nicht damit weiterkommen, wenn wir nur noch über junge Männer mit Migrationshintergrund sprechen.
Diskurs dürfen nicht auf Äußerlichkeiten verengt werden
Deutschlandfunk Kultur: Ich gebe Ihnen recht. Wenn das als ein Schimpfwort verwendet wird, bin ich auch nicht bei Ihnen. Ich nehme das auch mit Humor und bin durchaus in der Lage, über mich als "alte weiße Frau" zu sprechen. Ich finde, das ist ein Augenöffner, genauso wie dieses eigentlich böse Wort, aber man kann es auch mit einem Augenzwinkern zur Kenntnis nehmen, von "Menschen mit Nazi-Hintergrund" für Deutsche.
Denken wir mal an einen anderen Linken in einem Nachbarland, nämlich in Frankreich: Didier Eribon. Der, glaube ich, politisch mit Ihnen in vielem übereinstimmt. Eribon hat in seiner Autobiografie "Rückkehr nach Reims" eindrücklich beschrieben, er kommt aus einer kommunistischen Familie, aus einem komplett kommunistischen Milieu, das aber extrem homophob war. Das hat sein Leben, als er dort noch lebte und sich als Schwuler verstecken musste, sehr eingeschränkt und auch sein Lebensglück beschädigt. Ich glaube, dass man für gute Löhne streiten kann und gleichzeitig auch für die Rechte von Schwulen und Lesben zum Beispiel.
De Masi: Absolut. Da bin ich auch absolut bei Ihnen. Nur, was mich sehr umtreibt, ist, dass – wenn wir in die sozialen Medien gehen – häufig diese Diskurse auf Äußerlichkeiten verengt werden. Das schlägt dann irgendwann zurück. Denn Sie können auch wie, sagen wir mal, Alice Weidel, eine Frau in einer lesbischen Beziehung mit einer Frau mit Migrationshintergrund sein und trotzdem ganz furchtbare Positionen vertreten …
Deutschlandfunk Kultur: Ja, natürlich!
De Masi: … und eine Politik gegen diese Interessengruppen machen. Deswegen glaube ich, dass es eben nicht weiterführt, wenn wir Politik auf solche äußeren Merkmale reduzieren. Denn, Menschen auf diese Merkmale zu reduzieren, ist immer auch ein Anliegen rechter Politik gewesen, also, bestimmte Gruppen abzuwerten, indem ich sage: "Die sind nicht weiß." Oder: "Die haben eine andere Herkunft" oder "eine andere sexuelle Orientierung". Deswegen glaube ich, dass Identitätspolitik sich teilweise in ihrer Zuspitzung selbst ein Bein stellt.
Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel. Es gibt sicherlich viele Menschen auf dem Land in Deutschland, die leben anders als ich. Die haben vielleicht einen kleinen Schrebergarten. Da steht vielleicht so ein Deutschlandfähnchen und es wird gern gegrillt und ordentlich Bier gezapft. Darunter sind vielleicht viele Menschen, die in der einen oder anderen Frage eine andere Haltung oder Einstellung als ich haben. Aber trotzdem können sie ansprechbar sein für ein gutes Rentensystem. Oder sie können sich Sorgen darüber machen, dass in der Coronakrise die Ungleichheit zunimmt. Oder sie können sich darüber aufregen, dass wir einen Mangel an Impfstoffen in Deutschland haben. Ich kann mit diesen Menschen darüber eine Diskussion führen.
Wenn ich mich aber nur darauf konzentriere, dass sie vielleicht eine andere Lebensrealität als ich haben, dann verliere ich sie häufig, eben auch in der Ansprache. Denn ein Mensch will von seinem Gegenüber mit Respekt behandelt werden. Das gilt natürlich genauso für die Menschen, die sagen: "Ich möchte nicht aufgrund meiner Hautfarbe, meiner sexuellen Orientierung respektlos behandelt werden." Aber ich darf es auch umgekehrt nicht zu einem Ausschlussgrund machen und sagen: "Weil du eben ein alter weißer Mann bist, hast du nichts zu melden, in dieser Debatte sind deine Argumente nichts wert."
Das ist häufig eine Strategie, um sich einer rationalen Diskussion zu entziehen. Das ist ungeheuer elitär und autoritär und hat eigentlich gar nichts mehr mit dem eigentlichen Anliegen zu tun, nämlich Menschen zusammenzubringen.
Alle Menschen wollen mit Respekt behandelt werden
Deutschlandfunk Kultur: Sie sagen, Menschen auf Merkmale zu reduzieren, bringe nicht weiter. Da würden Ihnen sicher viele zustimmen. Nur das Problem ist ja, dass das häufig unter der Hand passiert. Ich habe die Beispiele aus der Frauenbewegung genannt. Sie können Menschen fragen, die nicht so aussehen wie sich die Mehrheit der Deutschen offenbar immer noch deutsche Bürger vorstellt. Dann können Sie sie fragen, wie leicht oder schwer es ihnen fällt, eine Wohnung zu finden oder eine Arbeit zu bekommen. Das heißt, Rassismus hat auch direkt ökonomische Folgen. Das sehen wir auch an allen Zahlen, der Schulabschlüsse usw. Von den Beschäftigten im Niedriglohnsektor sind in Deutschland 40 Prozent Migranten, im OECD-Durchschnitt nur 25 Prozent.
Das heißt, dieser Satz "Menschenrechte für alle" - oder: "Universalismus!" - nehmen wir das deutsche Grundgesetz, "Männer und Frauen sind gleichberechtigt", Artikel 3, was das jahrzehntelang geheißen hat in der Bundesrepublik, muss ich Ihnen hier nicht aufzählen. Erst 1997 wurde zum Beispiel die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt.
Das heißt, ich sehe die Identitätspolitik als einen Versuch, darauf aufmerksam zu machen, dass diese solidarische, universalistische Politik sehr wohl Menschen diskriminiert. Den Separatismus sollte man definieren nicht als Ziel, sondern als Weg dazu, was meiner Meinung nach das Ziel jeder Emanzipationsbewegung doch eigentlich ist, nämlich dass diese Unterschiede irgendwann tatsächlich keine Rolle mehr spielen. Könnten Sie sich auf so eine Verbindung von linker und Identitätspolitik einlassen?
De Masi: Zunächst muss ich mal feststellen, weil Sie das gerade erwähnten: Mit Friedrich Merz führe ich gerade einen Rechtsstreit aufgrund seiner Haltung zur Frage der Vergewaltigung in der Ehe. Also, ich bin niemand, den man in dieser Frage bekehren muss.
Mein Vater hat als einer der Ersten in meiner italienischen Familie studiert und war damals bei Wertkauf im Lager angestellt und musste Pakete kleben. Dann hat er ein Personalgespräch bekommen, weil er nach "Scotch" fragte. Das ist der italienische Tesafilm, er wollte nur ein Paket kleben. Daraufhin dachte man, er hätte ein Alkoholproblem. Also, ich kenne diese Realitäten aus meiner eigenen Familiengeschichte. Ich bin jederzeit dabei, das zu kritisieren.
Nur ich glaube, dass es in vielen politischen Themen, die wir derzeit verhandeln, eben nicht nur um dieses ursprüngliche Ziel geht. Auch jetzt in der Coronakrise erleben wir wieder bestimmte Spaltungslinien in der Gesellschaft, die meines Erachtens teilweise in der Diskussion vertieft werden.
Da gibt es die einen, die Corona leugnen. Das finde ich falsch. Dann gibt es die anderen, die im Homeoffice sitzen und auf ihren Twitter-Profilen jeden Morgen der Welt erzählen, warum die anderen den Drosten-Podcast noch nicht gehört hätten …
Deutschlandfunk Kultur: ... aber Sie lesen das, Herr De Masi!
De Masi: Ich lese das, natürlich. Ich muss mich ja an diesen Debatten beteiligen, weil ich als Politiker auch in den sozialen Medien unterwegs bin. Was ich daran interessant finde, ist, die große Mehrheit der Bevölkerung – mein Eindruck – sind keine Leute, die Corona leugnen, aber die trotzdem zum Beispiel sagen, es gibt Missmanagement in der Coronakrise. Den haben wir bei den Impfstoffen oder in der Widersprüchlichkeit bestimmter Regelungen.
Als ich zum Beispiel vor einigen Wochen das Impfstoffmanagement kritisiert habe, kamen Leute zu mir, die sich wahrscheinlich selbst als im weitesten Sinne linksliberale aufgeklärte Menschen empfinden. Die empfanden es als eine Art Majestätsbeleidigung, die Bundesregierung für das Impfstoffmanagement zu kritisieren, und warfen allen Kritikern "Impfstoffnationalismus" vor, weil wir auf eine europäische Lösung gesetzt hätten und daher nicht mehr bestellt hätten.
Die Kritik am Impfstoffmanagement war aber unter anderem von mir, dass wir nicht in die Patente eingreifen, damit auch Länder wie Südafrika oder Indien Impfstoffe produzieren können, dass der Staat nicht stärker technologische Kooperationen unterstützt, weil es einfach nicht gewinnmaximierend für die Pharmaindustrie ist, jetzt noch mehr Fertigungslinien zu bauen.
Eigentlich war mein Anliegen, dass wir mehr Impfstoff auch im globalen Maßstab anbieten. Trotzdem wird dann mit diesen Etiketten gearbeitet. Wer die Bundesregierung kritisiert, ist auf einmal ein Impfstoffnationalist. Ich finde, das ist eine Verkürzung von komplexen Debatten, die uns zum Beispiel bei der Lösung dieses Problems überhaupt nicht weiterhilft. Einen Verhandlungsprozess in einer politischen Diskussion löse ich nicht durch Etiketten wie "Impfstoffnationalist" oder "Schwurbler" oder "Covidiot", sondern ich muss eine kritische Debatte führen und in der Gesellschaft zulassen. Das ist häufig nicht der Fall.
Frustriert von der eigenen Partei
Deutschlandfunk Kultur: Kritische Debatten führen nennt man Demokratie. Dass Debatten verkürzt werden, auch polemisch verkürzt werden, Schlagworte genannt werden, ist, glaube ich, nicht erst ein Twitter-Phänomen.
Wenn wir jetzt auf Ihre Partei gucken, dann habe ich Ihren Nicht-Wiederantritt für die Bundestagswahl so verstanden: Zum einen gab es eine starke Arbeitsüberlastung. Das, sagen Sie, liege auch daran, dass es so wenige Finanz- und Wirtschaftspolitiker in Ihrer Partei gibt - ich schlage jetzt einen großen Bogen -, weil sich die Leute alle mehr für Identitätspolitik interessieren. "Und wir sollten doch eher" - ich spreche jetzt für Sie, ich bin nicht Mitglied der Partei Die Linke -, "wir sollten eher Angebote machen für die Beschäftigten im Niedriglohnsektor usw. Und dann werden wir auch wieder mehr Wählerstimmen gewinnen." Habe ich das richtig zusammengefasst?
De Masi: Ich sage im Kern: Es ist richtig, dass wir zum Beispiel Fragen wie den Klimawandel und diese Dinge bearbeiten. Aber wir müssen uns sehr genau überlegen, mit welcher Sprache wir das tun und mit welchen Akzenten und Schwerpunkten. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass man sich dann zum Beispiel nicht an irgendwelchen Twitter-Debatten über die Frage beteiligt, wer fährt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, sondern Investition in unsere Verkehrssysteme in den Mittelpunkt stellt.
Ich glaube, dass wir das in der Vergangenheit vernachlässigt haben. Wir erleben gerade, dass ökonomische Debatten zentral sind. Wer bezahlt für die Krise? Wer hat was im Portemonnaie? Das sind die Fragen, die gerade verhandelt werden, auch nach der Corona-Krise. Oder: Wie organisieren wir Impfstoff? Wirtschaftspolitische Debatten sind viel breiter als nur der Wirecard-Skandal oder die Steuerpolitik. All das sind ökonomische Fragen. Viele Menschen, die sich vielleicht auch für identitätspolitische Fragen interessieren, sagen: "Warum soll ich die Linke wählen, wenn sie in diesen zentralen Fragen nicht hinreichend vorkommt?"
Deswegen war mein Eindruck: Ich bekomme viel Schulterklopfen für meine finanzpolitische Arbeit. Die Leute sagen: "Wir finden, mit dir kann man diskutieren. Aber wir wählen deine Partei trotzdem nicht, denn da gibt es so ein paar schräge Debatten." Das ist natürlich eine ungeheuer frustrierende Erfahrung, weil man dann irgendwann merkt, man strengt sich an, man versucht doppelt so gut zu sein. Man bekommt dafür sehr viel Schulterklopfen, aber es färbt gar nicht auf die Partei ab, weil viele Leute sagen: "Wir nehmen dich und deine Arbeit ganz anders wahr als die Schwerpunkte deiner Partei."
Das war im Wesentlichen meine Kritik. Ich will damit meiner Partei helfen, dass sie die Themen und Diskussionen, die es in der Gesellschaft gibt, so ausbalanciert, dass sie auch Menschen erreicht, für die diese Debatten nicht der Mittelpunkt ihrer Lebenswirklichkeit sind. Denn es gibt doch viele Menschen in Deutschland, die mit den ganzen Abkürzungen und Begriffen, die es in dieser Debatte gibt, wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen können, die aber trotzdem nicht schlechten Willens sind, die sich trotzdem für eine soziale Politik engagieren würden, die trotzdem Rassismus und andere Dinge falsch finden. Das ist einfach meine Wahrnehmung.
Ich bin allein in Hamburg letzte Woche von drei Personen genau auf diesen Umstand auf der Straße völlig zufällig angesprochen worden. Eine solche Häufung ist auch ein Zeichen dafür, dass es da offenbar auch eine große Unzufriedenheit in der Gesellschaft gibt.
Wie die Nichtwähler erreichen?
Deutschlandfunk Kultur: Oder auch vielleicht eine Unsicherheit, weil sich gerade auch etwas ändert. Noch mal kurz zu dem Punkt: Politik für viele anbieten, Politik anbieten für diejenigen, die ökonomisch schwach sind. Das sehen Sie als die Kernaufgabe Ihrer Partei.
Ich hatte neulich ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Michael Zürn. Der sagte, dass die demokratischen Parteien offenbar allesamt noch nicht verstanden haben, dass es eine große Unzufriedenheit mit dem politischen System an sich gibt. Laut Umfragen aus der Zeit vor Corona ist die übergroße Mehrheit der Bürger in diesem Land sehr zufrieden mit der eigenen sozioökonomischen Situation, aber nicht zufrieden mit dem politischen System. Es geht gar nicht darum, jetzt den Mindestlohn um drei Euro anzuheben, sondern es geht darum, die Menschen wieder in die Demokratie reinzuholen.
De Masi: Ja, das spielt sicher auch eine Rolle. Natürlich geht es nicht nur darum, dass wir Menschen ansprechen sollen, die soziale Probleme haben. Das ist übrigens auch nicht mein Verständnis von "viele Menschen ansprechen". Wir müssen auch die Mittelschichten ansprechen. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendwelche politischen Probleme lösen oder die Arbeiter und Arbeitslosen jetzt dadurch ansprechen, dass wir sagen, der Hartz-4-Satz wird verdoppelt. Das würde übrigens in bestimmten Bereichen der Arbeiterschaft gar nicht mal Pluspunkte bringen. Deswegen, glaube ich, ist das auch nicht so einfach. Aber, wir haben eine Drittelgesellschaft, das zeigen viele Studien …
Deutschlandfunk Kultur: … ein Drittel geht gar nicht wählen.
De Masi: Genau. Wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, wie wir jene Menschen erreichen, die sich eigentlich aus dem politischen Prozess schon verabschiedet haben. Ich glaube, dass bestimmte Phänomene, wie wir sie jetzt während der Coronakrise sehen, auch damit zu tun haben.
Deutschlandfunk Kultur: Aber Sie bleiben auf der inhaltlichen Ebene. Mein Punkt war …
De Masi: Ich versuche regelmäßig, auf der inhaltlichen Ebene zu bleiben.
Deutschlandfunk Kultur: Das ist schön, aber ich wollte über die Strukturen sprechen, also darüber, wie unsere Demokratie organisiert ist. Ist es nicht eine Aufgabe für alle demokratischen Parteien, die Beteiligung an der Demokratie wieder zu erhöhen?
De Masi: Ja. Allerdings ist die Frage, wie dies gelingt.
Deutschlandfunk Kultur: Ich glaube, nicht allein durch bessere Wahlprogramme. Das ist der Punkt, den ich versuche zu machen.
De Masi: Da würde ich Ihnen sofort zustimmen. Wahlprogramme sind häufig dick wie Telefonbücher, haben eine grauenhafte Sprache. Wer liest schon gerne Wahlprogramme? Aber es ist auch keine Lösung, wie es sich manche vorstellen, dass wir alles im Internet streamen und dadurch ergibt sich eine ganz hohe politische Mitwirkung. Ich war Mitglied des Europäischen Parlaments. Da wurde fast alles öffentlich übertragen, aber es hat keiner mitbekommen, weil es dafür keine Öffentlichkeit gab.
Das heißt: Wir bemerken jetzt auch in der Coronakrise das Phänomen, dass immer mehr im digitalen Raum stattfindet. Es gibt aber Menschen, die sich an diesen digitalen Prozessen gar nicht beteiligen, die quasi auch in einer Isolation sind.
Haustürwahlkampf gegen Demokratiemüdigkeit
Deutschlandfunk Kultur: Schon klar. Aber wie würden Sie die Demokratie wieder stärken wollen und dieses Drittel erreichen, das gar nicht wählt?
De Masi: Ich glaube, dass kein Weg dran vorbei führt, zum Beispiel ganz klassischen Haustürwahlkampf zu machen; dass Parteien zum Beispiel in die sogenannten abgehängten Stadtteile gehen und dort nicht nur zu Wahlen einmal an der Tür klingeln, sondern dauerhaft Präsenz zeigen und ansprechbar sind und auch ein Stück weit Kümmererpartei sind, so wie wir das früher teilweise im Osten Deutschlands waren. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ich glaube, dass dies möglich ist. Das zeigen auch verschiedene Erfahrungen.
Wir hatten letztens in Österreich einen Wahlerfolg der SPÖ, wo sie der FPÖ viele Wähler wieder entziehen konnte, weil sie einen klaren Kurs gegen Privatisierung von Wohnraum gefahren hat, weil sie in diesen Stadtteilen verankert war. Das ist eine wichtige Aufgabe. Wenn der Berg nicht zum Propheten geht, muss der Prophet zum Berg. Aber es bringt alles nichts, wenn eine Partei zum Beispiel in ihrer ganzen Außendarstellung dann so auftritt, dass viele Menschen mit ihr nichts anfangen können.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.